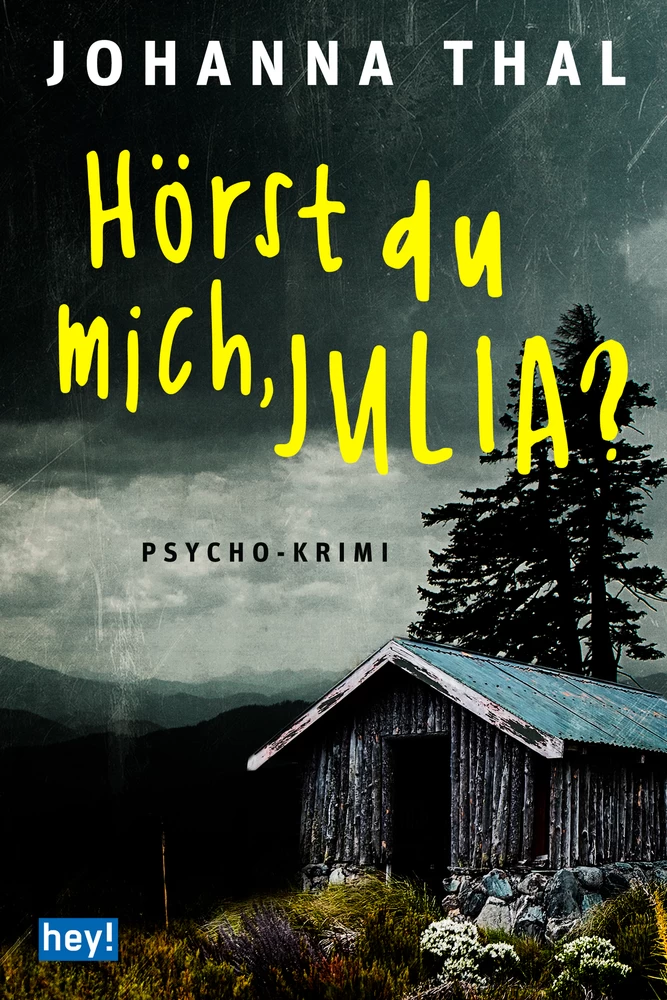Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Johanna Thal
Hörst du mich, Julia?
Psycho-Krimi
Kapitel 1
Als Mira Oltmann auf die Straße trat, fiel ihr die Sandlerin sofort auf und sie konnte nicht verhindern, dass sich ein eigenartiges Kribbeln in ihren Magen schlich. In etwa so, als habe sie eine Spinne verschluckt, die jetzt panisch in ihren Eingeweiden zappelte. Ganz sicher war es dieselbe Frau wie in der letzten Woche! Auch damals hatte die Frau auf dem Bordstein vor dem roten Haus gesessen, als Mira von der Kosmetikerin kam, den Duft der Aloe-Vera-Maske noch in der Nase hatte und die Brauen frisch gezupft waren. Und als Mira genau darüber nachdachte, glaubte sie sich zu erinnern, dass ihr die Landstreicherin sogar schon in der vorletzten Woche aufgefallen war, an exakt derselben Stelle! Weshalb hockte sie ausgerechnet hier, in dieser stillen Straße? Falls sie betteln wollte, wäre eine belebtere Gegend hundertmal besser geeignet. Mira hasste es, beobachtet zu werden, egal von wem, und diese wildfremde Frau hielt ihren Blick so stur auf sie gerichtet, als gäbe es nichts Interessanteres auf der Welt. Nur mit Mühe zwang sich Mira zur Vernunft, kämpfte ihre Nervosität nieder. Vielleicht wartete die Fremde bloß auf jemanden, und sah lediglich zu Mira, weil sie sich langweilte?
Die Augen hinter der teuren Brille zusammengekniffen – sie sollte mal wieder zum Optiker gehen, sich die Gläser anpassen lassen – musterte Mira die Fremde verstohlen. Eine Frau in ungefähr ihrem Alter, also knapp dreißig. Aber ihr Aufzug hatte nichts von Miras zurückhaltender Eleganz. Kurz geschnittene, dunkle Haare, mit Gel frech nach oben gestylt, eine riesige Sonnenbrille mit violetten Gläsern über den Augen, ein grünglitzernder Strass-Stein in der Nase, dazu ein grünkariertes Männerhemd über an den Knien abgewetzten, nicht besonders sauberen Jeans. Ihre helle Jacke hatte die Fremde achtlos neben sich auf den Gehsteig geworfen.
Was sie wohl für ein Leben führte, fragte sich Mira. Bei der Vorstellung, die Sandlerin könne nachts heimlich im Oltmann’schen Garten schlafen, rann ihr ein Schauer über den Rücken. Sie zog die dünne Jacke enger zusammen. Wie nie zuvor war ihr bewusst, dass das Haus der Kosmetikerin in einer ausgesprochen einsamen Straße lag, am Ortsende von Bayerisch Gmain, dort, wo die Wanderwege zum Dreisesselberg und Rotofen ihren Ausgangspunkt nahmen. Der Gedanke steigerte ihre Panik. Frauen wie diese Fremde waren absolut nicht Miras Fall, schüchterten sie allein durch ihre Anwesenheit ein. Andrerseits, wenn Mira ehrlich war, fühlte sie sich auch in Gesellschaft anderer Frauen nicht besonders wohl. Wie bei ihrer Schwiegermutter zum Beispiel, zu der sie gerade unterwegs war.
Gertrude Oltmanns strengem Blick entging nicht der kleinste Makel an ihrer Schwiegertochter, und wenn sie ausnahmsweise keinen entdecken konnte, konstruierte sie sich einen. Letzten Donnerstag, beim obligatorischen Nachmittagstee, hatte sie Miras Rock gerügt und Miras vorsichtigen Einwand, sie habe das Kleidungsstück in der von Gertrude empfohlenen neuen Boutique erstanden, rigoros abgeschmettert. „Du hast dich schlecht beraten lassen, warst sicher bei Juliane. Du hättest explizit nach Dorothea fragen sollen, das hatte ich dir doch erklärt!“
Ja, hatte sie. Und Mira ärgerte sich wieder über ihre Schüchternheit, die es ihr unmöglich gemacht hatte, eine Verkäuferin großspurig fortzuschicken und eine andere zu verlangen, wie ihre Schwiegermutter es ohne jeden Skrupel getan hätte.
Vielleicht, dachte Mira, war ihr die Fremde deswegen so wenig sympathisch, weil sie sie mit dem gleichen Blick musterte wie Gertrude, wenn sie etwas an Mira auszusetzen hatte? Mira war damit an zahllose schwierige Nachmittage, an zahllose Übelkeit erregend üppige Sahnetorten, zahllose ungerechtfertigte Rügen und zahllose Demütigungen vor Gertrudes versammelter Clique erinnert. Ja, bestimmt rührte die seltsame Nervosität nur daher. Und Mira tadelte sich für ihre Abneigung gegen die fremde Frau.
Trotzdem ging Mira schneller als sonst und das ungute Gefühl blieb wie ein treuer Schatten ihr Begleiter. Erst, als sie die nächste Häusergruppe erreichte, spähte Mira vorsichtig über die Schulter zurück. Von der Fremden nichts mehr zu sehen. ‚Sie ist dir nicht gefolgt, also bilde dir bloß keinen Unfug ein‘, ermahnte sich Mira. Sie wollte gar nichts von dir, diese Sandlerin. Vermutlich ruht sie sich einfach vom Betteln in der Stadt aus, weiß, dass die Polizei kaum in diese ruhige Wohngegend kommt und sie somit niemand zu vertreiben versucht. Vielleicht ist sie auch gar keine Sandlerin, sondern nur eine exzentrische Wandertouristin. Fahren ja genug Leute in seltsamer Aufmachung in die Berge.
Schon bald war Mira gezwungen, ihr ungewohnt rasches Tempo zu verlangsamen, denn ihre übliche Kurzatmigkeit machte es ihr schwer, über längere Strecken hinweg flott zu marschieren. Da fiel ihr auf, wie warm und sonnig der Tag sich präsentierte, wie geschäftig Meisen und Rotschwänzchen in den Gärten längs der Straße hin- und herflogen, genauso, wie es sich für den Juni gehörte. Der perfekte Tag, um einen Ausflug zu unternehmen, an einem Badesee im Schatten von Weiden oder Birken ein leichtes Picknick zu genießen und sich anschließend auf der Liegewiese in einen neuen Roman zu vertiefen. Wie lange mochte es her sein, dass Mira sich ein solches simples Vergnügen gegönnt hatte? Wieder drängte sich die fremde Frau in Miras Gedanken. Vielleicht lief sie nach ihrer wie auch immer begründeten Rast am Bordstein zurück in die Stadt, baggerte ohne jede Scheu wildfremde Männer an, die sie ins Café einluden, in der Hoffnung, es könne mehr daraus werden. Sicher gab es Männer, denen solch burschikose Frauen gefielen. Mira spürte einen unerwarteten Stich. Die fremde Frau hatte frei gewirkt, selbstbewusst. Wie schön musste es sein, sich so selbstsicher zu fühlen, dass man sich traute, auf Gehsteigen zu hocken und ungeniert Passanten anzustarren. Ungehobelt schien sie zwar, ein bisschen unverschämt sogar, diese andere, aber trotz allem ein klein wenig beneidenswert.
Als die strichdünne blonde Tussi immer schneller davontrabte, stand Sanne auf und stapfte in der entgegengesetzten Richtung fort. Besser wäre es, nicht zu lang am Haus der Gesichtsrenoviererin rumzulungern. Die Bender könnte was spitzkriegen und sich möglicherweise später erinnern. Den Bullen eine tolle Story aufdrängen. Oder ihre Beobachtungen an irgendwelche Zeitungsschmierer verscherbeln. Also lieber kein Risiko eingehen, nicht jetzt, wo alles perfekt vorbereitet war. Naja, wenigstens fast alles. Sanne blickte auf ihre Plastik-Armbanduhr und stellte fest, dass ihr bis zu dem Treffen mit Ronny beinahe zwei volle Stunden Zeit blieben. Gemächlich wanderte sie über die Hofbauernstraße und den Bergweg von Bayerisch Gmain nach Bad Reichenhall hinein, bummelte durch die Straßen im Zentrum, vorbei an Geschäften mit teuren Dirndln, Wanderstöcken, Bierkrügen, Postkarten und allem, was die Herzen der Touristen begehrten. Und Touris gab es hier massenhaft, mindestens so viele wie die berühmten Tauben am Markusplatz von Venedig. Jetzt im Frühsommer, wo die Wandersaison in den bayrischen Bergen begonnen hatte und auch die letzten Hütten für den Sommerbetrieb öffneten, fielen sie in Scharen im Voralpenland ein. Die Predigtstuhlbahn verhalf sogar den faulsten Säcken zum Eins-a-Bergerlebnis, so dass die Typen ihre Ärsche nicht einmal bewegen mussten.
Sanne fand die Touris mit ihren Sonnenhüten und den umgehängten Fotoapparaten lächerlich. Trotzdem hatte sie bereits vor Jahren erkannt, dass die Touristenschwemme gewisse Vorteile bot: Vor allem am Gedränge in den Läden von Bad Reichenhall erfreute sich Sanne, denn es erleichterte manches.
Hinter einer vergnügt lärmenden Gruppe junger Amerikaner betrat Sanne die Confiserie Candyplanet in der Fußgängerzone. Während die Übersee-Touris angesichts der Vielzahl hausgemachter Pralinen in bewundernde „Fantastic! Marvelous!“- und „Look here!“-Rufe ausbrachen und die Verkäuferinnen im Akkordtempo Dutzende Zellophantütchen mit den Köstlichkeiten befüllten, schob Sanne unbemerkt drei Tafeln Schokolade unter ihre dünne Jacke. In überfüllten Tante-Emma-Läden funktionierte so was besser als in den Supermärkten, in denen an den Waren dämliche elektronische Sicherungen befestigt waren und gemietete Ladendetektive kontrollierten. Erfahrene Langfinger wussten das. Ohne Hast wartete Sanne, bis sich die eine Hälfte der Amerikaner mit ihren Tüten um die Kasse drängelte und das ungewohnte Eurogeld abzählte, während der Rest der Gruppe die Kameras wie Waffen schwenkte und den Raum in eine Blitzlichtgewitterzelle verwandelte. Erst dann verließ sie das Geschäft, so unauffällig, wie sie es betreten hatte. Eigentlich hatte sie gar nicht beabsichtigt, die Schokolade zu „besorgen“; die Süßigkeitenvorräte, die sie in ihrem Privatversteck hortete, würden locker für die nächsten paar Tage reichen. Aber man konnte nie wissen, und überhaupt wäre es frevelhaft, eine derart günstige Gelegenheit ungenutzt verstreichen zu lassen.
„Glaubst, dir gehört die Straß’n allein?“ Die Bubenstimme ließ Sanne automatisch zur Seite treten. Der Junge, der auf dem Gehweg angeradelt kam, mochte zwölf oder dreizehn Jahre alt sein und zeigte ihr den Stinkefinger. „Bist besoffen, Pennerin, oder was?“
Im nächsten Moment sprang Sanne vor und trat so kräftig gegen die vordere Rahmenstange seines Rads, dass er das Gleichgewicht verlor und auf den Asphalt stürzte. Als er sich hochrappelte, starrte er abwechselnd auf seinen heftig blutenden Unterarm und auf Sanne, die seinen entsetzten Blick ungerührt zurückgab.
„Lass dich morgen von der Mama zum Kindergarten bringen! Zum Allein-Radeln bist noch zu doof.“ Mit voller Absicht knallte sie ihren Absatz auf sein bis dahin noch intaktes Vorderlicht und verschwand in einer Seitengasse.
Kaum fünf Minuten später verfluchte sie sich dafür, dass sie ihr Temperament nicht besser im Griff hatte. Was, wenn der junge Depp seinen Eltern erzählte, wie sie ihm das Rad ruiniert hatte? Das wahrhaft Letzte, was sie im Moment brauchen konnte, wären die Bullen im Nacken.
Eine halbe Stunde später hockte Sanne auf einer Bank in dem schattigen Rondell vor der Saalachbrücke und knabberte an einer Tafel Luxus-Pistazienschokolade, obwohl sie nicht hungrig war. Ronny entdeckte sie schon aus der Ferne, tat aber, als habe sie ihn nicht bemerkt. Das Ego dieses Sauhunds war ohnedies aufgeblasen genug. Und wenn Sanne irgendeine andere Möglichkeit gehabt hätte, an den Krempel zu kommen, hätte sie Ronny mit Freuden links liegen gelassen. Aber dummerweise war sie erstens obdachlos und hatte infolgedessen zweitens keinen privaten Zugang zum Internet.
„Hast du die Kohle?“ Einen Gruß hielt Ronny für überflüssig.
„Und du? Hast du die Ware?“ Betont unbeeindruckt kaute Sanne weiter.
„Logo.“ Er warf ihr die Plastiktüte, in der zwei flache Schachteln steckten, zu. „Willst du’s dir erst anschauen?“
Sanne schüttelte den Kopf. Sorgfältig verstaute sie die Schokolade in der Jackentasche und holte ihr Geld heraus.
„Wissen möcht ich ja schon, wozu du den Kram brauchst.“ Grinsend steckte Ronny das Geld ein. „Willst du ’ne neue Karriere als Domina starten?“
„Wenn du dich als Übungsobjekt zur Verfügung stellst, denk ich drüber nach.“ Sanne stand auf. Ronny packte ihr Handgelenk.
„Hab ich Recht mit der Vermutung, dass du was planst, das nicht sämtliche Glocken vom Kirchturm läuten sollen?“
„Wüsste nicht, was ausgerechnet dich Arsch meine Pläne angehen!“, schnappte Sanne.
„Schweigen ist teuer.“
„Ich hab den ausgemachten Preis bezahlt und mehr gibt’s nicht.“ In Sannes Augen funkelte es gefährlich. Ronny grinste.
„Den Preis für die Ware, ja. Versiegelte Lippen kosten extra.“
„Vergiss es!“, fauchte Sanne, doch sie steckte ihre Börse nicht ein. Sie durfte nicht zulassen, dass der Scheißkerl möglicherweise plauderte, bloß aus Wut oder Rache. Auf keinen Fall! Sie starrten einander an, Ronny siegesgewiss, Sanne vor Zorn glühend.
„Ich warte“, sagte Ronny.
„Glaubst du, ich bin ’n Ölscheich? Ich hab keine Kohle mehr“, log Sanne.
„Umso besser.“ Ronny zog sie ruckartig ein Stück näher an sich heran. „Ich will sowieso kein Geld. Sondern … Naturalien, gewissermaßen …“ Und seine zweite, freie Hand fasste frech nach Sannes Hintern.
„Hau ab! Arschloch!“ Sanne riss sich los, brüllte ihm ins Gesicht, ohne Rücksicht auf zwei Passanten, die entsetzt herübersahen und schnell weitergingen. „Verpiss dich oder ich kratz dir die Augen aus!“ Die Finger der Linken zu Krallen gekrümmt, zog sie ihm die Hand über die Wange, bis er aufschrie.
Kochend vor Wut drehte sie sich um und marschierte fort, ohne ihren blutenden Geschäftspartner auch nur eines einzigen weiteren Blickes zu würdigen. Und so entging ihr die obszöne Geste, die Ronny hinter ihrem Rücken machte. Ebenso wie sein gieriger und zugleich hasserfüllter Blick, sowie sein zwischen zusammengepressten Lippen hervorgestoßener Schwur: „Du kommst mir nicht aus, Mädel! Eines Tages wirst du bezahlen, das garantier ich dir!“
Liebe Julia, schrieb Mira, kannst du verstehen, dass ich mich überhaupt nicht auf die zwei Wochen Urlaub freue? Wahrscheinlich bin ich nicht normal. Alle meine Bekannten meinen, ich hätte das große Los gezogen. Wellness-Hotel Parisia, meine Friseurin konnte es kaum glauben! Fünf Sterne, französischer Gourmet-Koch, eine Spa-Landschaft von der gefühlten Größe des Mittelmeers – und das alles mit einer Kreditkarte, die einen Freibrief für jede Anwendung bietet, die ich mir gönnen will. Niemand würde mir glauben, dass ich ein einfaches Quartier vorziehen würde.
Ich hab die Friseurin – Elke heißt sie und wird so Mitte zwanzig sein – gefragt, wo sie ihren nächsten Urlaub verbringen wird. In Lignano, sagte sie, am Meer. Zusammen mit ihrem Freund. Auf einem Campingplatz mit einer fetzigen Disco. Fetzig, so hat sie sich ausgedrückt, obwohl ich vermute, dass das Adjektiv besser auf die in dem Etablissement gespielte Musik passen würde. Sie beneidet mich, hat sie behauptet, aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich hab ihre Augen nur im Spiegel gesehen, aber ich hatte den Eindruck, dass sie glücklich war, als sie von Lignano erzählte. Sie muss schon vier oder fünf Mal dort gewesen sein. Sie weiß genau, in welche Pizzeria sie am ersten Abend gehen möchte, welches Antimückenmittel am besten gegen die winzigen italienischen Mücken hilft, und dass sie auch wieder den Zoo in der Nähe der Stadt besuchen will. Es klang alles, als wäre sie sicher, dass sie eine tolle Zeit erleben wird.
Gestern habe ich im Café zufällig zwei fremde Frauen über ihre Urlaubspläne reden hören. Ich hab so getan, als würde ich lesen, aber mein Buch war keine spannende Geschichte, sondern eine Lovestory mit einer ziemlich vorhersehbaren Handlung. Also habe ich lieber gelauscht, obwohl der Anstand das Lauschen verbietet.
Die erste Frau wollte mit ihren Kindern Ferien auf dem Bauernhof machen, im Allgäu. Naja, etwas Derartiges käme bei meinen Allergien sowieso nicht in Frage, das ist klar. Aber es hörte sich irgendwie reizvoll an. Gemütlich. Die andere hat erzählt, dass ihr Mann unbedingt nach Schweden wolle. Ihr sei das Land eigentlich zu kalt, aber im Süden wären sie im letzten Sommer gewesen, also würde sie ihrem Mann zuliebe in den Norden fahren.
„Schweden …“ Die Stimme der Frau wurde leiser, Julia, während die Bilder in meinem Inneren immer deutlicher wurden. Bilder, wie ich sie aus Filmen und Büchern kenne: Rote Häuschen in grüner Landschaft. Schneebedeckte Berge, die sich in stillen Seen spiegeln. Lange Küsten und felsige kleine Inseln. Elche, die gemächlich einsame Straßen überqueren. Rentiere, die in riesigen Herden weiden, von samischen Hirten bewacht. Schweden muss schön sein, so schön!
Aber Gerhard will nicht nach Schweden. Weil dort keins seiner Lieblings-Golfreviere liegt. Und er infolgedessen keinen seiner Golf-Kumpel dort treffen kann.
Dabei sehne ich mich danach, einfach in die Natur zu fahren! Am liebsten Hunderte von Kilometern weit weg. Nach Schweden oder nach Norwegen, zum Beispiel. Oder gar bis in die Sahara. Ich hab neulich einen Film gesehen, über die perfekt angepassten Tiere, die in der Wüste leben. Füchse mit langen Ohren, die man Fenneks nennt, etwa. Solche möchte ich gern mal sehen.
Aber natürlich wäre ich auch mit Lignano hochzufrieden. Ich stelle es mir hübsch vor, an einem Strand entlangzulaufen und Muscheln zu suchen. Das würde mir reichen, Muscheln zu sammeln, tagelang. Weiße Muscheln, rosafarbene, graue. Schwimmen? Ich weiß nicht, vielleicht ist mir das im Meer zu gefährlich, wegen der Haie und Feuerquallen und so. Aber andrerseits, alle Leute gehen an der Adria schwimmen. Wahrscheinlich bin ich zu schwarzseherisch und ängstlich. Dr. Lutz meint, das könne mit meiner Depression zusammenhängen, aber davon habe ich dir schon oft genug erzählt.
Fast jede Frau aus meiner Bekanntschaft macht tolle Urlaube, solche, auf die sie sich freut, und von denen sie hinterher ewig erzählt. Nur ich weiß nie, was ich erzählen soll. Je mehr wir in diese Wellness-Hotels fahren, umso ähnlicher kommen sie mir alle vor. Und langweiliger. Warum ist das so, dass ich nie woanders hinkomme, dahin, wo ich wirklich hinfahren möchte? Weshalb darf ich nie frei und beschwingt durch die Meeresbrandung laufen, nie den nassen Sand eines Strandes unter meinen Füßen spüren? Das Geld dafür hätte Gerhard doch. Ich weiß, ich sollte mich nicht beklagen, andere Frauen haben keine Möglichkeit, mal aus ihrem Alltagstrott zu kommen. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das alles sein soll, was das Leben mir bieten kann, jetzt und in alle Ewigkeit: Spaziergänge und Kosmetikerinnen. Tee mit der Schwiegermutter und ihrer Kartenspiel-Clique. Angst vor den Tagen, Angst vor den Nächten. Und Träume. Solche, die nie in Erfüllung gehen. Es muss mehr geben, auch für mich, aber wie soll ich es finden?
Ich wünschte, du wüsstest eine Antwort, Julia. Aber ich fürchte, dass du mir nicht helfen kannst. Trotzdem. Wenigstens darf ich mit dir über alles reden, ohne dass du lachst.
Alles Liebe
Mira
„Spiel was von Bach“, sagte Gerhard vom Sofa her. Mira hasste Bach. Viele mochten ihn für einen großartigen Musiker halten, aber sie bevorzugte Vivaldi und Chopin. Doch sie sagte nichts, sondern setzte sich gehorsam an den weißen Flügel, eins der teuersten Geschenke, die Gerhard ihr jemals gemacht hatte.
„Meine Schwiegertochter weiß gar nicht, was sie an Gerhard hat“, erzählte Gertrude Oltmann regelmäßig bei ihren Donnerstags-Teestunden. Und Mira senkte dann den Kopf, weil die ganzen alten Frauen sie missbilligend anstarrten und die Köpfe mit den perfekten Dauerwellen schüttelten. „Mein Sohn trägt sie auf Händen“, sagte Gertrude, „manchmal kann ich gar nicht mit ansehen, wie er sie verwöhnt.“
„Nicht so schnell“, mahnte Gerhard. „Bach muss man zelebrieren, nicht durchhetzen.“
„Entschuldige“, murmelte Mira. Bestimmt hatte Gerhard Recht. Sie neigte dazu, Bach zu flott zu spielen, um den Flügel rascher schließen zu können. „Gerhard hat das absolute Gehör und ein Gespür für Rhythmen wie kein zweiter.“ Auch einer von Gertrudes Sprüchen. ‚Warum kann er nicht selbst spielen‘, fragte sich Mira insgeheim. ‚Wenn er angeblich früher so perfekt am Klavier war?‘
„Dir zuzuhören ist entspannend. Zumindest, solange du die Tempi einhältst.“ Es war das größte Lob, das sie von Gerhard erhoffen durfte.
‚Warum hören die Leute zu, wenn ich spiele, aber niemand hört, wenn ich weine?‘, fragte sich Mira, doch wie so vieles sprach sie es nicht aus. Gesprochene Worte beschworen nur Konflikte herauf, und Mira mochte keine Konflikte. Sie machten sie nervös. Erneut legte sie die Finger auf die Tasten und konzentrierte sich auf Bach.
Später stand sie am Fenster und strich über die samtigen Blätter ihrer geliebten Alpenveilchen auf dem Blumentisch. Gerhard war vor dem Fernseher eingeschlafen, und Mira hatte das Gerät vorsichtig leiser gestellt, um ihn nicht zu wecken. Vielleicht, mit viel Glück, würde es ein friedlicher Abend werden.
Sanne liebte den Juni. Weil er der Monat war, in dem sich die Tage am längsten dehnten und der gesamte Sommer wie das Versprechen künftiger Freuden vor ihr lag: Baden im Thumsee, Wandern im Naturpark Untersberg oder Klettern am Watzmann-Massiv. ‚Endlose Stunden auf einer grünen Alm liegen und Mond und Sterne aufgehen sehen … Sommer ist megaklasse‘, dachte sie, während sie aus der Stadt wanderte und einen der wenigen Pfade einschlug, der von den Touri-Schwärmen verschont blieb, weil er nicht markiert war. Im Gegensatz zu den dämlichen Touris fand sich Sanne auch ohne Farbkleckse, Wanderroutennummern, Magnetkompass oder piepsenden GPS-Kästchen in den Bergen zurecht – sie verlief sich nie. Wahrscheinlich hatte sie den ausgezeichneten Orientierungssinn ihres Vaters geerbt, der angeblich, also seinen eigenen Worten nach, früher ein begehrter Bergführer gewesen war. Früher. Vor dem Unfall. Vor dem Absturz an der Südspitze-Ostwand des Watzmanns, der ihn das rechte Bein gekostet hatte. Seither ging der Vater nicht mehr in die Berge, hockte tagaus, tagein in der unaufgeräumten Wohnung, in der sich das dreckige Geschirr in der Küche auf dem Fußboden stapelte, und soff. Oder er beschimpfte seine Tochter, wenn sie ihn, was selten genug vorkam, besuchte. Früher, in ihrer Kindheit, hatte er sie gelegentlich geprügelt, bis sie mit dreizehn Jahren endgültig abgehauen und schließlich im Heim gelandet war.
Gemächlich stieg Sanne zu der Schutzhütte oberhalb der Stadt hinauf und dachte dabei an die blonde Tussi, die sie vor dem Kosmetiksalon beobachtet hatte. ‚Mira Oltmann, High Snobiety. Beruf: Ehefrau. Hobby: Geldrauswerfen. Wie viele Kreditkarten die wohl im Handtäschchen mit sich schleppte? Die kaufte bestimmt jeden Scheiß, den man in der Werbung sehen konnte. Oder nein, der Kram war ihr wahrscheinlich nicht edel genug.‘ Sanne versuchte sich vorzustellen, wie Mira Oltmann in der teuersten Boutique der Stadt Kleider anprobierte, und zwischendurch die verschiedensten Erfrischungen angeboten bekam, bis hin zum Gläschen Sekt, damit die Schwerstarbeit des An- und Ausziehens ihre zarte Konstitution nicht überforderte. Verächtlich kräuselte Sanne die Lippen. Die Oltmann war genau die Sorte Zicke, die Sanne hasste. Und Hass war die einzige Disziplin, in der Sanne absolute Perfektion erreichte. Weil sie im Hassen Übung hatte, tonnenweise Übung.
Als Sanne die Schutzhütte erreichte, ließ sie ihren Rucksack von den Schultern gleiten. Ein teurer Marken-Backpack, aber der Typ, dem das Ding ursprünglich gehört hatte, verdiente mit Sicherheit genug Kohle, sich Ersatz zu beschaffen. Hoch über dem Saalachsee war er rumgeklettert, am Waxries, die Angeber-Videokamera in der Hand und total high von dem Bergpanorama ringsum. Immer weiter hatte er sich von seinem Backpack entfernt, auf der gierigen Suche nach dem nächsten, dem ultimativen Motiv. Sanne war ganz cool hinspaziert, hatte sich den Rucksack mit dem darüber geschnallten Schlafsack aufgeladen und war mit ihrer Beute über die Berg-Rückseite abgestiegen, Richtung Rötelbach-Alm. Nicht einmal besonders schnell.
Seither besaß sie nicht bloß einen wunderbar warmen Daunenschlafsack und einen stabilen, wetterfesten Rucksack, sondern zudem eine ganze Latte weiterer nützlicher Dinge, die sie im Innern des Backpacks gefunden hatte: eine zu große Regenjacke etwa, und einen wunderbar warmen, grauen Kaschmir-Herrenpullover, dessen Ärmel so lang waren, dass Sanne selbst im frostigsten Winter oft keine Handschuhe brauchte, wenn sie ihn trug. Zudem ein klappbares, überraschend leistungsstarkes Fernglas, einen Höhenmesser, ein Erste-Hilfe-Set und ein Schweizer Taschenmesser mit einundzwanzig Funktionen. Säge, Feile, Dosenöffner, Minischere zum Nägelschneiden – Sanne hütete das Ding wie einen Schatz. Wann immer sie in die Stadt hinabstieg, verbarg sie Schlafsack und Rucksack in einer niedrigen Höhle unter einem Felsen, deren ohnehin im Gestrüpp kaum sichtbaren Eingang sie sorgfältig mit Ästen tarnte. Denn im Gegensatz zu dem bescheuerten Touri, der ihr den Backpack unfreiwillig vererbt hatte, achtete Sanne auf ihre Sachen.
An diesem Abend breitete sie den Schlafsack vor der Schutzhütte aus; wann immer das Wetter es erlaubte, schlief sie lieber unter dem samtenen Himmel als in jedem Gebäude. Im lichten Bergwald schimmerten einzelne Sterne durch die Bäume. Erst hier, fernab der Stadt, fernab der Menschen, löste sich die Spannung in Sannes Körper und sie bemerkte, wie sich ihre den Tag über verkrampften Muskeln lockerten. In der Stadt hieß es ständig wachsam sein, aufpassen. Achtgeben, dass man den Bullen nicht unangenehm auffiel, achtgeben, wenn man Ronny und dessen dämliche Kumpel traf, achtgeben, dass man nicht selbst beklaut wurde. Sie musste achtsam sein wie ein gejagtes Tier. In den Bergen dagegen … Sanne lächelte den Sternen zu und dachte bei sich, dass sogar das Lächeln in der Stadt anders war. Härter. Kälter. Wenn die Leute denn überhaupt lächelten. Meistens hetzten sie nur von einem bescheuerten Termin zum nächsten: Friseur, Business-Konferenz, Grippeimpfung, Geschäftsessen, Autoinspektion, Fortbildungskurs. Und plötzlich Herztod und Friedhof. Sollte das das Leben sein? Da wusste Sanne Besseres mit ihrer Zeit anzufangen. Zeitgleich mit der Dunkelheit breitete sich der nächtliche Friede des Waldes über sie und als Sanne endlich einschlief, verharrte ein Rest des Lächelns auf ihrem Gesicht.
Mira fragte sich, warum sie überhaupt ein Geschenk kaufen musste. Gerhard würde seiner Mutter ohnehin wieder eine Perlenkette, einen Smaragdanhänger oder sonst etwas Teures mitbringen. Aber Gertrude erwartete an ihrem Geburtstag immer zusätzlich eine „Kleinigkeit“ von ihrer Schwiegertochter, wenn auch nur, um hinterher daran herumkritteln zu können. Letztes Jahr hatte Mira ihr ein Buch geschenkt, einen Roman, der Mira ausgezeichnet gefallen hatte. Er handelte von drei Freundinnen, die gemeinsam zu einem Töpferkurs in die Provence aufbrachen. Mira hatte das Buch vor allem wegen der unverbrüchlichen Freundschaft der drei Protagonistinnen geliebt, die auch die diversen im Buch erscheinenden Männer letztendlich nicht zerstören konnten. Doch ein halbes Jahr später stand das Buch nach wie vor ungelesen in Gertrudes oberem Flur, als ständige Anklage an die Schwiegertochter, die das absolut falsche Geschenk ausgesucht hatte.
Ob sie diesmal einfach einen üppigen Blumenstrauß besorgen sollte? Mira blieb vor dem Laden ihres Lieblingsfloristen stehen. Oder wie wäre es mit einer Orchidee? Die blaue etwa, die sie durch das Fenster sehen konnte, war einfach zauberhaft. Aber Gertrude und Orchideen? Mit einem Anflug von Humor dachte Mira, dass sie das der zarten Pflanze nicht antun durfte. Die würde Gertrude tagaus, tagein ertragen müssen.
„Mira! Mira Oltmann! Wie schön, dich zu treffen!“
Langsam wandte Mira den Kopf. Sie hatte die Stimme sofort erkannt. Die Stimme von Kati Hellmeier. Kati war die Tochter von Gertrudes Busenfreundin und hatte Mira nie besondere Zuneigung entgegengebracht, was auf Gegenseitigkeit beruhte. Im Gegensatz zu Mira war Kati allerdings Single und hatte einen Beruf. Sie arbeitete für ein Tagungshotel, das diverse Firmenevents organisierte, und war in ihrer Freizeit vor allem eins: unendlich neugierig.
„Stimmt’s, dass ihr Urlaub im Parisia machen werdet?“, fragte sie gleich, um sich das neueste Gerücht bestätigen zu lassen. Dabei hängte sie sich bei Mira ein, als seien sie die allerbesten Freundinnen. „Wollen wir zusammen einen Cappuccino trinken? – Übrigens, kennst du meinen Cousin? Simon ist der neue Filialleiter von der Buchhandlung in der Rinckstraße.“ Vage wedelte sie in Richtung eines jungen Mannes, der mit ihren Einkaufstüten beladen hinter ihr her trottete.
Normalerweise hätte sich Mira mit einer Ausrede vor dem gemeinsamen Kaffeetrinken gedrückt, aber da die Alternative war, weiter nach einem Geschenk für ihre Schwiegermutter zu suchen, schüttelte sie verlegen die Hand des fremden Mannes und ließ sich von Kati zu einem der zierlichen weißlackierten Stühle vor dem Eiscafé dirigieren.
„Das Parisia muss ein Traum sein, du musst mir unbedingt erzählen, wie’s war! Angeblich gibt’s da Suiten mit eigener Sauna und allem!“ Kati war bestens informiert.
„Sauna ist nichts für mich“, hörte Mira sich sagen. „Das hält mein Kreislauf nicht aus.“
Kati brach in wie immer so lautes Lachen aus, dass die anderen Gäste irritiert herübersahen. Simon Hellmeier, ein unscheinbarer junger Mann mit großen Händen, sandte Mira einen mitfühlenden Blick.
„Sag bloß, du willst da gar nicht hin!“ Mit befehlsgewohnter Geste winkte Kati den Kellner herbei.
„Ich war noch nie in der Sahara“, sagte Mira, mehr zu sich selbst. „Und nicht einmal in Schweden.“
Kati klappte den Mund auf und gleich wieder zu. Ausnahmsweise verschlug es ihr die Sprache.
„Du würdest lieber nach Schweden als ins Parisia?“, vergewisserte sie sich endlich. „Mensch, in Schweden ist’s das ganze Jahr kalt und wenn du Pech hast, schüttet’s auch noch wie aus Badewannen. ’Ne Freundin von mir ist grade von dort zurück, die hat gesagt, sie will nie wieder nach Schweden, duschen kann sie daheim billiger. Und wärmer.“
„Ich möchte trotzdem dorthin.“ Mira hatte plötzlich die Bücher ihrer Kindheit im Kopf. Wir Kinder aus Bullerbü. Ferien auf Saltkrokan. Und natürlich Pippi Langstrumpf. Verdankte sie es Astrid Lindgren, dass sie in Schweden ein Paradies vermutete, dass es nirgendwo sonst auf der Erde gab?
„Und Sie haben Recht, hören Sie nicht auf meine Cousine.“ Simon Hellmeier bestellte einen Latte Macchiato; er hatte eine angenehm warme Stimme. „Schweden ist wundervoll. Ich verbringe fast jeden Sommer ein paar Wochen in Skandinavien. Mitternachtssonne, stille Seen … das Land ist ein Traum!“
„Wenn dir der Voucher fürs Parisia lästig ist, kannst du ihn mir jederzeit rüberwachsen lassen“, kicherte Kati. „Aber alle werden dich für verrückt halten. Hast du im Internet die Liste der Massagen gesehen, die die anbieten? Und die Bäder! Ich würd als erstes das Rosenbad buchen, oder das Kleopatra-Bad. War das nicht eins mit Eselsmilch?“
Mira schwieg und ließ die anderen reden. Stillhalten. Schweigen. Unauffällig sein. Es war die einzige Strategie, über die sie verfügte, um unangenehme Situationen zu ertragen. Auch bei ihrer Schwiegermutter. Und überhaupt. Stillhalten und schweigen, bis alles Hässliche, Angsteinflößende vorüberging. Aber es waren ärmliche Waffen, soviel wusste sie.
Erst als der Kellner die Getränke brachte, sah Mira wieder auf – und direkt in Simon Hellmeiers graue Augen, in denen sie zweierlei las: amüsierte Nachsicht gegenüber Katis losem Mundwerk und etwas, das Mira nicht definieren konnte. Oder nicht zu definieren wagte.
Kapitel 2
Sanne beobachtete aus der Ferne, wie die blondgelockte Zicke im Haus der Gesichtsrenoviererin verschwand. Nun hatte Sanne eine Stunde Zeit. Eine letzte Stunde, in der sie noch einmal überlegen konnte, ob sie den Plan wirklich durchziehen wollte. Eigentlich war alles längst entschieden. Und bis ins Detail vorbereitet. Sanne rief sich die dunkelsten Stunden ihres Lebens in Erinnerung, die Todesangst im letzten Winter, und ihr Hass loderte auf wie ein heiliges Feuer, dessen gierige Flammenzungen nach einem Opfer schrien. Nach Vergeltung. Rache. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Blut um Blut. Stand das nicht sogar in der Bibel?
Warm brannte die Sonne vom Himmel. Sannes Jacke war zu dick für den Tag. Nachdenklich sah Sanne sich um. Sie hatte wenig Lust, in der prallen Sonne zu warten. In dem Haus, das dem der Kosmetikerin schräg gegenüber lag, dem einzigen anderen Gebäude in dieser Einöde, waren die grünen Jalousien herabgelassen, Restmüll- und Papiertonne standen in der Einfahrt, obwohl die Abfuhr erst in der nächsten Woche kommen würde. Alles sichere Zeichen dafür, dass die Bewohner in die Pfingstferien aufgebrochen waren. Eine kurze Weile noch blieb Sanne sitzen und beobachtete die stille Straße, ehe sie flink über das niedrige Tor in den Garten des verlassenen Hauses kletterte.
Drinnen, unter halbhohen Apfelbäumen mit vollem Laub, war es schattig und kühl. Sanne legte sich ins Gras und beobachtete die Ameisen, die die Hitze nicht zu spüren schienen und einem nur für sie sichtbaren Pfad folgten. Nach einer Viertelstunde jedoch wurde ihr das Liegen langweilig – oder war sie vielleicht nervös? Jedenfalls stand sie auf und begann, ihre Umgebung genauer zu untersuchen. Der hölzerne Gartenpavillon hinter dem Haus war nicht abgesperrt. Sanne trat hinein und zog die Tür vorsichtig hinter sich zu. Offenbar gehörte das Haus einer Familie mit kleinen Kindern:
Ein Trettraktor mit schmutzigen Rädern ruhte sich im Dämmerlicht aus, an einem Nagel hing eine Dartscheibe, daneben eine Kappe mit dem aufgedruckten Logo einer Fast-Food-Kette. Am Boden ein Rasenmäher, im Eck aufgereiht Bambusstäbe, Tomatenspiralen, Spaten, Rechen und weitere Werkzeuge. Sanne entdeckte eine Rolle grünen Blumendraht, die sie in die riesige Leinentasche schob, die sie über der Schulter trug. Nach kurzem Nachdenken steckte sie auch die Kappe ein. Und ein paar der Dartpfeile. Die Scheibe war fast zu sperrig, doch mit einiger Mühe schaffte es Sanne, sie in die Tasche zu zwängen. Mit dem Zeug konnte man eine Menge Spaß haben und es würde ihr in den nächsten Tagen die langen Stunden bei der Almhütte verkürzen. Versuchsweise zielte Sanne mit einem der übrigen Pfeile auf eine Gießkanne und warf. Zitternd blieb die Metallspitze in dem grünen Plastik stecken. Zufrieden zog Sanne den Pfeil heraus und versenkte ihn ebenfalls in der Tasche.
Sie verließ die Gartenhütte und wanderte weiter um das Haus, zu der mit grauweißem Marmor belegten Terrasse, die eine Vielzahl Blumenkübel mit mediterranen Pflanzen zierte: Zitronenbäumchen, Bougainvillea, Rosmarin, Lavendel, Thymian. Sanne kannte die Namen der Pflanzen, seit sie vor zwei Jahren aushilfsweise im örtlichen Gartencenter gearbeitet hatte. Es war einer der wenigen Jobs gewesen, an denen sie Spaß gefunden hatte, obwohl sie fast nichts verdient und der knurrige Chefgärtner kaum drei Worte pro Tag an sie gerichtet hatte. Fast liebevoll zupfte Sanne ein paar verwelkte Blüten von der Bougainvillea und warf sie unter die Ligusterhecke. Wer Blumenkübel auf der Terrasse stehen lässt, wenn er in Urlaub fährt, beauftragt normalerweise jemanden, gelegentlich vorbeizuschauen und die Pflanzen zu gießen, fiel ihr dabei ein. Putzfrau, Freund, Arbeitskollege, irgendwen halt. Sanne richtete sich auf und fasste unter die Fußmatte vor der Terrassentür: nichts. Nachdenklich schob sie die Unterlippe vor und blickte sich um. Rattan-Stühle, zwei Liegen ohne Auflagen, in einem leeren Kübel ein paar grüne Handschuhe aus robustem Baumwollstoff. Sanne fühlte in die Handschuhe und hätte fast gelacht: natürlich! Die Hausschlüssel. Leider hatte sie nicht genug Zeit, in das Haus hineinzugehen und die einzelnen Zimmer nach Wertsachen zu durchstöbern, aber vielleicht war das besser so. Wegen ein paar verschwundener Dartpfeile würde niemand die Polizei einschalten. Wegen Einbruchs schon.
Trotzdem verspürte Sanne den Wunsch, den Hausbesitzern wenigstens zu zeigen, wie idiotisch sie ihr Versteck gewählt hatten. Die Schlüssel in der Hand ging sie zu dem hübschen, mit Miniaturbambus eingefassten Teich, aus dem ihr drei fette Goldfische erwartungsvoll entgegenblickten. Ein Lächeln umspielte Sannes Lippen, als sie den Arm ausstreckte und die Schlüssel in das trübe Wasser plumpsen ließ.
„Jetzt seid ihr zu Gralshütern geworden“, erklärte sie den enttäuschten Fischen, die gewiss auf Futter gehofft hatten. Zehn Minuten später saß sie wieder auf dem Gehsteig der stillen Straße und wartete.
„Schönen Urlaub, Frau Oltmann“, rief die Kosmetikerin hinter der letzten Kundin des Tages her, aber Mira gab vor, nicht zu hören.
‚Von wegen schöner Urlaub‘, hätte sie am liebsten zurückgeschrien. ‚Nicht schön für mich, jedenfalls. Gerhard wird von morgens bis nachmittags Golf spielen, und abends darf ich mir haarklein anhören, wie sich jeder einzelne Ball bei jedem einzelnen Abschlag verhalten hat, und welcher Spieler mit welchem Handicap antritt. Zwischendurch langweile ich mich in den Schönheitsbädern oder auf der Sonnenterrasse. Und wenn ich ganz viel Pech habe, kommt sein alter Schulfreund mit dieser redseligen Frau. Gerhard wird erwarten, dass ich mich mit der dummen Gans anfreunde, die nie über etwas anderes redet als über ihre Prunkvilla am Starnberger See und die antiken Möbel darin. Ich wünschte bei Gott, die würde alle der Holzwurm fressen!‘ Mira fühlte sich so kreuzunglücklich, dass sie die fremde Frau diesmal gar nicht bemerkte. Doch plötzlich klopfte ihr jemand von hinten auf die Schulter. Erschrocken fuhr Mira herum.
Da stand sie wieder, die Fremde. Diesmal mit einem halben Lächeln auf den mit Lila bemalten Lippen. Trotzdem trat Mira vorsichtshalber einen Schritt zur Seite. Man hörte und las so viel über geschickte Trickdiebe, die einen anrempelten oder ansprachen und einem nebenbei die Geldbörse stahlen. Gerade jetzt, in der Urlaubszeit, trieben sich solche Typen wieder verstärkt in der Gegend herum. Vielleicht war die Fremde auch eine Diebin? Mira senkte den Kopf und wollte stumm weitergehen, doch die fremde Frau verstellte ihr den Weg.
„Tag, Frau Oltmann“, sagte sie munter.
‚Woher weiß sie meinen Namen?‘, fragte sich Mira. Ich kenne sie nicht. ‚Oder hab ich sie vielleicht früher mal getroffen, als sie ganz anders aussah?‘
„Haben Sie ’nen Augenblick Zeit? Bloß kurz?“ Katzengrüne, leicht schräg stehende Augen zeigten sich, als die Fremde die Sonnenbrille abnahm und in ihr Haar steckte. Mira hatte sich immer solche Augen gewünscht. Ihre eigenen waren langweilig grau. Wie Beton, der jede Menge Geheimnisse unter sich begrub, gute und schlechte, für immer und ewig.
Mira schwieg weiter, unsicher, wie sie sich verhalten sollte.
„Ach so, ich hab nicht mal gesagt, wie ich heiße. Ich bin die Sanne. Sanne Reitler.“ Der dicke Strass-Stein in der Nase der Fremden funkelte im Licht. Er erinnerte Mira an indische Märchen, die sie gelesen hatte, an anmutige Frauen, die durch Palastgänge huschten, geschmückt für die Begegnungen mit ihren Prinzen. Fasziniert starrte Mira auf das grüne Glitzern, obwohl die fremde Frau ansonsten weder indisch noch märchenhaft wirkte.
„Was wollen Sie von mir?“ Mira hasste es, wie furchtsam ihre Stimme klang. ‚Nervös. Wie das Quaken eines Frosches, der darauf wartet, seziert zu werden‘, dachte sie.
„Ich mach da dieses Projekt. Für eine Obdachlosenzeitung. Eine Fotocollage, lauter Bilder von Mädchen und Frauen. Ich hab Sie ein paar Mal dort drüben rauskommen sehen.“ Sanne gestikulierte in Richtung von Frau Benders Haus. „Sie haben exakt die Ausstrahlung, die ich suche. Ich würd gern ein paar Fotos von Ihnen schießen.“
Ungläubig starrte Mira die Sandlerin an. Ausstrahlung? Was für ein Quatsch! Mira hatte null Ausstrahlung, hatte nie welche gehabt, das wusste sie genau. Sie, mit dieser starken Brille, die ihre Augen zu Schweinsäuglein verkleinerte, mit den dürren Beinen, dem knabenhaft mageren Körper, der kaum den Ansatz eines Busens zeigte. Und mit ihrer Schüchternheit und den dauernden Depressionen schaffte sie es auch nicht, körperliche Mängel durch Witz und Charisma auszugleichen. Machte diese Frau sich über sie lustig? Mira fühlte, wie Sanne ihren Arm packte.
„Keine Sorge! Es dauert nicht lang“, versicherte die Gepiercte. „Höchstens ein paar Minuten. So lang haben Sie doch bestimmt Zeit?“
Mira versuchte sich loszuwinden, aber Sannes Finger schlossen sich umso fester um ihren Arm. „Ich weiß nicht.“ Mira starrte auf die kräftige Hand, die sie nicht freigab. Über dem Handgelenk prangte ein Drachen-Tattoo in Schwarz und Rot. Der Drache bewegte sich mit dem Arm, als sei er lebendig. „Meine … Schwiegermutter wartet auf mich.“ ‚Warum hab ich das gesagt?‘, fragte sie sich gleich darauf und spürte saure Übelkeit vom Magen aufsteigen. ‚Das geht die Sandlerin doch nichts an, dass ich zu meiner Schwiegermutter zitiert werde. Gleich wird sie mich auslachen. Wird mich genauso wenig ernst nehmen wie sonst jemand.‘
Doch die Sandlerin lachte nicht. „Es geht ganz flott, versprochen! Da hat Ihre Schwieger bestimmt nichts dagegen. Sie helfen mir kolossal, ehrlich! Und hinterher können Sie mit einem beruhigten sozialen Gewissen abrauschen, wohin Sie wollen. Ferien machen, vielleicht, jetzt, wo das Wetter so schön ist.“ Versuchsweise zog sie Mira ein bisschen in Richtung Berge.
Gertrude hatte keine genaue Uhrzeit vorgegeben, jedenfalls konnte sich Mira an keine erinnern. „Sobald du bei der Kosmetikerin fertig bist, kommst du“, hatte die Schwiegermutter gesagt, denn Termine bei Kosmetikerinnen und Friseuren waren so ziemlich die einzigen, die Gertrude Oltmann stets respektierte. ‚Eigentlich‘, dachte Mira, ‚können ein paar Minuten kein Problem darstellen.‘ Andrerseits war sie noch immer misstrauisch. Weshalb redete die Fremde von Urlaubsfahrten? Wollte sie Mira aushorchen? Arbeitete sie für eine Bande, die in leerstehende Häuser einzubrechen plante, während die Eigentümer Ferien machten? In das Oltmann’sche Haus vielleicht? Zum Glück hatte Gerhard schon vor Jahren eine Alarmanlage installieren lassen!
„Wie läuft das genau mit Ihrem Projekt?“
Sanne Reitler grinste. „Im Moment arbeite ich bloß aushilfsweise für die Zeitung. Aber wenn der Chefin das mit der Fotocollage gefällt, krieg ich vielleicht 'ne feste Anstellung.“
„Und wie heißt diese Zeitung?“
„… Kunst und Straße.“ Irrte sich Mira oder hatte die Sandlerin vor der Antwort ein klein wenig gezögert?
Sie fragte nicht weiter und ließ sich von der Fremden mitziehen, die sich bei ihr einhakte, als wären sie beste Freundinnen. Ein ungewohntes Gefühl für Mira, die keine Freundin mehr hatte, seit Chrissy vor sieben Jahren nach Hamburg gezogen war. Wie schön wäre es, wieder eine Freundin zu haben, eine, mit der man spazieren gehen könnte, eine, die einen wiederaufrichten würde, wenn die Schwiegermutter einen ihrer besonders grässlichen Tage gehabt hätte … Als sie die letzten Häuser hinter sich gelassen hatten, erkundigte sich Mira zaghaft: „Wo wollen Sie denn die Aufnahmen machen?“
Mit dem Kopf wies die Fremde in Richtung Dreisesselberg.
„Ich bin … nicht besonders gesund“, murmelte Mira. „Ich kann nicht bergsteigen.“
„Wollen wir gar nicht“, versicherte Sanne. „Wir gehen nur ein kurzes Stück den Wanderweg entlang. Das Projekt heißt Frauen und Mädchen in der Natur. Deshalb müssen wir aus dem Ort.“
Mira nickte und zum ersten Mal fiel ihr auf, wie selten sie, obwohl sie am Fuß der Alpen wohnte, Ausflüge ins Gebirge unternahm. Gerhard interessierte sich nicht für die Berge, und wenn er, was selten genug vorkam, doch mal auf einen Gipfel wollte, bestand Gertrude stets darauf mitzukommen. Und natürlich nahmen sie, Miras schlechter Kondition wegen, immer die Seilbahn.
Glücklicherweise war der Weg, den Sanne einschlug, zumindest hier am Anfang nicht steil. Außerdem hatte die Sandlerin ihren Schritt verlangsamt, als Mira ihre Gesundheitsprobleme erwähnte.
„Fotografieren Sie gern?“, fragte Mira nach einer Weile, in der Hauptsache, um das Schweigen zu brechen. Außerdem fragte sie sich, ob die arme Frau sich eine Kamera leisten konnte oder ob sie sich den Apparat geliehen hatte. In Miras Welt wusste man wenig über Obdachlosigkeit, und nach Gerhards Ansicht waren alle Sandler selbst schuld an ihrem Schicksal. Er war überzeugt, sie würden leicht Arbeit finden, wenn sie ernsthaft welche suchten. Mira hoffte, Sanne Reitler würde mehr über das geplante Projekt erzählen.
„Benutzen Sie eine digitale Kamera?“
Die Gepiercte schüttelte den Kopf. „Glaubst du, ich hab einen Geldscheißer?“ Ihr Ton klang plötzlich anders, gar nicht mehr nett. Erschrocken schwieg Mira. Hatte sie die Sandlerin gekränkt? War Sanne Reitler ihre Armut peinlich? War Mira, wie es ihr so oft bei Gertrude und deren Freundinnen passierte, in ein Fettnäpfchen gestolpert, das sie nicht erkannt hatte? Allmählich begann der Weg anzusteigen und nach einer Weile, vielleicht aber einfach, weil sie wieder nervös wurde, spürte Mira leichte Atemnot. Oder ging Sanne jetzt rascher? Mira warf einen verstohlenen Blick auf ihre Armbanduhr und erschrak. Waren sie tatsächlich schon eine halbe Stunde unterwegs?
„Tut mir leid, Frau Reitler.“ Wieder quakte ihre Stimme, wie ein Frosch, fand Mira und hasste sich dafür. „Ich kann nicht weitergehen. Meine Schwiegermutter nimmt es sehr persönlich, wenn man sie warten lässt, und überhaupt … Können Sie Ihre Fotos nicht hier machen?“
Sanne blieb stehen und Mira auch, sie war bemüht, zu Atem zu kommen.
„Es gibt keine Fotos“, sagte Sanne langsam, ohne Mira aus den Augen zu lassen. „Überhaupt keine. Weder hier noch sonst wo. Und deine Schwiegermutter, fürchte ich, wird noch eine verdammt lange Weile auf ihr geliebtes Schwiegertöchterchen warten müssen!“
Mira stand stocksteif. Es war, als würde die Angst vom Boden aufsteigen, über ihre weichen Knie hoch in den Magen kriechen, in dem sich ein eisiger Klumpen bildete, und schließlich weiter zu ihrem Herzen hinaufwandern, das plötzlich heftiger schlug. Mira spürte, wie ihre Hände zitterten. Sie wünschte, sie hätte an diesem Morgen nicht vergessen, ihr Beruhigungsmittel zu nehmen. Ob sie ein paar Tabletten dabei hatte? Während sie vergebens in der Handtasche kramte, entging ihr nicht, wie Sanne Reitler sie beobachtete. Jetzt zeigte sich kein Lächeln mehr im Gesicht der fremden Frau. Ihre grünen Augen blickten hart und kalt. In Miras Kopf drehte sich alles. Was wollte die Fremde? Mira ausrauben? Vielleicht wäre es besser, ihr das Portemonnaie sofort zu geben, mit allem Geld, das Mira dabeihatte? Es war allerdings nicht viel, denn weder bei der Kosmetikerin, für deren Dienste Mira ein Abonnement besaß, noch bei der Schwiegermutter brauchte Mira Geld. Außerdem fürchtete sie immer, bestohlen zu werden, und nahm überhaupt selten viel Geld mit in die Stadt, obwohl Gerhard als Inhaber eines Juwelierladens in der Fußgängerzone reich war. Wirklich reich.
Mira fürchtete, dass ihre Stimme komplett versagen würde, wenn sie versuchen würde, der Fremden ihre paar Scheine anzubieten. Sollte sie stattdessen einfach umkehren, wortlos fortmarschieren? Würde die Sandlerin sie gehen lassen? Wie immer fiel es Mira schwer, eine Entscheidung zu treffen.
„Dreh dich um!“, befahl die Fremde plötzlich. Mira zögerte. War es am besten wegzurennen, den Berg hinunter? Die Sandlerin sah ziemlich durchtrainiert aus. Sie wäre bestimmt schneller.
„Wird’s bald?“ Auf einmal zeigte die schmale, lange Klinge eines Springmessers auf Miras Brust, und Mira fuhr entsetzt zurück.
„Umdrehen, hab ich gesagt!“, fauchte Sanne. „Hast du’s auf den Ohren, oder wie?!“ Miras Herz hämmerte ein irres Stakkato, schneller als sie es auf dem Klavier hätte spielen können. Sie begriff gar nichts, gehorchte verwirrt. Im nächsten Augenblick spürte Mira, wie Sanne hinter sie trat, und plötzlich verschloss süßlich schmeckendes Paketklebeband Miras Lippen. In Panik versuchte Mira das Band herunterzureißen, doch da schlug Sanne zu, mitten auf Miras Rücken. Mira stürzte, fiel auf den Weg. Fichtennadeln stachen in ihre Knie und Arme. Schläge prasselten auf sie ein, hart und schmerzhaft. Sie konnte nicht schreien, nicht um Hilfe rufen, weil das Klebeband ihren Mund versiegelte und sie durch die Nase kaum genug Luft bekam.
Als Sanne von ihr abgelassen hatte, kam Mira nur mit Mühe auf die Beine. Rücksichtslos zerrte Sanne ihr Opfer am Arm vorwärts, einen verwilderten, seitlich vom Weg abzweigenden Pfad entlang, der kaum als solcher erkennbar war. Zweige, die Sanne grob beiseite drückte, schnellten hinter ihr zurück, peitschten gegen Miras Stirn, gegen ihre Wangen und Schultern, während Mira vergeblich auszuweichen versuchte.
Eine halbe Stunde später hockte Mira, mit obendrein verbundenen Augen und hinter dem Rücken gefesselten Händen, völlig erschöpft irgendwo mitten im Bergwald. Sie spürte Wurzeln unter sich, hart und fest, dazu raue, kalte Steine und feuchtes Moos. Sie hörte Sanne in der Nähe rumoren, ohne zu wissen, ob sie das Messer inzwischen eingesteckt hatte. Die Angst hielt Miras Magen mit eisernem Griff umklammert, die Übelkeit wurde so schlimm, dass Mira sich am liebsten übergeben hätte. Was plante die verrückte Sandlerin mit ihr anzustellen? Wollte sie ihrem Opfer die mörderische Klinge ins Herz stoßen? Wie weh würde das tun? Wie würde das Sterben? Und was kam danach? Gab es nach dem Tod eine zweite, bessere Welt? Eine Welt, in der Mira ihre Großmutter wiedersehen würde, die Mutter ihrer Mutter, an die sie sich als eine Frau mit sanfter Stimme und einem Parfüm, das leicht zitronenartig duftete, vage erinnerte? Oder wollte Sanne ihre Gefangene gar nicht gleich töten, hatte vielmehr vor, Mira zu quälen, ihr vielleicht die Arme oder das Gesicht zu zerschneiden, sie in einem kalten Verlies hungern und dursten zu lassen? Einfach so, aus Bosheit? War Sanne Reitler eine Psychopathin, grauenhaft gemein und unendlich brutal? War sie jemand, dessen abartiges Gehirn sich an den Qualen ihrer Gefangenen weidete? Warum hatte sie sich Mira als Opfer ausgesucht? Oder hatte sie sich schlichtweg die nächstbeste junge Frau geschnappt, die das Pech gehabt hatte, ihren Weg zu kreuzen? Nein, so einfach war es nicht. Mira erinnerte sich gut daran, dass die Sandlerin sie schon seit Wochen beobachtet hatte. Wahrscheinlich ging es ihr um Geld, Kidnapping mit Erpressung also. Und bestimmt verlangte die Sandlerin wesentlich mehr als Mira bei sich trug.
‚Gab es eventuell eine Fluchtmöglichkeit?‘, fragte sich Mira. Nein, es war zu gefährlich, sie durfte nicht wagen fortzulaufen, jetzt, wo sie ihre Umgebung nicht mehr sehen konnte. Vielleicht befanden sie sich nah an einem Abgrund, hundert Meter tief oder mehr, in den Mira stürzen würde, sobald sie nur zwei falsche Schritte tat. Und weit, weit unten würden Miras Knochen brechen, und ihr Schädel würde wie eine Melone platzen, die man aus dem Fenster warf. Erst Jahre später würde ein verirrter Wanderer das verkrümmte Skelett entdecken … Das Weinen stieg in Miras Kehle, würgte sie, drohte sie zu ersticken.
„Wir warten hier, bis es dunkel wird“, sagte Sanne Reitler plötzlich und Mira fühlte sich geradezu erleichtert, als sie ihre Stimme hörte. Alles war besser als dieses Schweigen, diese Stille, in der einem die verrücktesten Gedanken durch den Kopf schossen und sich schlimmste Horrorszenen aufdrängten. Gern hätte Mira gefragt, worauf sie warteten, doch das Klebeband um den Mund erstickte die Kommunikation. Sie spürte, wie Sanne ihre Handtasche fortriss. Gleich darauf erkannte ihr durch die Musik geschultes Ohr das Geräusch, mit dem sich die Schnalle öffnete. Schaute Sanne nach, was Mira mit sich herumtrug? Um zu stehlen, was stehlenswert war?
Richtig! „Überteuerter Kosmetikkram, wer braucht denn so was?!“ Erneut klickte die Schnalle und Mira vermutete, dass Sanne die Tasche wieder schloss.
‚Warum hast du gerade mich ausgesucht? Warum? Ich hab dir nichts getan. Ich weiß nicht mal, wer du bist, woher du kommst. Ich weiß nicht, wo du wohnst, wo du arbeitest, ob du überhaupt einen Job hast, woher du mich kennst. Ich weiß nicht, ob Sanne Reitler dein richtiger Name ist. Ich weiß nicht, ob du Lösegeld verlangen wirst und ob Gerhard die Polizei einschalten wird.‘ So viele Fragen! Aber Mira konnte keine einzige davon stellen. Und hätte es vermutlich selbst ohne das Klebeband nicht gewagt.
Kapitel 3
Die Luft kühlte empfindlich ab, von der nachmittäglichen Wärme war längst nichts mehr zu spüren. Mira vermutete, dass es allmählich Nacht wurde, vielleicht schon Nacht geworden war, und sie zog die Beine noch enger an, machte sich klein gegen die Kälte. Sie fühlte sich, als sei sie aus ihrer Alltagswelt hinauskatapultiert worden, hinein in ein kaltes, lichtloses und fremdes Universum. Mühsam zwang sie sich, sich auf ihre Umgebung zu konzentrieren, um die Angst für einen Moment zu vergessen. Hinter ihrem Rücken stand ein Baum; wenn sie sich zurücklehnte, konnte sie die raue Rinde fühlen. Was mochte es für ein Baum sein? Eine Tanne? Fichte? Kiefer? Oder ein Laubbaum, eine Eiche vielleicht? Ringsum herrschte tiefe Stille; Totenstille, wie Mira schaudernd dachte. Saß Sanne Reitler überhaupt noch in der Nähe? Mira hatte keine Ahnung; jedenfalls hatte sie seit Stunden kein Wort mehr von ihr gehört und keine Bewegung wahrgenommen. Zumindest glaubte sie, dass Stunden verstrichen sein mussten, seit sie die Reitler zum letzten Mal sprechen gehört hatte. Aber ohne auf die Uhr schauen zu können, ließ sich die Zeit schwer schätzen.
Ob die Sandlerin sich davongestohlen, ihre Gefangene alleingelassen hatte? Hieß das, dass sich trotz allem eine Chance zur Flucht bot? Miras Mund fühlte sich staubtrocken an, die Lippen wie Eis. Ebenso wie ihre Fingerspitzen. Flucht … Wie würde die Kidnapperin auf einen Fluchtversuch reagieren, falls sie sich in der Nähe aufhielt, reglos auf einem weichen Moospolster lauerte und ihr Opfer wie eine Spinne beobachtete, die darauf wartete, dass ihr ein Insekt ins Netz ging? Spinnen waren grausam, fingen ihre Opfer mit klebrigen Fäden, wickelten sie ein, bis sie völlig hilflos waren und saugten sie dann bei lebendigem Leib aus. Mira hasste Spinnen. Die Spinnen im Keller vor allem, jene dicken, braunen, ekligen Kreaturen. Sie lauschte in die Finsternis. Nein, da war wirklich nichts, gar nichts, das auf die Anwesenheit eines anderen Menschen schließen ließ. Vielleicht war die Reitler weggegangen, um nach einem Bach zu suchen, aus dem sie trinken könnte? Auch Mira verspürte starken Durst. Sie fragte sich, ob sie es wagen sollte, still und leise aufzustehen, geduckt fortzuschleichen, einfach weg, irgendwohin, wo sie später in Ruhe probieren könnte, sich der Fesseln und des Knebels zu entledigen? Aber die Angst lähmte sie. Es war ihr unmöglich, ihre Glieder zu bewegen. Angst vor dem Messer, vor brutalen Schlägen. Angst vor der unbekannten Finsternis, vor gefährlichen Abgründen, den wilden Tieren, die hier, im Bergwald, möglicherweise nachts auf Jagd auszogen. So blieb Mira sitzen und spürte, wie eine Art inneres Weinen in ihr hochstieg, ein Weinen ohne Tränen. Das Weinen ihrer einsamen Kindheit.
Später, als ihre Arme einzuschlafen drohten und Mira sich doch bewegen musste, merkte sie, dass die Fesseln an ihren Händen mit einem Strick an irgendetwas fixiert waren, einer Wurzel vielleicht oder einem Stein. Oder dem Baum. Selbst, wenn sie es versucht hätte, wäre eine Flucht unmöglich gewesen.
„Komm jetzt!“ Sanne Reitlers Stimme klang ungeduldig. Mira spürte ihre Finger wie Krallen um ihren Arm, als Sanne sie hochzog und ihr die Tasche in die Hand drückte. „Los, mach schon, vorwärts!“
Blindlings stolperte Mira voran. Erst fühlte sie einen federnden Teppich aus Fichtennadeln unter ihren Füßen, dann harte Erde und Steine. Wurzeln, die sich quer über den Weg zogen, brachten sie beinahe zu Fall, elastische Zweige peitschten ihr Gesicht. Ihre Stirn und ihre Nase begannen zu bluten. Mira wollte weinen und traute sich nicht.
Sie hatte keine Ahnung, wie lange sie sich so den Weg, wenn es denn überhaupt ein Weg war, entlangquälte, bis die Kidnapperin sie plötzlich festhielt und das muffig riechende Tuch aufknotete, das bisher Miras Augen bedeckt hatte.
Mira sah, dass sie auf einer Lichtung standen. Über ihnen funkelten Tausende von Sternen aus einem klaren dunkelgrauen Himmel und ein halber Mond goss überraschend helles weißliches Licht über die Berge, die Mira mit ihren schroffen Wänden und schmalen Graten fremd und abweisend erschienen. Sanne trug jetzt ein riesiges Backpack auf dem Rücken, das sie vorhin, im Tal, nicht dabeigehabt hatte. Und statt des Messers hielt sie eine schwarze Pistole in der Hand. Mira schauderte. Sanne riss ihr das Klebeband vom Mund und Mira holte tief und keuchend Luft.
„Lassen Sie mich jetzt heimgehen?“ Mira flüsterte nur, hatte Angst, laut zu sprechen, Angst vor der Waffe, vor den Schmerzen, vor dem Tod.
„Das könnte dir so passen!“ Sanne lachte, aber es war kein frohes Lachen, drohend eher, und Mira musste unwillkürlich an eine Hyäne denken. Hyänen lachten, aber auch bei ihnen war es kein echtes, sondern ein bösartiges Lachen. Eins, das ihren potenziellen Opfern Furcht einflößte, ihnen deutlich machte, wie schlecht ihre Chancen standen, den Tag – oder eher die Nacht? – zu überleben. „Wer weiß, ob du überhaupt wieder heimgehen wirst?“, höhnte Sanne. „Alles hängt davon ab, wie du dich benimmst! Ob du tust, was ich sage. Und ob sonst alles nach Plan läuft.“ Plötzlich hatte sie das Messer in der Linken, während sie mit der Rechten die Pistole hielt. Drohend fuchtelte sie mit der Klinge vor Miras Gesicht herum. „Versuch ein einziges Mal abzuhauen oder sonstige Dummheiten anzustellen, du blöde Zicke, und ich schneid dich in Streifen. Und schick sie deinem verdammten Mann im Postpaket zurück! Kapiert?“
Mira brachte kein Wort heraus, während Sanne endlich auch ihre Hände losband.
Sie musste vor ihrer Kidnapperin gehen, immer den kaum erkennbaren Weg entlang, der sich steiler und steiler nach oben wand. Mira keuchte heftiger. Sie war keinerlei körperliche Anstrengung gewohnt und hatte sich zudem noch nicht völlig von der verspäteten Winter- oder der frühen Sommergrippe erholt, die sie sich erst im Mai eingefangen hatte. Sie fürchtete, demnächst völlig zusammenzubrechen, wenn sie weiter in diesem für ihre Verhältnisse ungewohnt flotten Tempo bergauf marschieren musste. Und dann? Die rabiate Sandlerin würde ihr kaum einen Arzt rufen. Doch als Mira schließlich vornübergebeugt stehenblieb, um wenigstens ein bisschen zu Atem zu kommen, ließ Sanne sie überraschenderweise gewähren.
Je weiter die beiden Frauen nach oben stiegen, desto kleiner und geduckter wuchsen die Bäume, wetterverkrümmte Latschenkiefern überzogen weite Areale. Dazwischen dehnten sich Partien mit kargen Wiesen oder Geröllfeldern. In der Ferne zeigte sich ein gigantischer, schwarzer Schatten, eine Felswand, wie Mira vermutete.
„Wo gehen wir hin?“, wagte sie endlich zu fragen, als sich ihr keuchender Atem nach einer zweiten Zwangspause halbwegs beruhigt hatte.
„Dahin, wo dich unter Garantie niemand suchen wird. Weder die Bullen noch dein geliebter Göttergatte.“ Sanne merkte man keinerlei Anstrengung an, wie Mira neidvoll feststellte. Wie schön wäre es, so gesund zu sein … Doch in dieser Nacht war ihre schwächliche Konstitution Miras kleinstes Problem.
Wollte die Fremde sie die Felswand hinaufjagen, um sie von dort in den sicheren Tod zu stürzen? Mira fühlte sich unendlich schutzlos, ausgeliefert. Mittlerweile bedauerte sie, keinen Fluchtversuch unternommen zu haben, als sie sich noch in der Nähe des Tals befunden hatten, zu jenem Zeitpunkt, als ihr das erste Mal schwante, dass die Sandlerin sie nicht wegen eines Fotoprojekts in die Berge lockte. Ob es hier oben eine Alm gab? Oder eine Berghütte, vom Alpenverein oder einer ähnlichen Organisation? Irgendeinen Ort, wo sich andere, normale Leute aufhielten, freundliche Menschen, die Mira helfen konnten, sich von dieser Irren zu befreien, die sie weiß-der-Himmel-wohin verschleppte? Das durfte es doch nicht geben, dass die Verrückte eine Frau entführte, und niemandem fiel es auf? Mitten im zivilisierten Deutschland.
Doch Mira fühlte sich müde und viel zu kaputt für lange und fruchtlose Grübeleien. Sie schlief häufig schlecht, sei es aufgrund der Depression oder aus anderen Gründen. Deshalb war sie chronisch müde, aber in dieser Nacht, auf dem beschwerlichen Fußmarsch, wurde die Erschöpfung unerträglich. Miras Beine fühlten sich schwer an wie Elefantenfüße, ihre Knie wie Wackelpudding. Und ihr Herz jagte wie kurz vor dem Vorhofflimmern.
„Los, weiter! Wir wollen nicht festwachsen!“ Sanne piekte ihre Gefangene mit dem Messer in den Rücken und Mira schoss nach vorn, rannte fast vor Entsetzen. Hinter sich hörte sie Sannes raues Lachen. „Na also, geht doch, Zimperliese!“
Ihr Energieschub war von kurzer Dauer. Wenige Minuten später wurde Mira so schwindlig, dass sie sich einfach auf den Weg kauerte und die Hände vors Gesicht schlug.
„Steh auf, stell dich nicht an!“, schimpfte Sanne. Grob wollte sie Mira hochziehen, die zu weinen begann. Vor Erschöpfung, Schwäche und Angst.
„Du simulierst! Du spielst mir bloß was vor! Los, geh weiter!“ Sanne packte Mira an den Haaren, riss daran, bis Mira vor Schmerzen laut aufheulte. Und nun fing Sanne zu schreien an, belegte ihre Gefangene mit Schimpfworten, die Mira bisher höchstens aus ordinären Talkshows kannte: „Drecksau! Schlampe! Hosenpisserin!“ Als Mira endlich die Hände sinken ließ, bewegte sich das bedrohliche Messer nur Millimeter vor ihrem Gesicht auf und ab.
„Aber ich kann nicht … Ich kann nicht mehr. Alles … dreht sich.“
Sanne kaute auf ihrer Unterlippe, setzte schließlich den großen Rucksack ab. Aus einem Seitenfach holte sie eine Cola. „Trink!“
Mit zitternden Fingern griff Mira nach der Flasche. Sie hätte lieber einen Pfefferminztee gehabt oder eine heiße Schokolade, wie ihre Mutter sie an Wintertagen gekocht hatte, wenn Mira als Kind durchgefroren von der Klavierstunde heimkam … Würde sie das Grab der Eltern womöglich niemals wiedersehen? Nie wieder in ihrem eigenen Esszimmer sitzen, mit einem Becher heißer Schokolade vor sich? Dem mit dem Fuchs drauf, ihrem Lieblingsbecher. Sie hatte ihn als Teenager, als sie in der zehnten Klasse war, von Chrissy bekommen, und der große Becher war mit Nougat- und Marzipanpralinen gefüllt gewesen. Mira erinnerte sich, wie sie und Chrissy unter dem Weihnachtsbaum im Wohnzimmer saßen und gemeinsam die Pralinen verspeisten, während sie nebenbei das neue Spiel ausprobierten, das Chrissy von Mira bekommen hatte. Wie hatte das Spiel noch geheißen? Mira schien es plötzlich ungeheuer wichtig, sich zu erinnern. So, als würde Chrissy zurückkehren, ihr zu Hilfe eilen, wenn Mira den Namen des Spiels aussprechen könnte. Ponytrail? War es das gewesen? Irgendwas mit Pferden auf jeden Fall. Chrissy liebte Tiere, genau wie Mira, aber während Miras Lieblingstier der Fuchs war, interessierte sich Chrissy hauptsächlich für Pferde. Sie träumte davon, einen Appaloosa zu besitzen. In ihrem Jugendzimmer hatten riesige Pferdeposter sämtliche Wände und Schränke geziert.
„Trink aus! Wir haben nicht ewig Zeit, du Lahmarsch!“
Mira gehorchte und versuchte aufzustehen. Doch sofort wurde ihr wieder schwindlig und sie schwankte als wäre sie betrunken. Sanne nahm ihr die Handtasche ab.
„Mann, bist du ein Schlappi!“ Ihre Stimme klang nicht mehr so ärgerlich wie zuvor. „Geh weiter, mach endlich! Wir sind fast da.“
‚Wo ist da?‘, hätte Mira gern gefragt, aber sie konzentrierte sich auf ihren Atem und den Pfad, der zum Glück bald flacher wurde und durch niedriges Gestrüpp führte, eher einem Wildwechsel ähnlich als einem künstlich angelegten Weg. Jetzt, wo das Gehen weniger anstrengend war, fror Mira erst recht. Sie wusste nicht, ob es hier oben wirklich so kalt war oder ob sie vor Erschöpfung schlotterte, auf jeden Fall schien die Kälte ihren Körper in einen Eiszapfen zu verwandeln und ihm jeglichen Rest Wärme zu rauben. Mira rieb ihre Hände gegeneinander. Sie spürte die eisigen Finger an ihrer Hand, als seien es nicht ihre eigenen. Sie legte eine Hand an ihre Wange und auch die fühlte sich fremd an, wie abgestorben. Mira wusste, dass man in den Bergen an Erschöpfung sterben konnte. Immer wieder las sie in der Zeitung Berichte über Touristen, die von der Bergwacht gerettet werden mussten, nachdem sie ihre Kräfte überschätzt und einen Kreislaufzusammenbruch erlitten hatten. Mira fragte sich, ob sie am kommenden Morgen tot auf diesem Weg liegen würde, eine magere Leiche, an der die ersten Ratten – gab es Ratten hier oben? – zu nagen begannen. Der Gedanke entsetzte sie maßlos.
Die Hütte bemerkte Mira erst, als sie beinahe dagegen gelaufen war. Keine einladende, bewirtschaftete Hütte wie die, in die Wanderer für eine Brotzeit einkehrten, sondern ein flaches, geducktes Gebäude mit schiefem Dach, auf dem kokosnussgroße Steine lagen. Der Sockel der Hütte war aus grobem Stein gemauert, der obere Teil bestand aus grau verwittertem Holz, das in Miras Augen nicht besonders vertrauenerweckend wirkte.
‚Ob wir hierbleiben? Zumindest ein paar Stunden, zum Erholen und Schlafen?‘, fragte sich Mira bang und hoffte es, hoffte es so sehr! Als sie über die Schwelle stolperte, hatte sie das Gefühl, keinen einzigen Schritt mehr gehen zu können.
„Setz dich dort hin!“ Eine Taschenlampe blitzte auf; wie ein Irrlicht wanderte der Strahl hin und her.
Mira verstand, dass mit „dort“ die wacklige Bank gemeint war, die auf einmal im Lichtkegel auftauchte. Sie gehorchte stumm und fast ohne weitere Gedanken als den, dass sie nun endlich, endlich nicht höher steigen musste. Vornübergebeugt, die Arme eng an den Körper gepresst, saß sie frierend da und lauschte dem eigenen, schweren Atem, während Sanne das Gepäck abstellte und sich an einem Windlicht zu schaffen machte, das auf dem Tisch in der Stube stand. Ein billiges Glas-Windlicht mit einer roten Friedhofskerze darin.
Als Mira vorsichtig den Kopf hob, brannte die Kerze und Mira erkannte, dass sie in einer Art Wohn-Ess-Stube saß, in der ein schwerer Holztisch, vier Stühle und die Bank als einziges Mobiliar standen. Der Raum nahm beinahe die gesamte Hütte ein, doch an der rechten Seite lagen offenbar noch zwei kleine Kammern; lediglich eine davon war durch eine schief in den Angeln hängende Tür verschlossen.
„Los! Da drüben, rein mit dir!“
Da drüben, das musste Sanne Reitlers Geste zufolge der Durchgang ohne Tür sein. Mühsam schleppte sich Mira in ein winziges Zimmerchen, in dem eine Isomatte auf dem Boden lag. Darauf befanden sich ein paar Decken, die aussahen, als ob sie viel benutzt und seit Jahren nicht gewaschen worden waren. Von einem Deckenbalken hing eine Kette aus dicken Metallgliedern, wie sie in Baumärkten zu allen möglichen Zwecken verkauft wurden. Sie war sicher mehrere Meter lang und endete in lächerlich aussehenden, mit rosa Plüsch verzierten Handschellen. Während Mira ohne zu begreifen auf das seltsame Arrangement starrte, hatte Sanne blitzschnell ihren linken Arm ergriffen und eine der Handschellen schloss sich mit lautem Klicken um ihr Gelenk.
Mira schrie auf, riss an der Handschelle, doch sie war zu, fest zu!
„Den Schlüssel hab ich versteckt“, sagte Sanne und es klang unangenehm fröhlich. „Draußen unter einem Felsen, so weit weg, dass die Kette nicht hinreicht. Selbst wenn du mich niederschlägst, massakrierst oder sonst was, hast du keine Möglichkeit, freizukommen. Deine einzige Chance ist, dass ich dich eines Tages freiwillig laufen lasse. Hast du kapiert?“
Mira nickte, unfähig zu sprechen.
„Vielleicht vergess’ ich selbst irgendwann, wo der blöde Schlüssel liegt.“ Sanne sagte es mit vergnügtem Lachen, als hoffe sie geradezu darauf. „Und dann bleibst du hier angekettet, solange du lebst oder bis die Balken der Hütte verfaulen. Und fünfhundert Jahre später finden Wanderer ein kümmerliches Skelett in Handschellen. So wie der Ötzi gefunden wurde.“ Sie lachte wieder, ging in die Stube hinüber und kehrte bald darauf mit zwei Flaschen Cola und einer Tafel Schokolade zurück. „Iss und schlaf!“
„Aber …“ Miras Gesicht brannte vor Scham. „Die … die Toilette?“
„Plumpsklo. Die Tür neben deiner. Aber wag es ein einziges Mal den Riegel zuzuschieben und ich trete sie ein. Ich stech’ dich dort ab, eh du zwei Tropfen pinkeln kannst, klaro?“
Die Kette hinter sich herziehend – glücklicherweise erwies sie sich als lang genug – verschwand Mira auf der Toilette. Natürlich lehnte sie die Tür nur an, aus Furcht, Sanne könne ihre Drohung wahrmachen. Doch selbst, wenn sie es gewollt hätte, sie hätte die schwere Tür sowieso nicht selbst schließen können, da sich das Holz im Laufe vieler Jahre verzogen hatte. Das Klo mit dem tiefen, dunklen Loch machte Mira Angst. Was da wohl für Tiere unten lauerten? Ratten, Spinnen, Kreuzottern, irgendetwas, das stechen oder beißen konnte? Besonders der Gedanke an fette, schwarze Spinnen ließ Mira schaudern und sie beeilte sich, fertig zu werden und den groben Holzdeckel zuzuschlagen. Als sie in die Stube zurückkam, sah sie, wie Sanne am hintersten Ende des langgestreckten Raums sich selbst eine Isomatte und einen grauen Schlafsack zurechtlegte. Dort, wo die Kette niemals hinreichen würde, wie Mira sofort erkannte.
Doch im Moment war es egal. Alles war egal außer dem Einen: Dass Mira für heute nicht weiterlaufen musste. Schnell, bevor Sanne irgendwelche neuen Quälereien einfallen konnten, huschte Mira in die Kammer zurück, legte sich völlig angekleidet auf die Matte und deckte sich mit den beiden schmuddeligen Decken zu.
Trotz aller Erschöpfung fand sie keinen Schlaf. Von Minute zu Minute schien die Matte härter zu werden; außerdem fehlte Mira ein Kopfkissen. Sie erwog für einen Moment, ihr dünnes Sommerkleid auszuziehen, um es sich zusammengerollt unter den Kopf zu legen, unterließ es dann. Ohne das Kleid, lediglich in der Unterwäsche, würde sie sich noch schutzloser, noch ausgelieferter fühlen als zuvor.
Die Decken wärmten kaum. Sie waren zu dünn, an manchen Stellen fast durchgescheuert, kratzten auf der Haut und rochen nach Stall. Sehnsuchtsvoll dachte Mira an ihr Bett, an die orthopädisch perfekt angepasste Matratze, die kuschelige Daunendecke, das weiche Kissen, die grünweiße, sauber duftende Bettwäsche. Wenn sie wenigstens in einen Schlafsack kriechen könnte, wie die Sandlerin! Ob sie bereits schlief? Mira lauschte in die Nacht. Sie konnte nichts hören, keinen rhythmisch-gleichmäßigen Atem, nichts. Vielleicht lag Sanne Reitler ebenfalls wach? Starrte genau wie ihre Gefangene durch die staubigen Fenster in die Nacht hinaus?
‚Warum?‘, fragte sich Mira wieder. ‚Warum macht sie das überhaupt? Was will sie von mir? Wirklich nur Lösegeld? Warum sagt sie es nicht einfach? Weshalb hat sie mich hier herauf gehetzt?‘ Und während sie ihr Hirn marterte und marterte, ohne eine vernünftige Erklärung zu finden, glitt sie endlich in den ersehnten Schlaf.
Kapitel 4
Als Mira erwachte, fragte sie sich zuerst, warum sie so entsetzlich fror. War in der Nacht eine Kaltfront über Süddeutschland gezogen? Sie erinnerte sich nicht, in den Nachrichten davon gehört zu haben. Dann der Schock, brutal wie ein Fausthieb in den Magen: Sie war nicht zu Hause, lag nicht in ihrem Bett! Sie befand sich in einer Berghütte, in der Gewalt einer Irren. Und diese Irre saß jetzt im Schneidersitz auf dem Boden vor Miras Matte. Vor Kälte – und Furcht – schlotternd tastete Mira nach ihrer Brille, die sie am Vorabend auf den Boden gelegt hatte. Als sie sie aufsetzte, gewannen die Gesichtszüge der Kidnapperin an Klarheit, schienen aber unglücklicherweise auch härter. Zumindest kam es Mira so vor. Eine lange Weile musterten sie einander, ohne zu sprechen.
„Als ich dich das erste Mal gesehen hab“, sagte Sanne endlich, „dachte ich, du seist höchstens zwanzig!“
„Ich bin einunddreißig“, murmelte Mira.
„Weiß ich mittlerweile. Ich hab deinen Perso gesehen, in deiner Geldbörse.“
Mira schwieg.
„Wieso bist du nicht weggelaufen, gestern, im Wald?“, fragte Sanne.
Mira zögerte. „Was wäre geschehen, wenn ich es versucht hätte?“
„Ich hätt dich so verkloppt, dass du’s kein zweites Mal probiert hättest. Kein zweites Mal hättest probieren können. Oder ich hätte zugestochen und dein Blut wär im Waldboden versickert und hätte die eine oder andere junge Tanne gedüngt.“ Die Gepiercte sagte es emotionslos und wieder schwiegen beide.
„Warum tun Sie das?“ Miras Stimme fiepte, als sie die Frage stellte, und Mira biss sich auf die Lippen, verärgert darüber, dass ihre Stimme ihre Angst verriet.
„Geht dich einen Scheißdreck an!“ Abrupt stand Sanne auf und ging in die Stube hinüber. Mira nutzte die Gelegenheit, um sich zur Toilette zu schleichen. Die Kette klirrte hinter ihr her als wäre sie ein ungeschicktes Schlossgespenst, und jeder Muskel in ihrem Körper wollte vor Schmerz aufschreien, eine Folge der anstrengenden nächtlichen Wanderung. Vorsichtig spähte Mira aus dem Fenster des Plumpsklos und erschrak: Direkt hinter der Hütte ging es steil nach unten, mindestens zwanzig Meter. Sie versuchte, mehr von der Landschaft zu sehen, und begriff, dass sie sich reichlich weit oben in den Bergen befand, auf vierzehn- oder gar sechzehnhundert Metern Höhe etwa. Könnte es hier jemand hören, wenn Mira schrie? Möglicherweise lag die Hütte kilometerweit von jeder anderen Behausung entfernt. Der Gedanke deprimierte Mira unendlich.
Als sie in die Stube kam, stellte Sanne gerade einen Topf Wasser auf einen kleinen Campingkocher. Selbst die zuckenden blauen Gasflämmchen kamen Mira feindlich vor. So leise wie möglich verzog sie sich in ihre Kammer. Weil sie nichts Besseres zu tun hatte, schaute sie auch dort aus dem Fenster: Es zeigte eine mit riesigen Felsbrocken übersäte Wiese, auf der gelbe und rote Frühjahrsblumen blühten. Eine Szenerie wie aus einem Heidi-Film. Als kleines Mädchen hatte Mira die Heidi-Reihe als Zeichentrickfilm im Fernsehen gesehen. Damals hatte alles idyllisch auf sie gewirkt. Sie hatte sich immer gewünscht, wie Heidi in einer Almhütte zu wohnen und auf sonnigen Bergwiesen mit Zicklein und Murmeltieren spielen zu dürfen. Irgendwie schien es ihr absurd, sich plötzlich inmitten einer Szene aus ihren eigenen Kindheitsträumen zu finden und festzustellen, dass sie statt zu dem erträumten Paradies zu einem Horror-Albtraum gehörte.
„Frühstück!“, rief Sanne aus der Stube. „Wer nicht kommt, kriegt nichts.“
Zögernd ging Mira zu der Fremden hinüber.
Auf dem Tisch mit seiner zerkratzten Holzplatte standen zwei billige weißblaue Emaille-Becher mit Kakao sowie zwei schäbige Porzellanteller mit verwaschenem Gänsedekor. Dazwischen ein paar Scheiben Brot, zwei Tafeln Schokolade, eine Packung Käsescheiben und in Folie eingeschweißte Discounter-Dauerwurst. Sanne setzte sich an eine Seite des Tisches und Mira nach minutenlangem Zögern auf den Stuhl gegenüber. Mira hätte gern einen Schluck Fruchtsaft getrunken, zu Hause gab es immer Orangensaft oder Grapefruitsaft zum Frühstück, nicht den preisgünstigen aus dem Supermarkt, sondern die richtig leckere Variante aus dem Naturkostladen. Aber sie wagte nicht, um Saft zu bitten. Schweigend nahm sie ein Brot und belegte es mit Käse.
„Ich wette, normalerweise speist du von feinstem Meißner? Hier wirst du andre Sitten kennenlernen, das garantier ich dir.“ Vergnügt biss Sanne von ihrem Sandwich ab, das sie aus zwei Scheiben Brot und einer Unmenge Käse und Wurst bereitet hatte.
„Wohnen Sie … immer hier?“ Mira flüsterte die Frage fast, so, als solle Sanne sich aussuchen, ob sie die Worte hören wollte oder nicht.
„Jetzt im Sommer meistens.“ Der letzte Bissen des Sandwichs verschwand und Sanne griff nach der Schokolade. „Schoko ist wichtig hier oben", erklärte sie, während sie den ersten Riegel abbrach. „Kostet nicht viel und bringt jede Menge Energie, wenn du den ganzen Tag in den Bergen rumkletterst.“
„Und … alles, was Sie brauchen, müssen Sie zu Fuß hochtragen? Von Bad Reichenhall bis hierher?“
Sanne antwortete nicht, sondern stopfte sich die Backen mit Schokolade voll. Mandelschokolade. Teure Confiserieware, wie Mira überrascht erkannte. Von wegen „kostet nicht viel!“ Wo kam das Geld dafür her?
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2017
- ISBN (ePUB)
- 9783956070396
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2018 (März)
- Schlagworte
- Krimi Psycho-Krimi Entführung verschleppt Flucht Berghütte Wazmanns Erben Frauke Schuster