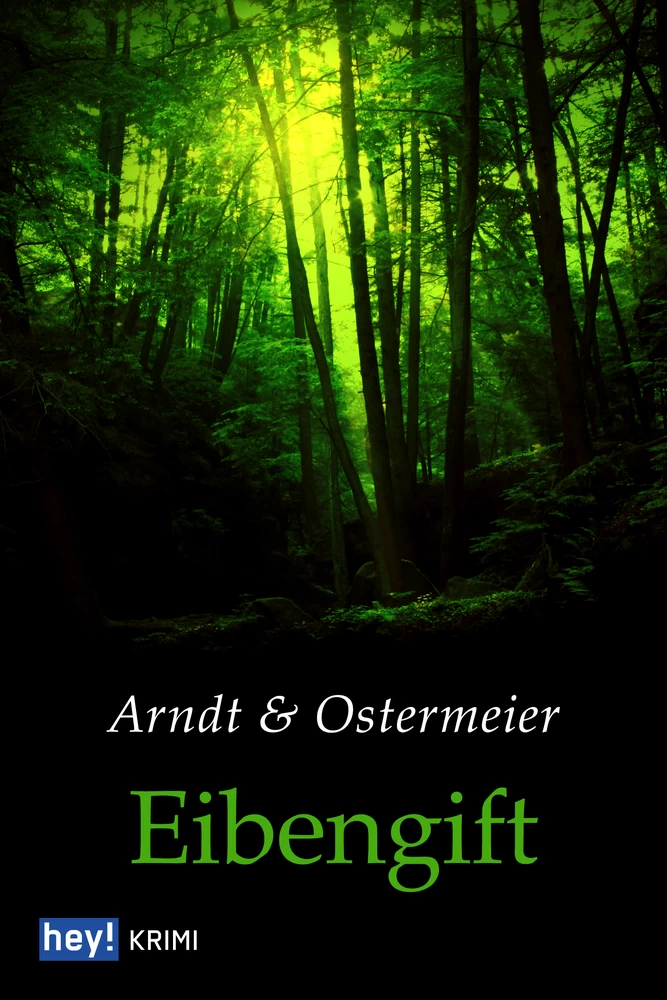Zusammenfassung
Otto Fechter, skurriler Urmünchner, und Renate Wörlein, wehrhafte Nürnbergerin, tauchen bei ihren Ermittlungen tief ein in die Licht- und Schattenseiten des Kunstbetriebs. Die Spuren des Verbrechens führen sie nach Oberbayern in den Eibenwald von Paterzell und nach Oberfranken in den Eibenwald von Gößweinstein.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Ottilie Arndt & Lydia Ostermeier
Eibengift
© Ottilie Arndt, Lydia Ostermeier
E-Book-Ausgabe: © 2013 bei hey! publishing, München
Originalausgabe: © 2011 bei Hermann-Josef Emons Verlag, Köln
Ottilie Arndt und Lydia Ostermeier werden vertreten durch die Verlagsagentur Lianne Kolf, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Umschlagabbildung: FinePic®, München
Von Ottilie Arndt und Lydia Ostermeier ebenfalls bei hey! erschienen:
Des Teufels Mühle
www.facebook.com/heypublishing
EINS
»Die weiße Perle am Ammersee!«
Kriminaldirektorin Renate Wörlein ließ ihre Augen über den imposanten Bau wandern. Breit und behäbig ragte er am Ufer des Sees auf. An dem vorspringenden Mittelbau der weißen Villa war nicht an Blendsäulen und Halbpilastern gespart worden. Links und rechts vom dreistöckigen Mittelbau zogen sich Arkadenbögen über die Quertrakte. In den Bogenfenstern spiegelte sich das letzte Licht dieses Freitagabends im Mai. Alle vier Eckpunkte des Gebäudes wurden von Erkeranbauten flankiert, die in spitzen Giebeltürmchen endeten.
Versonnen betrachtete sie die vier kupfernen Harfespieler auf den Spitzgiebeln, die in ihrer grünen Patina ins Land grüßten, und wiederholte: »Die weiße Perle am Ammersee. So heißt doch die Villa, nicht wahr, Otto? Sehr hübsch. Frisch restauriert. Hundert Jahre dürfte sie schon auf dem Buckel haben. Mitten im Naturschutzgebiet mit Blick auf Andechs, den heiligen Berg, das Wettersteingebirge und den See. Dein Conrad Desch hat entweder gut geerbt oder beim Kauf die Gunst der Stunde genutzt und mit Schmiergeld nicht gespart.«
Kriminaloberrat Otto Fechter schüttelte den Kopf. »Nichts dergleichen. Sein Urgroßvater hatte sich in diesen Winkel verliebt. Reich, wie er war, ließ er sich gern als großer Mäzen in der Kunstszene rund um den Ammersee feiern. Hier in Holzhausen waren sie alle einquartiert. Bei deren legendären Festen war er mit Begeisterung dabei. Ja, so mancher Künstler hätte buchstäblich von Luft leben müssen, wäre da nicht der alte Desch gewesen. Aber er hatte auch einen untrüglichen Blick für Qualität. Mit Schmieranten und Möchtegernkünstlern machte er kurzen Prozess. Die warf er kurzerhand aus dem Haus, mitsamt ihrer Leinwand. Und das ist nicht bildlich gemeint.«
Renate hörte interessiert zu, während sie sich der Villa weiter näherten. »Und siehe da, das künstlerische Qualitätsgen ist direkt auf den Urenkel übergesprungen. Desch ist doch berühmt für seine Spürnase. Hat er jemals einen Fehlgriff getan?«
»Nein.« Mehr konnte Otto nicht sagen, das ließ seine Kurzatmigkeit nicht zu.
Renate bemerkte das mit Sorge. Kein Wunder bei dem Übergewicht, das Otto mit sich schleppte. Gutes Essen hatte bei ihm einen nahezu erotischen Stellenwert. Es war sein Maß aller Dinge. Otto, dieser maßlose Genießer, war wie sie selbst Anfang fünfzig. Doch er war auf dem besten Weg, sich mit Messer und Gabel umzubringen. Sie kannten sich eine halbe Ewigkeit, genauer gesagt schon von der Ausbildung her, und hatten einige Verbrechen gemeinsam aufgeklärt. Das schweißte zusammen und war auch der Grund, warum sie sich um ihren langjährigen Freund Sorgen machte.
Endlich hatten sie das Portal erreicht und wurden sofort auf die Vernissage eingestimmt. Links neben dem Eingang, auf langen, biegsamen Stäben in unterschiedlichen Höhen angeordnet, wiegten sich fußballgroße rote Eibenbeeren. »Eibenelegie« hieß die Fiberglas-Installation, wie sie dem erklärenden Schild entnehmen konnten.
Ein junger Mann in rot-schwarzer Livree trat ihnen in den Weg. Er nahm ihre Einladungskarte auf einem Silbertablett entgegen und studierte sie eingehend. Wehte da nicht ein Hauch von Verachtung herüber, als er sie beide von Kopf bis Fuß musterte? Was sollte das überhebliche Hochziehen der linken Augenbraue? Renate beobachtete ihn verblüfft.
»Die letzte Zeile auf der Einladungskarte haben Sie wohl nicht gelesen«, merkte der Livreeträger mit näselnder Arroganz an.
Nun geschah Erstaunliches. Otto machte einen blitzschnellen Ausfallschritt, kam neben dem Livrierten zum Stehen und flüsterte ihm wenige Worte ins Ohr. Der stand daraufhin augenblicklich stramm und öffnete ihnen mit einer tiefen Verbeugung die Tür.
»Otto, du bist mir eine Erklärung schuldig. Was geht hier vor?« Renate bugsierte ihn in eine Nische des Eingangsbereichs.
Über Otto Fechters Gesicht glitt ein stillvergnügtes Grinsen. »Dem livrierten Lackaffen habe ich Folgendes erklärt: ›Wenn du dir nicht sofort deine dümmliche Arroganz aus dem Gesicht wischst, erzähle ich deinem Chef, dass du zwei Jahre wegen Drogenbesitzes in Stadelheim abgesessen hast.‹ Mein visuelles Gedächtnis funktioniert nämlich noch einwandfrei.«
»Mag sein, aber was steht denn auf der Einladungskarte?« Sie riss Otto die Karte aus der Hand und las laut davon ab: »Große Abendgarderobe erwünscht.«
Renate wurde blass.
»Und das sagst du mir nicht, du Hornochse!« Die blanke Wut sprühte aus ihren Augen. »Wie steh ich denn jetzt da im kurzen Rock? Von dir ganz zu schweigen! Dein ausgebeulter Trachtenanzug fleht kniefällig nach einer Reinigung. Wenn eine Kleiderordnung erwünscht ist, dann will ich mich auch daran halten. Was machen wir jetzt? Reingehen geht ohne Abendgarderobe nicht, also heimgehen.«
Otto ließ Renates Wutausbruch ungerührt über sich ergehen. Amüsiert verfolgte er, wie sich ihre blauen Augen vor Zorn verdunkelten und sie sich aufgeregt durchs Haar fuhr. Dass sie damit ihre Frisur ruinierte, war ihr offenbar gar nicht bewusst. Ungeschickt zupfte er ein paar der blonden Strähnen in Form und tätschelte ihre Hand.
»Selbstverständlich gehen wir hinein. An unserer Garderobe gibt es nichts auszusetzen. Du wirst schon sehen.«
Renate war davon keineswegs überzeugt und folgte Otto nur widerstrebend in den Ausstellungsraum.
Dezente klassische Musik lag wie duftiger Chiffon über dem großen Saal. Helles Lachen und die unterschiedlichsten Stimmlagen fügten sich nahtlos in den Klangteppich ein. Junge Mädchen in rotweiß gestreiften kurzen Kleidchen boten auf Tabletts Champagner und andere Getränke an. Renate und Otto griffen zum Champagner und blickten sich neugierig um. Die Wände, in zartem Rauchblau gehalten, wurden immer wieder durch weiße, flächige Jugendstilornamente aufgehellt. Eine gläserne Kuppel, die von außen gar nicht zu sehen war, ließ die Decke bis ins Unendliche wachsen. Üppiger Jugendstil. Der Marmorboden schimmerte in makellosem Weiß.
Kunstbeflissen schoben sich die Gäste von Bild zu Bild. Natürlich trugen fast alle Damen lange Abendkleider, wie Renate bitter bemerkte. Das wäre die ideale Gelegenheit gewesen, ihr fränkisches Abenddirndl erstmals vor einem oberbayerischen Publikum zu präsentieren. Dieser Otto! Ein ausgewachsener Ignorant in Bekleidungsfragen. Sie bedachte ihn mit einem bösen Seitenblick.
Otto merkte davon gar nichts. Mit erwartungsvoller Andacht näherte er sich den Bildern. »Anderswelt I« hieß das, vor dem er verweilte. Er musterte es mit höchster Konzentration. Hochgewachsene, überschlanke Frauengestalten bevölkerten eine unwirtliche Mondlandschaft. Die Umrisslinien bruchstückhaft, aber wohlakzentuiert gesetzt. Hier ein eleganter Hüftschwung, dort eine eckige Schulter und ein kantig nach vorwärts gerichtetes Knie. Sie strebten alle zu einem Ziel hin. Hin zu einer uralten Eibe. Grau- und Weißtöne beherrschten das Bild. Ottos Augen waren ständig damit beschäftigt, fehlende Begrenzungslinien zu ergänzen, diffusen weißen, schwarzen und grauen Farbinseln Volumen zu geben. Eine Thing-Versammlung? Nur mit Frauen? So mochte er es. Bilder, die seine Phantasie beflügelten.
Der Titel des Gemäldes daneben war »Anderswelt II«. Graue und schwarze Schattenrisse tanzten um eine mächtige Eibe. Übersteigerte Bewegungen, absurd verdrehte Gliedmaßen, Schatten, die einander überlagerten und durchdrangen, irrlichterten über die weiße Leinwand. Ein wilder Totentanz? Entfernt erinnerte Otto das Bild an das Höhlengleichnis von Platon. Eine Scheinwelt?
Diese Bettina Tauber, wie Otto der Signatur entnehmen konnte, zog mit ihren Bildern den Betrachter in eine fremdartige Welt hinein und ließ ihn mit einem ganzen Bündel Fragen zurück. Eine Könnerin, eine Meisterin.
Wer rempelte denn da so? Das Vernissagepublikum wurde zunehmend ungehobelter. Unwillig fuhr er herum.
Renate war der Störenfried. Nun zerrte sie heftig an seinem Ärmel und zog ihn mit sich. »Otto, das musst du dir ansehen.« Vor einem Bild mit dem Titel »In der Liebe verloren« machte sie halt. »Otto, das Bild muss ich haben. Sag das dem Desch. Aber der Preis muss stimmen, sag ihm das auch.«
Otto legte den Arm um Renates Schulter und begutachtete mit ihr das Bild. Mit zusammengekniffenen Augen prüfte er den dunstig blauen Himmel, um dann wieder zu dem roten Schuh zurückzukehren. Das Gemälde wurde beherrscht von einer mächtigen Eibe, deren plastische, blau verschattete Rindenstruktur von vielen Jahrhunderten erzählte. Ein Bach, geheimnisvoll umwabert vom Bodennebel, floss über weiße Sinterterrassen und ergoss sich über die dicken, schlangenähnlichen Wurzeln der Eibe. Im oberen Drittel des Stamms tat sich ein dunkles Loch auf. Eine Locheibe. Und da war er, der rote Schuh. In dem nahezu schwarzen Loch stand ein roter High Heel mit Plateausohle. Absatzhöhe gut und gerne fünfzehn Zentimeter.
»Dass du einen Schuhtick hast, weiß inzwischen das ganze LKA. Wenn dann hinter deinem Schreibtisch auch noch das Bild mit diesem roten Huren-High-Heel hängt, bringst du die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln. Wunderbar. Eine entzückende Vorstellung. Ich rede umgehend mit Desch.«
»Wie schön, die Herrschaften vom LKA sind ja doch gekommen.« Mit diesen Worten trat eine Dame in einem schwarzen Hosenanzug auf Renate und Otto zu. Übergroß. Überschlank. Überraschend fest der Händedruck, mit dem sie die beiden begrüßte. »Ich bin Barbara Engel, der gute Geist des Hauses. In meinen Händen liegt die gesamte Organisation. Herzlich willkommen Frau Direktor Wörlein. Auch Sie, Herr Kriminaloberrat Fechter, heiße ich herzlich willkommen zur Vernissage unserer drei Eibenkünstlerinnen. Sie werden sehen, wie unterschiedlich Bettina Tauber, Laura Berger und Verena Bach das Eibenthema interpretieren.« Barbara Engel warf einen kurzen Blick auf die hereinströmenden Gäste und stellte erfreut fest: »Sehen Sie, der Innenminister ist soeben eingetroffen. Soll ich Sie zu ihm bringen?«
Otto wehrte freundlich ab. »Lassen Sie nur. Wir werden ihm im Laufe des Abends schon über den Weg laufen.«
»Und wann kommst du?«, setzte Barbara Engel so unvermittelt in den Raum, dass Otto sich unwillkürlich umdrehte, um nachzusehen, wer gemeint war.
Barbara Engel strich eine ihrer schwarzen Locken aus der Stirn und lachte auf. »Das ist der Titel von meinem Lieblingsbild. Es hängt direkt hinter Ihnen, neben der Bauminstallation. Übrigens, das Büfett wird eröffnet, wenn Herr Desch seinen großen Auftritt hatte. Ich rechne in fünfzehn Minuten mit ihm.« Mit einem routinierten Lächeln entfernte sie sich.
Renate und Otto wandten sich um und betrachteten die Bauminstallation mit dem Titel »Totholzruhe«.
Ein skelettartig ausgebleichter Eibenstamm streckte seine verdrehten und verwundenen Aststümpfe nach allen Richtungen. Wie bei einem Leichenfundort wurde das Eibenskelett von einem rotweißen Polizei-Absperrband abgegrenzt. Gleich einer Tätowierung war »Totholzruhe« auf Stamm und Aste eingebrannt.
»Das wäre eine passende Installation für das Münchner LKA in der Maillingerstraße. Für so eine Realisierung von Kunst am Bau könnte ich mich richtig erwärmen«, meinte Otto mit Kennermiene.
»Dort drüben steht der Innenminister. Dem kannst du deine Vorstellung, wie Steuergelder verwendet werden sollten, gleich persönlich mitteilen«, schlug Renate vor und drängte ihn weiter zum Lieblingsbild von Barbara Engel mit dem geheimnisvollen Titel »Wann kommst du?«.
Die Bildmitte wurde wieder von einem mächtigen Eibenstamm beherrscht. Grün verschleiert warfen die Äste ihre blauschwarzen Schattenflecken darauf. Im unteren Drittel des Stamms tat sich ein dunkler Spalt auf. Eine Schlupfeibe. Ein Spalt, für einen zierlichen Menschen groß genug zum Durchschlüpfen. Eine blonde Haarsträhne, der letzte Schwung eines roten Kleides, ein Fuß, der sich zum Durchstieg hebt.
Otto konnte sich Barbara Engels Begeisterung nicht anschließen. Viel zu plakativ. Laura Berger ließ in ihrem Bild keinen Raum für Geheimnisse oder überraschende Wendungen. Solche Bilder bekamen erst durch wortreiche mystische Erklärungen ihr Fundament. Das kannte er zur Genüge. Vor diesen Erklärungsergüssen flüchtete er regelmäßig bei Ausstellungen. Ihm reichte das, was er selbst sehen und lesen konnte.
Ein kurzer, prüfender Rundblick, und er konnte die ausgestellten Werke den Künstlerinnen treffsicher zuordnen. Bettina Tauber, die Farbminimalistin, setzte ihre Bildvorhaben mit wohlberechneten, akzentuierten Pinselstrichen um, Laura Berger dagegen malte nahezu altmeisterlich und Verena Bach hatte sich auf Installationen spezialisiert.
»Herr Desch kommt. Wenn Sie möchten, können Sie ihn an der Auffahrt begrüßen.« Mit diesen Worten informierten die jungen Mädchen in ihren rot-weißen Kleidchen die Gäste. Sofort begann ein allgemeines Gedränge und Geschiebe in Richtung Ausgang.
Eingekeilt in die Menschenmenge, blieb ihnen keine Wahl. Auch Renate und Otto wurden ins Freie hinausgeschoben.
Über dem Ammersee hatte sich mittlerweile eine samtige Dunkelheit ausgebreitet. Unten am See näherte sich gemächlich ein Schiff, nur von Fackeln erleuchtet. Vier Personen stiegen aus. Gemessen schritten sie über den Landungssteg und den Kiesweg nach oben. Die Gruppe bildete ein Dreieck. Vorneweg, in einem langen azurblauen Kleid, eine rot gelockte Schönheit. Wie eine griechische Tempelwächterin hielt sie in den erhobenen Händen eine Fackel. Hinter ihr schritt Desch, flankiert von zwei blonden Frauen. Beide waren in wallende rote Kleider gehüllt, das Haar fiel ihnen weit über die Schultern. Auch sie trugen Fackeln. Desch, deutlich kleiner als seine beiden Begleiterinnen, hatte sich untergehakt. Seine schwarze Hose, verbrämt mit roten Biesen, steckte in weißen Cowboystiefeln mit hohen Absätzen. Über dem schwarzen Hemd spannte sich eine weiß-goldene Brokatweste. Aus der Westentasche leuchtete das weiß-blaue Rautenmuster eines Einstecktüchleins.
»Das ist also Conrad Desch, der bekannte Galerist?«, fragte Renate.
Otto nickte und beobachtete, wie sich ihre Augen förmlich an Desch festsaugten. An seiner ungewöhnlichen Erscheinung, seinem exzentrischen Auftreten. Der runde Kopf saß halslos zwischen den schwarzen Kragenecken. Die breiten Lippen waren zu einem spitzbübischen Grinsen verzogen, und die kleinen hellen Augen wanderten über die erlesene Gästeschar.
Gemächlich schob Conrad Desch seine linke Hand zwischen die Westenknöpfe. Der Napoleon vom Ammersee. Keine seiner Bewegungen war von den Gästen unbemerkt geblieben. Begeisterter Beifall brandete auf, Blitzlichter zuckten, und Mikrofone verschiedener Fernsehsender richteten sich wie kriegerische Lanzen auf Conrad Desch.
Den nun folgenden staatstragenden Reden, in denen viel von Kultur, Bildungspolitik, Förderung der Künste und Mäzenatentum gesprochen wurde, schenkte Otto keine Aufmerksamkeit. Lieber vertiefte er sich in die Gesichter der Gäste.
Alle waren sie Deschs Einladung gefolgt: die Mächtigen, die Müßigen und die Möchtegerns, die um jeden Preis dazugehören wollten. Neues Geld, alter Adel, Bildungsbürgertum, junge, attraktive Errungenschaften der Münchner Celebrity-Szene, Hungerleider und notorische Büfettfresser – alle waren sie da, wie jedes Jahr. Und wie in jedem Jahr entdeckte er auch einige fragwürdige Gesichter. Gesichter von Leuten, die er mit Geldwäsche, Drogenhandel und anderen Delikten in Verbindung brachte.
In der erlauchten Runde wurde eine gewisse Unruhe spürbar. Als erfahrener Szenekenner wusste Otto dies richtig zu deuten.
»Renate, jetzt wird es ernst. Reiß dich los, wir müssen zum Büfett. Gleich geht der Ansturm los.«
Wenige Minuten später war das Büfett im Saal eröffnet. Dank Ottos Zeitkalkül hatten sie die Konkurrenz weit hinter sich gelassen. Ungestört griffen sie nach den erlesenen Häppchen und ließen sich mit den Tellern in einer gepolsterten Sitzgruppe nieder.
Beim Essen fand Otto endlich die Zeit zu erklären, warum das mit der Kleiderordnung nicht so wichtig war.
»Renate, inzwischen hast du sicher bemerkt, dass ein kleiner Kreis der Gäste der Kleiderordnung nicht gefolgt ist. Das ist der innere Zirkel. Die wissen Bescheid. Und die kennen sich auch untereinander. Der Rest sind die Möchtegernpromis, die sich auf jedem besseren Fest herumtreiben. Das ist der dekorative Hintergrund. Auch deiner.«
»Wieso gehörst ausgerechnet du zum inneren Zirkel?«, erkundigte sich Renate misstrauisch. »Hast du dich etwa schmieren lassen?«
»Nein, keine Sorge. Ich war Vorjahren maßgeblich an der Aufklärung eines Kunstfälschungsskandals beteiligt. Damit habe ich Desch den Arsch gerettet. Seitdem überschlägt er sich vor Dankbarkeit. Schau nur, da kommt er schon.«
Conrad Desch verbeugte sich gerade so tief vor Renate, dass es nicht devot wirkte, und platzierte exakt zwei Millimeter über ihrem Handrücken einen Kuss. Dann boxte er Otto in die Seite: »Na, du alter Trachtler, was sagst du zu meinen Eibengrazien? Sind dir die vielen roten Punkte auf gefallen? Zwei Drittel der Werke sind bereits verkauft.«
»Aber hoffentlich nicht das Bild mit dem roten Schuh. Das hätte ich gerne erworben«, sagte Renate zu Desch.
Otto entging Renates Manöver nicht, mit dem sie ihre Worte begleitete. Wie zufällig landete ihre Hand auf der Linken von Desch. In ihre Augen schlich sich ein verträumter Glanz.
Doch Desch schien davon nichts zu merken. Bedauernd hob er die Schultern. »Es tut mir leid, aber das war eines der ersten Gemälde, die verkauft wurden. Laura kann für Sie noch einmal ein ähnliches Bild malen. Kommen Sie gelegentlich in meiner Galerie in München vorbei. Dann besprechen wir die Einzelheiten.«
Für Desch war damit das Problem gelöst. Er verabschiedete sich von Renate mit einem kernigen Händedruck, dagegen von Otto mit einem Augenzwinkern und einem leichten Schlag auf die Schulter. »Ich wünsche noch eine gute Unterhaltung. Otto, es wäre empfehlenswert, diesmal bis zum Ende des Feuerwerks zu bleiben. Es ist das exquisiteste, das jemals über dem Ammersee abgebrannt wurde.«
Nachdenklich sah Renate ihm hinterher, wie er in seinen absurden Cowboystiefeln davonstapfte. Wahrhaftig der Napoleon vom Ammersee. Er sah aus wie ein Mann, der bekam, was er wollte. Sein Lächeln war charmant und spitzbübisch, doch es lag auch Macht darin und die Arroganz, die Macht auf dem Fuß folgt. Jede seiner Bewegungen war bewusst kalkuliert, vom Handkuss bis zum augenzwinkernden Schulterschlag. Dazu seine ungewöhnliche Kleidung. Auch dahinter steckte Kalkül. Dazu fiel Renate eine Episode ein, die sie über Napoleon gelesen hatte. Der hatte bei seiner Krönung alle seine Generäle in Paradeuniform antreten lassen. Er dagegen erschien in der schlichten Kleidung eines einfachen Soldaten.
Desch kam ihr ähnlich vor. Erst sorgte er durch den Hinweis auf Abendgarderobe dafür, dass sich alle fein machten, und dann kam er in einer Kleidung daher, die meilenweit davon entfernt war. Für sie war auch das ein Beispiel von Machtdemonstration, ein kleines, aber vielsagendes. Er ließ die Gäste nach seiner Pfeife tanzten. Und wie sie tanzten, die Schönen und Reichen und die, die unbedingt dazugezählt werden wollten.
Ah- und Oh-Rufe schallten vom Portal herein. Das Feuerwerk versprühte einen ersten vielfarbigen Funkenregen.
Renate und Otto sahen eine Weile zu, dann drückten sie sich hinter dem Rücken der staunenden Menge vorbei und strebten dem Auto zu.
Jetzt zahlte es sich aus, dass Otto es weit oben an der Straße geparkt hatte. Ungehindert konnten sie das Grundstück verlassen und hatten auch noch den großen Vorteil, den Alkoholkontrollen zu entgehen, die die Polizei in Kürze rund um den Ammersee durchführen würde. Deschs Feste versprachen immer fette Beute. Manche, so erzählte man sich zumindest, ließen die Strafzettel sogar einrahmen, sozusagen als Nachweis, in die Villa Desch geladen worden zu sein.
ZWEI
Der Samstagmorgen dämmerte herauf. Sebastian Klenk schritt mit wachem Blick seinem Ziel zu, einer kleinen Erhöhung im Eibenwald. Dort würde er mit dem Fotografieren beginnen und auf den ersten Sonnenstrahl warten, der sich im filigranen Geäst der Eibe verfing, die er im Visier hatte. Mit diesen Fotos wollte er den Bildband über die Eibenmalerinnen einleiten.
Seine Gedanken wanderten zur gestrigen Vernissage in der Desch-Villa zurück. Zu der perfekten Inszenierung, der Opulenz von Farben und Formen. Hoffentlich machte ihm Barbara Engel, dieser Drache, nicht noch einen Strich durch die Rechnung. Während der Vernissage war sie ihm nicht von der Seite gewichen und hatte jede Bildeinstellung kritisch überwacht, als ob die drei Künstlerinnen ihre persönliche Erfindung wären, an der sie alle Rechte besaß.
Sorgfältig prüfte er die Morgendämmerung. Sein wichtiger Moment nahte. Er musste sich beeilen, um rechtzeitig an seinem Standort zu sein. Der Weg näherte sich dem Bach, der durch den Eibenwald floss. Nur noch ein paar Meter. Jetzt. Er hob die Fotoausrüstung von der Schulter, baute das Stativ auf und kontrollierte erneut das Licht. Die blaue Stunde. Hervorragend. Wie ein Scherenschnitt hoben sich die schwarzen Eibennadeln von dem geradezu unwirklichen Blau des Himmels ab. Er fotografierte wie besessen. Nach und nach verlor das Blau an Intensität, jetzt musste er nur noch auf den einen ersten Sonnenstrahl warten.
Er richtete die Kamera auf die Locheibe. Sie war sein Motiv. Auf sie würde der erste Sonnenstrahl fallen. Die Linse erfasste einen roten hochhackigen Schuh im Loch der Eibe. Weiteres Rot geriet ins Bild. Ein rotes Kleid. Eine Frau. Ihr Gesicht lag im Wasser des Baches, der die Eibe umfloss. Er drückte ab. Wieder und wieder. Faszinierende und verstörende Bilder.
Endlich kam er zur Besinnung, ließ die Kamera los und rannte zu der Frau. Er zog sie aus dem Wasser und drehte sie um. Mund und Augen standen weit offen, kein Lebenszeichen war zu erkennen. Laura Berger.
Sebastian Klenk atmete tief durch. Er griff nach seinem Handy und setzte einen Notruf ab.
Dann ließ er sich ins Gras fallen und dachte nach. Laura, seine Laura war tot. Die lebenslustige Laura, seine Muse, lag hier im Wasser. Was war da passiert? Ein Selbstmord? Niemals. Freiwillig ertränkt sich doch niemand in einem zwanzig Zentimeter tiefen Bach. Diese Fotos von der toten Laura Berger würde er nicht verwenden, so schön sie auch in ihrer Morbidität waren. Aus der Ferne hörte er das Jaulen von Sirenen.
Die Sirenen erstarben, aber die Richtung, aus der er sie gehört hatte, war klar. Sie kamen vom Parkplatz her. Er wartete und wartete. Warum kamen sie nicht? Er hatte seinen Standort doch eindeutig erklärt.
Ratlos erhob er sich aus dem Gras, packte seine Ausrüstung zusammen und machte sich auf den Weg zum Parkplatz.
Aus der Ferne sah er schon das rot-weiße Absperrband und begann zu laufen. Die dämlichen Polizisten sicherten tatsächlich die falsche Stelle ab. Atemlos kam er an der Absperrung an und keuchte: »Die Tote liegt doch dort hinten!«
Einer der Beamten kam mit Respekt einflößender Miene zu ihm heran und fragte: »Wer sind Sie?«
»Sebastian Klenk. Fotograf aus Weilheim. Ich habe die Frau gefunden und die Polizei alarmiert.«
»Wurde Ihnen nicht gesagt, dass Sie vor Ort zu warten haben?«
»Habe ich doch. Der Fundort ist dort hinten. Ich habe die Sirenen gehört, als aber niemand von der Polizei kam, bin ich nachschauen gegangen. Warum sperren Sie denn hier ab?«
»Wir haben hier auch eine Tote.«
Sebastian Klenk starrte den Polizisten fassungslos an. »Nicht möglich. Noch eine Tote?«
Sein Blick irrte hinüber zu der Eibe, vor der sich ein anderer Polizist zu schaffen machte. Als der sich von dem mächtigen Stamm ein paar Schritte entfernte, erkannte Sebastian den Baum. Die Schlupfeibe. Der Zipfel eines roten Kleides lugte aus dem gespaltenen Stamm hervor. Und ein Fuß mit einem roten Schuh. »Wann kommst du?«, sagte er dem Polizisten. »Genau das ist es.«
»Wie bitte? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir zusammen ein Weißbier getrunken haben. Unterlassen Sie gefälligst das Duzen.«
Doch Sebastian Klenk hörte ihm gar nicht zu, ihm schwirrte der Kopf. Was ging hier vor?
Mittlerweile war auch der andere Polizist herangekommen.
Aufgeregt erzählte Sebastian Klenk den beiden Beamten von den Eibenmalerinnen und der Vernissage in der Villa Desch. Seiner Ansicht nach müsste es sich bei dieser Toten hier um Bettina Tauber handeln.
»Wenn ich sie ansehen darf, kann ich es Ihnen genau sagen.«
Die beiden Beamten drehten sich von ihm weg und berieten kurz miteinander. Dann hob einer das Absperrband an.
Sebastian Klenk schlüpfte durch. Fasziniert starrte er ein paar Schritte später auf die Szene, die sich ihm bot. Sie entsprach ganz genau dem Motiv des Bildes »Wann kommst du?«. Perfekt inszeniert. Er musste an sich halten, um nicht unverzüglich seinen Fotoapparat in Anschlag zu bringen. Aus dem rückwärtigen Teil des Stammes ragte der restliche Körper der Frau hervor. Sie lag da mit dem Gesicht nach unten, die Arme weit nach vorne ausgestreckt, wie auf ein bestimmtes Ziel gerichtet.
Der Beamte, der Sebastian begleitet hatte, streifte Einweghandschuhe über und drehte das Gesicht der Frau so weit zur Seite, dass Sebastian Klenk es betrachten konnte.
Kein Zweifel: Es war Bettina Tauber. Klenk bekam auf einmal weiche Knie. Er musste sich setzen. Die beiden Eibenmalerinnen waren tot.
Jemand rüttelte ihn am Arm. Es war der Polizist. Er fragte besorgt: »Geht es wieder? Der Kriminaldauerdienst und die Spurensicherung sind eben eingetroffen. Sie müssen uns noch den anderen Fundort zeigen.«
***
Es war schon spät am Nachmittag, als Renate Wörlein und Otto Fechter im Paterzeller Eibenwald eintrafen. Am Parkplatz wurden sie von Hauptkommissar Jan Altinger ungeduldig und missgelaunt erwartet.
»Mir ist immer noch nicht klar, was das LKA bei diesem Fall zu suchen hat. Wir haben mittlerweile eine Soko von zwanzig Leuten gebildet. Traut ihr es der Weilheimer Kripo etwa nicht zu, zwei Morde gleichzeitig aufklären zu können?«
Otto Fechter kannte Altinger bereits von einigen Fortbildungsveranstaltungen her, die er in Ainring abgehalten hatte. An seiner Fähigkeit als Polizist gab es keinen Zweifel, das war ihm gleich aufgefallen. Nach der letzten Veranstaltung hatten sie bis weit nach Mitternacht miteinander gefachsimpelt und ein Bier nach dem anderen niedergemacht. Seitdem duzten sie sich. Im Grunde konnte er es Jan Altinger gut nachfühlen, dass der sich zurückgesetzt fühlte.
Er machte Renate mit Jan Altinger bekannt. Dabei registrierte er erfreut, dass sie für Jan keine Unbekannte war. Im Bereich der Organisierten Kriminalität hatte sich ihre Kompetenz mittlerweile weit herumgesprochen. Dann erklärte er Jan Altinger, wieso das LKA in diesen Fall eingeschaltet worden war. Er berichtete von der gestrigen Vernissage in der Villa Desch am Ammersee, von der Anwesenheit des Innenministers und von dem ganzen illustren und internationalen Publikum.
»Als wir durch den Kriminaltechnischen Meldedienst von den zwei toten Malerinnen erfuhren und uns die Tatortaufnahmen anschauten, schrillten bei uns und im Innenministerium alle Alarmglocken. Die Künstlerinnen waren in Sammlerkreisen weltweit bekannt, und die Gästeliste der Ausstellung liest sich wie das ›Who is who‹ des Geldadels. Es sind uns aber auch ein paar Namen aufgefallen, die uns gar nicht gefallen. Darüber sprechen wir noch, wenn wir mehr wissen. Jedenfalls ist der Fall ganz hoch oben aufgehängt. Theoretisch könnte man dabei mit allem rechnen. Wir arbeiten zusammen. Ihr macht die üblichen Ermittlungen vor Ort, wir kümmern uns um den Rest. Dann sehen wir weiter.«
Otto sah Jan Altinger an, dass er sich mit dieser Form der Zusammenarbeit wenig anfreunden konnte, und boxte ihn kumpelhaft in die Seite. »Wir nehmen dir die Ermittlungsleitung nicht aus der Hand, wir unterstützen dich. Und jetzt bringst du uns zu den beiden Tatorten.«
Renate, die wesentlich leichtfüßiger voranschritt als der schwergewichtige Otto, hatte den abschüssigen Einstieg in den Eibenwald bald überwunden und schaute sich wie verzaubert um. Immer wieder entdeckte sie eine Eibe von Ausmaßen, wie sie sie noch nie zuvor gesehen hatte bei derart langsam wachsenden Bäumen. Wie alt diese Giganten wohl sein mochten, fünfhundert oder gar tausend Jahre alt? Dann stand sie vor der Eibe mit dem gespaltenen Stamm, der Schlupfeibe. Schlupfeibe. Was für ein ungewöhnlicher Name für einen Baum. Otto hatte ihn benutzt, als sie die Tatortfotos sichteten. Das Areal war nach wie vor mit rot-weißem Band abgesperrt und wurde von zwei Spurensicherern sorgfältig durchkämmt.
Sie holte das Tatortfoto aus der Tasche und betrachtete es. Immer wieder schweifte ihr Blick zwischen Foto und Baum hin und her. Die Ähnlichkeit zu dem Bild »Wann kommst du?« war tatsächlich frappierend. War das eine Botschaft des Täters? Wenn ja, an wen richtete sich die Botschaft? Steckte dahinter vielleicht eine Drohung? Wenn ja, wem wurde gedroht? Fragen über Fragen, auf die sie keine Antwort wusste.
Schnaufend wie ein Walross trat Otto neben sie und musterte den Baum. Sein Atem wurde ruhiger, und er machte zwei Schritte zur Seite. Renate sah seine nachdenkliche Miene und fragte: »Was überlegst du dir?«
»Laura muss von hier aus gemalt haben. Die sanft gewellte Rindenstruktur, der Ast, der das Eibengrün fächerförmig über den Stamm breitet. Komm her und schau es dir selbst an.«
Renate stellte sich neben ihn und nickte. »Tatsächlich, so könnte es gewesen sein. Aber hilft uns das weiter?«
»Zumindest können wir annehmen, dass sie hier in freier Natur gemalt hat. Das ist ein öffentlicher Raum, der gern aufgesucht wird. Vielleicht kann sich jemand an die Malerin erinnern und hat dabei Beobachtungen gemacht, die uns weiterhelfen.«
Jan Altinger, der ihnen schweigend gefolgt war, sagte: »An dieser Schiene arbeiten wir bereits. Es wurden Befragungstrupps zusammengestellt und Handzettel angefertigt. Außerdem wollen wir so schnell wie möglich an die Presse gehen. Wenn es recht ist, schauen wir noch den zweiten Tatort an. Ich habe den Fotografen, der die andere Leiche gefunden hat, bereits hinbringen lassen.«
Renate ließ sich die Richtung zeigen und machte sich schon mal allein auf den Weg. Sie wollte in Ruhe die Umgebung auf sich einwirken lassen. Ottos kurzatmiges Schnaufen würde sie dabei nur stören. Ihr Auge schulte sich von Schritt zu Schritt mehr, und sie konnte nun leicht die Eiben von den Fichten und Tannen unterscheiden.
Eine Eibe, die sich bis zum Äußersten verdreht in die Höhe schraubte, zog sie magisch an. Welche Hindernisse hatte der Baum wohl zu überwinden gehabt, um sich derart drehen zu müssen, dass es direkt schmerzhaft aussah? Sie ging ganz dicht an den Baum heran und fuhr mit der Hand über die rötliche Rinde. Warm und sanft gewellt, fühlte sie sich an wie eine menschliche Haut. Man tat sich an ihr nicht weh, verletzte sich nicht.
Als Ottos und Jan Altingers Stimmen in der Ferne erklangen, setzte sie ihren Weg fort. Sie hörte dem leisen Plätschern des Baches zu, der sie nun begleitete. Es dauerte nicht lange, dann sah sie die Absperrbänder. Dahinter bewegten sich die Spurensicherer in ihren weißen Schutzanzügen geschäftig hin und her. Immer wieder wateten sie durch das Wasser hin zur Eibe, die mitten im Bach stand. Die Locheibe. Sie holte das entsprechende Tatortfoto aus der Tasche. Die tote Frau im roten Kleid, in der gleichen Sichtachse ihr rechter roter Stöckelschuh im Loch der Eibe. Nachdenklich schloss Renate die Augen und erinnerte sich plastisch an das Bild, das sie gestern während der Ausstellung gern gekauft hätte. Wenn ihr dies gelungen wäre, würde sie nun das Bild einer Toten besitzen. Jetzt fiel ihr auch wieder der Titel des Gemäldes ein: »In der Liebe verloren« hieß es. Warum wurde der Tod der Künstlerin so inszeniert, warum ihr eigenes Bildmotiv nachgestellt? Hatte sich etwa ein verschmähter Liebhaber an ihr gerächt? Damit hätten sie es mit einer Beziehungstat zu tun. Dafür war das LKA nicht nötig. Das konnte die Weilheimer Kripo allemal selbst erledigen.
Der Mann, der neben einem Polizisten auf einem Baumstamm saß, kam ihr bekannt vor. Sie schätzte ihn auf Ende dreißig, Anfang vierzig. Sein wild gelocktes dunkelbraunes Haar fiel ihm in die Stirn. Als er es mit einer heftigen Bewegung zurückwarf, kamen seine wasserhellen Augen zum Vorschein. Ein ungewöhnlicher Kontrast zu den dunklen Haaren. Ein Mann, der die Aufmerksamkeit auf sich zog, auch ihre. Das war doch der Fotograf, der sich während der Vernissage ständig in der Nähe der Eibenmalerinnen aufgehalten und ein Foto nach dem anderen geschossen hatte.
Sie ging auf ihn zu und reichte ihm die Hand. »Wörlein. Polizei. Ich habe Sie gestern in der Villa Desch gesehen.«
»Gestern, ja klar. Ich hatte von Conrad Desch die Erlaubnis, während der Vernissage Fotos von den Eibenmalerinnen zu machen. Klenk ist mein Name, Sebastian Klenk.«
»Dann sind Sie der Fotograf, der die Leiche von Laura Berger gefunden hat. Wie kam es dazu? Was haben Sie zu so früher Stunde hier gemacht?«
»Fotos. Mir fehlten noch ein paar atmosphärische Fotos für den Bildband über die Eibenmalerinnen.«
»Erzählen Sie. In welcher Position fanden Sie die Frau?«
»Wenn Sie möchten, zeige ich es Ihnen ganz genau. Kommen Sie.«
Renate folgte ihm zum Ufer des Baches.
Sebastian Klenk blieb neben der Markierungstafel der Spurensicherung stehen und ging in die Knie. »Sehen Sie, hier lag sie mit dem Gesicht im Wasser. Körper, Kopf und Schuh auf einer geraden Linie. Als Fotograf habe ich dafür ein Auge. Das lange blonde Haar wogte sanft im Wasser. Ein schrecklicher und zugleich schöner Anblick. Faszinierend und morbide. Ein Bild, wie es sich jeder Fotograf wünscht.«
Kaum war ihm der Satz herausgerutscht, erkannte Klenk die peinliche Situation.
»Haben Sie davon Fotos gemacht?«, fragte hinter ihm gefährlich leise der inzwischen herangetretene Jan Altinger.
»Natürlich. Ich hatte schon mehrfach auf den Auslöser gedrückt, bis ich merkte, dass hier etwas nicht stimmte.« Klenk reichte Altinger die Kamera. »Im Display können Sie sehen, dass die Fotos hier entstanden sind. Vielleicht sind sie sogar für Sie nützlich? Ich bin ein sehr guter Fotograf, bestimmt besser als Ihre Polizeifotografen.«
DREI
Jan Altinger von der Kripo Weilheim verließ am Montagvormittag die Münchner Rechtsmedizin und blickte eine Spur besser gelaunt auf den vorläufigen Befund in seiner Hand. Zumindest die rechtsmedizinischen Ergebnisse brachten ihn in dem komplizierten Mordfall Eibenwald ein Stückchen weiter.
Das war auch bitter nötig, denn die mühevolle Kleinarbeit, die den kompletten Samstag und Sonntag in Anspruch genommen hatte, war keineswegs erfolgreich gewesen. Die Befragung der Anwohner von Paterzell hätte man sich glatt ersparen können. Niemandem war zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen. Seltsam. Man hätte doch meinen können, in dem kleinen Ort würde kein Motorengeräusch unbemerkt bleiben. Gerade von den betagten Bewohnern hatte er sich dazu Aufschluss erhofft. Normalerweise hatten die eher einen leichten Schlaf. Denn eines stand für ihn fest: Die Malerinnen wurden in einem Auto zum Eibenwald gebracht, wie denn sonst?
Auch die akribische Suche der Spurensicherer hatte bis jetzt wenig Erhellendes gebracht. Natürlich gab es viele Spuren, doch die konnten aus allen möglichen Quellen stammen. Der Paterzeller Eibenwald war ein häufig besuchter Ort. Anfänglich war Jan Altinger an Reifenspuren besonders interessiert gewesen. Er konnte sich nicht vorstellen, dass der Täter sich die Opfer einfach auf die Schulter geladen hatte, um sie zu den Bäumen zu bringen. Irgendein Gefährt, eine Schubkarre vielleicht, müsste er doch benutzt haben. Als er gestern aber beobachtet hatte, wie Rollstuhlfahrer, Kinder mit Tretrollern und Mountainbiker an der Polizeiabsperrung vorbei in den Eibenwald eindringen wollten, war er um eine Illusion ärmer geworden. Allen Spuren nachzugehen, würde Wochen in Anspruch nehmen.
Das Haus, das die Malerinnen nahe dem Eibenwald bewohnten, hatten sie ebenfalls nach sachdienlichen Hinweisen überprüft. Leider vergeblich.
Zudem zog sich die Befragung der Gäste, die an der Vernissage teilgenommen hatten, in die Länge. An einige davon war äußerst schwer heranzukommen. Dabei erwiesen sich die Möchtegernpromis als besonders unangenehm. Die meinten doch tatsächlich, ihn wie einen Schulbuben behandeln zu können. Voll Arroganz von oben herab. Denen hatte er erst einmal in aller Klarheit zeigen müssen, wo der Barthel den Most holt.
Altinger verstaute den vorläufigen Befund der Münchner Rechtsmedizin in seiner Aktentasche und machte sich auf den Weg in die Maillingerstraße zum LKA.
Dort wurde er von Otto Fechter höchstpersönlich an der Pforte abgeholt und in dessen Büro gebracht. Mit dem Hinweis, Kaffee zu besorgen, verschwand Fechter gleich darauf wieder.
Altinger stellte sich ans Fenster und begutachtete zunächst die Aussicht auf die gegenüberliegende Häuserzeile. Er konnte in seinem Weilheimer Büro mit einem schöneren Blick aufwarten, das freute ihn. Gnädig gestimmt schaute er sich im Büro um. Die wenigen Stücke Wand, die nicht von Aktenschränken verdeckt waren, zierten hübsche Bilder. Jan Altinger war kein Kunstexperte, deshalb wagte er es nicht, dazu ein Urteil abzugeben. Hinter dem kantigen, sachlichen Schreibtisch mit eingeschaltetem Computer stand ein dick gepolsterter, mit tannengrünem Leder überzogener Schreibtischstuhl in Überbreite. Immerhin musste er Otto Fechters gewaltigem Hinterteil standhalten.
Otto Fechter, der Fächler. Von irgendjemandem hatte Jan Altinger gehört, dass Fechter einen riesigen Fächer besaß. Mit dem fächelte er sich Luft zu, wenn es in einer Sitzung heiß zuging. Er selbst hatte es zwar noch nicht gesehen, aber er traute ihm so etwas durchaus zu. Fechter kümmerte sich wenig um die Meinung anderer.
An der Tür polterte es, und eine Stimme rief: »Mach mal auf, ich hab keine Hand frei!«
Altinger öffnete und ließ Otto Fechter herein.
Der hielt ein Tablett mit Kaffee, Weißwürsten und Brezen in den Händen und stellte es auf dem runden Besprechungstisch ab.
»Arbeitsfrühstück. Deshalb der Kaffee. Mir würde ein Weißbier auch besser schmecken. Setz dich hin und fang an, sonst erleben die Weißwürscht noch das Zwölf-Uhr-Läuten, und das wäre ein Sakrileg. Frau Wörlein kommt auch gleich, aber die nimmt es mit den Weißwürschten nicht so genau. Die kommt aus Franken.«
Das sagte alles, und Jan machte sich unverzüglich über die Würste her. Er war schon bei der zweiten Wurst, als Renate Wörlein hereinkam.
»Schön, Sie zu sehen, Herr Altinger. Bleiben Sie bitte sitzen und lassen Sie sich beim Essen nicht stören.«
Sie stellte ihre Tasche neben dem Stuhl ab, setzte sich zu ihnen an den Tisch und schaute auf ihre Armbanduhr. »Drei Minuten vor zwölf. Da muss ich aber Tempo machen mit den Weißwürsten.«
Otto Fechter schob seinen leer gegessenen Teller zur Seite und stapelte den von Jan Altinger darauf. Danach verschränkte er die Arme über seiner Wampe und sah ihn erwartungsvoll an. »Was hat die Obduktion der zwei Malerinnen ergeben?«
Altinger holte den Schnellhefter mit dem rechtsmedizinischen Befund aus seiner Aktentasche und schlug ihn auf.
»Die chemisch-toxikologische Analyse von Blut, Urin, Mageninhalt und Lebergewebe ergab, dass beide Frauen mit hochkonzentriertem Taxin, dem Gift der Eibe, vergiftet wurden. Zudem wurden ihnen K.-o.-Tropfen verabreicht, genauer gesagt GHB.«
Otto Fechters Faust krachte so heftig auf den Tisch, dass die zweite Weißwurst von Renate Wörleins Teller flutschte. »Wieder dieses Dreckszeug«, schimpfte er. »Wenn ich GHB schon höre, könnte ich vor Wut platzen. Gamma-Hydroxybuttersäure. Von keinem Gift habe ich mir bis jetzt die offizielle chemische Bezeichnung gemerkt, aber von dem schon. Dieses Giftzeug hat München in den achtziger Jahren durch den Donisl-Fall ganz schön in Verruf gebracht. Das Donisl verkam damals zu einer echten Räuberhöhle. In dem ach so traditionsreichen Lokal wurde Gästen immer wieder mal GHB heimlich ins Bier geträufelt. Meist Besuchern aus dem Ausland. Sie wurden ausgeraubt und in der Nähe des Wirtshauses auf eine Bank gelegt. Das Schlimme dabei war, dass sie sich an nichts erinnern konnten. Sie glaubten, sie wären am Verlust ihres Geldes selbst schuld gewesen, so besoffen wie sie waren. Deshalb hat die Fahndung nach den Tätern auch so lang gedauert, sicher fast ein Jahr.«
Otto Fechter sah zu, wie Renate Wörlein ihre Weißwurst vom Boden aufhob und sorgfältig nach Schmutzspuren absuchte. Das veranlasste ihn aber keineswegs zu einer Entschuldigung, vielmehr wütete er weiter: »Wer in München Bier mit GHB versaut, begeht ein Kapitalverbrechen. Das ist ein direkter Anschlag gegen ein Münchner Kulturgut. Solche Täter sollten umgehend des Landes verwiesen werden!«
»Wir Franken mögen auch kein Liquid Ecstasy im Bier«, merkte Renate Wörlein an und legte betrübt die Wurst zur Seite. »Mit GHB versetztes Bier schmeckt uns ebenso wenig wie Weißwurst mit Staubflusen. Bei uns ist es nämlich noch weit mehr als ein Kulturgut, es ist unser Lebenselixier. Ich bin aber nicht für Ausweisung, sondern für tätige Reue und hätte da gleich einen Vorschlag: während des Oktoberfestes Abend für Abend die vollgekotzten Maßkrüge spülen und die verpinkelten Bierzelte putzen.«
»Aber ohne Gummihandschuhe«, warf Jan Altinger schnell ein. »Wir Weilheimer reagieren auf manipuliertes Bier ebenfalls rundum allergisch. Ich versteh bloß nicht, warum nach dem Donisl-Fall mehr als zwanzig Jahre verstreichen mussten, bis man endlich den Besitz von GHB und den Handel damit unter Strafe stellte.«
Danach nahm er den Faden seiner Berichterstattung genau dort wieder auf, wo er von Otto Fechter unterbrochen worden war. »Es wurden noch Alkohol, Orangensaft und ungewöhnlich viel Zucker nachgewiesen. Laut rechtsmedizinischem Gutachten geht man davon aus, dass speziell der Zucker zur Geschmacksverbesserung diente, denn Taxin schmeckt extrem bitter. Bei beiden Frauen kam es zu keinen sexuellen Übergriffen. Die Todeszeit dürfte ziemlich gleich sein. Zwischen ein und drei Uhr morgens. Man konnte mir nicht sagen, welche der Frauen zuerst starb.«
Er schlug eine andere Seite in seinen Unterlagen auf und warf einen kurzen Blick darauf. »Und nun zum Mageninhalt. Bei beiden wenig. Alles halb verdaut. Die eine irgendetwas mit Fisch, die andere ein bisschen Fleisch.«
Otto Fechter bekam einen versonnenen Gesichtsausdruck. »Hoffentlich hat es sich bei dem Fisch um die Seezungenröllchen gehandelt. Die waren hervorragend. Genau auf den Punkt gegart. Schade, dass sie ein wenig aus der Mode gekommen sind. Man findet sie viel zu selten auf Büfetts. Nur diesen pappigen Sushi-Kram. Und zum Fleisch? Na, ich weiß nicht recht. Jedenfalls hätten die Rinderfilet-Kanapees für meinen Geschmack eine Spur zarter sein sollen.«
Jan Altinger zog scharf die Luft ein. Befand er sich jetzt hier in einem Feinkostladen oder was? Ach, wie auch immer. Über Otto Fechter kursierten mittlerweile so viele seltsame Geschichten, da kam es darauf auch nicht mehr an. Kommentarlos blätterte er eine Seite weiter und fuhr fort: »So, das waren die Gemeinsamkeiten. Jetzt komme ich zu den Unterschieden. Bettina Tauber, die in dieser sogenannten Schlupfeibe steckte, war auf alle Fälle tot, bevor sie durch den Stamm bugsiert wurde. Sie wies nämlich erhebliche Schürfwunden auf, die kaum bluteten. Wenn sie noch gelebt hätte, wäre viel mehr Blut geflossen. Anders sieht es bei Laura Berger aus. Die hat noch gelebt, als sie zu der Locheibe gebracht wurde. In ihren Lungen befand sich nämlich Wasser aus dem Bach, in dem sie mit dem Gesicht lag. Sie hat zwar keine Abwehrverletzungen, aber im Nackenbereich gibt es leichte Schürfmale. Offenbar hat der Mörder ihren Kopf unter Wasser gedrückt.«
Renate Wörlein, die in ihrem Notizbuch herumsuchte, blickte überrascht auf. »Trotz GHB und Taxin war es nötig, sie zu ertränken? Da war sich der Täter oder die Täterin über die Wirkung des Eibengiftes wohl nicht absolut sicher?«
»Mir wurde von der Rechtsmedizinerin erklärt, dass es nicht einfach ist, eine genaue Dosis herzustellen. Zudem dauert es seine Zeit, bis das Gift wirkt. Es ist ein Mitose-Gift, das die Zellteilung hemmt.« Jan Altinger goss sich Kaffee nach. »Es wurde schon im Mittelalter für Abtreibungen verwendet. Nicht selten endete diese Prozedur tödlich. Die Rechtsmedizinerin konnte wirklich viel Interessantes über das Gift der Eibe berichten. Wenn ich nicht hier den Termin gehabt hätte, würde ich höchstwahrscheinlich jetzt noch bei ihr sitzen. Ich hatte zum Beispiel keine Ahnung, dass es heutzutage in synthetischer Form auch in der Krebstherapie eingesetzt wird.«
Fechters ungeduldiges Stirnrunzeln brachte Jan Altinger wieder zum eigentlichen Thema. »Aber zurück zu den Eibenwaldmorden: Wie gesagt, braucht es Zeit, bis das Taxin wirkt. Um diese Zeitspanne zu überbrücken, wurde nach Ansicht der Rechtsmedizinerin möglicherweise das GHB eingesetzt. Damit wurden die Opfer schneller willenlos. GHB entfaltet seine Wirkung zwischen zehn und dreißig Minuten. Das hängt ab vom körperlichen Allgemeinzustand und der Höhe der Dosis.«
»Aber auch von der Alkoholmenge«, gab Otto Fechter zu bedenken. »Gerade durch den Donisl-Fall sind wir darauf aufmerksam geworden. In Verbindung mit Alkohol kann GHB sogar lebensgefährlich sein. Im Extremfall kommt es zum Atemstillstand. Gibt es Erkenntnisse zur Darreichungsform, ich meine flüssig oder als Pulver?«
»Dazu hat die Rechtsmedizinerin nichts gesagt. Ich persönlich tippe auf die flüssige Form. Die ist einfach und unauffällig zu handhaben.«
Renate Wörlein, die sich verschiedene Notizen gemacht hatte, legte den Stift nun weg und stützte nachdenklich das Kinn in die Hand. »Frage: Mit wem wurden die Frauen zuletzt gesehen? Diese seltsame Tötungsart lässt für mich den Schluss zu, dass der Täter mit seinen Opfern relativ lang zusammen war.«
Jan Altinger war der gleichen Meinung. »Das denke ich auch. Leider haben wir bis jetzt niemanden aufgetrieben, der uns dazu genauere Angaben machen konnte. Man hat die Malerinnen vor dem Feuerwerk gesehen, aber danach nicht mehr. Conrad Desch war darüber fuchsteufelswild. Er hätte sie noch für ein Foto mit einem wichtigen Kunden gebraucht.«
»Kurz vor dem Feuerwerk haben Renate und ich die Malerinnen auch noch gesehen«, brummte Otto Fechter. »Ich erinnere mich, dass dieser Fotograf aus Weilheim ständig um sie herumscharwenzelte. Dem müsste doch am ehesten aufgefallen sein, mit wem die Frauen Kontakt hatten. Wie sieht es überhaupt mit seinem Alibi aus, ist das überzeugend?«
Altinger machte eine wegwerfende Handbewegung. »Keine Spur. Er versicherte uns, dass die Aufnahmen, die er vor dem Feuerwerk gemacht hat, seine letzten von der Vernissage waren. Er hat sie uns gezeigt, aber das heißt noch nicht, dass wir ihm das glauben. Seiner Aussage nach ist er noch vor Ende des Feuerwerks nach Hause gefahren. Das mache er immer so, sagte er uns, damit er nicht in den Stau gerät, wenn alle losfahren. Gegen halb eins kam er nach Hause. Dort hat er sich umgezogen und seine Fotoausbeute überprüft. Zwischen drei und halb vier ist er nach Paterzell in den Eibenwald gefahren, um noch ein paar bestimmte Aufnahmen zu machen. Dabei hat er dann die Leiche von Laura Berger entdeckt. Die Fotos haben wir uns ausgedruckt. Von Bettina Tauber sind keine dabei, an dem Tatort ist er erst gewesen, als die Polizei eintraf. Angeblich. Den Rest kennt ihr von ihm selbst. Seine Frau hat übrigens nicht gehört, wann er nach Hause gekommen ist. Sie schlief bereits.«
Renate Wörlein runzelte die Stirn. »Mich beschäftigt nach wie vor das Taxin in Kombination mit GHB. Wir wissen, dass GHB ein flüchtiger Stoff ist, der nur eine begrenzte Zeit im Blut und Urin nachweisbar ist, maximal sechs Stunden im Blut und bis zu zwölf Stunden im Urin.«
»Richtig. Deshalb war es ein großes Glück für uns, dass der Fotograf den Leichenfund so schnell gemeldet hat. Der Rechtsmedizinerin, die wenig später vor Ort war, ist sofort der Schaumpilz aufgefallen, der sich vor Mund und Nase der toten Bettina Tauber gebildet hatte. Sie sagte mir, das sei ein sicheres Zeichen für ein Lungenödem und könne auf eine Vergiftung hindeuten. Misstrauisch wurde sie zudem wegen des ungewöhnlichen Fundortes im Eibenwald. Sie setzte daraufhin das gesamte Giftprogramm für beide Leichen in Gang. Dabei ist sie auch auf das GHB gestoßen.«
»Das war wirklich ein Glück. Aber was ist das für eine Handschrift, Taxin und GHB? Was sagt uns das?«, grübelte Renate Wörlein.
»Vielleicht, dass es sich um eine Täterin handelt«, schlug Altinger vor. »Bei Giftmorden sind weibliche Täter statistisch in der Überzahl. Mord durch Gift ist heimtückisch, und Heimtücke ist nun einmal ein weibliches Merkmal.«
»Trotzdem überrascht mich das Taxin. Giftmorde sind mittlerweile rückläufig, auch bei Frauen. Es ist kein großes Geheimnis mehr, dass der Rechtsmedizin heutzutage fast immer ein präziser Nachweis gelingt«, merkte Renate Wörlein an.
»Fast, Sie sagen es. Bis auf das eine Gift, das wir alle kennen und niemals benennen, weil die Anwendung erschreckend einfach ist.« Mit verschwörerischer Miene schaute Jan Altinger Renate Wörlein an und setzte hinzu: »Natürlich könnte auch ein Mann die Tat begangen haben, der den Anschein erwecken wollte, eine Frau sei die Täterin. Wir werden das alles in unseren Ermittlungen berücksichtigen. Trotzdem werden wir zunächst die Frauen im direkten Umfeld der Opfer unter die Lupe nehmen. Mit der dritten Malerin, dieser Verena Bach, fangen wir an. Wer weiß, vielleicht zieht sie einen Vorteil aus dem Tod der beiden Kolleginnen.«
»Das ist gut. Wie verbleiben wir?« Renate Wörlein klappt ihr Notizbuch zu und blickte fragend um sich.
Otto Fechter erklärte, er wolle sich eingehend mit Conrad Desch und dessen Assistentin Barbara Engel unterhalten und sich dabei genau in der Galerie umsehen.
Jan Altinger fand diesen Vorschlag hervorragend. Diesem Kunstrummel konnte er nichts abgewinnen, und auf den Conrad Desch mit seinem herablassenden Gehabe verzichtete er von Herzen gern. Er und seine Mitarbeiter hatten mit der Tatortanalyse und der Zeugenbefragung sowieso alle Hände voll zu tun.
Renate Wörlein sagte nach kurzem Nachdenken: »Mich interessiert speziell diese Verena Bach, die dritte Malerin. Ich würde sie mir gern selbst vornehmen. Dazu bräuchte ich aber vorab alle Informationen, die über sie vorliegen.«
»Dann ist es am besten, wenn Kommissarin Amire Önar Sie begleitet. Sie hat sich eingehend mit Verena Bach auseinandergesetzt. Ich regle das sofort«, versprach Jan Altinger. Er verstaute den rechtsmedizinischen Befund wieder in seiner Aktentasche und verabschiedete sich.
Auch Renate Wörlein packte ihre Unterlagen zusammen. Sie rief Otto ein »Ade« zu und machte sich auf den Weg zu ihrem Büro. Dabei ging ihr erneut die Heimtücke der Giftmischerinnen durch den Kopf. Mit der Überzahl von Frauen bei Giftmorden hatte Jan Altinger zwar recht, aber nicht unbedingt mit der Schlussfolgerung der Heimtücke. In Polizeikreisen waren weibliche Giftmörderinnen eine hinlänglich durchdiskutierte Tatsache. Ja, Giftmorde sind heimtückisch und vor allem grausam, dachte sie, da die Opfer oft qualvoll sterben müssen. Darum gelten Grausamkeit und Heimtücke in der Gesetzgebung auch als besonders verwerflich.
Dass aber Frauen eher zu Gift greifen als Männer, lag nach Renates Ansicht an ihrer körperlichen Unterlegenheit, und nicht an ihrer besonderen Neigung zur Heimtücke. Giftmorde konnten ohne großen Kraftaufwand in die Tat umgesetzt werden. Frauen waren nicht raffinierter, ideenreicher, hinterhältiger, grausamer und heimtückischer als Männer. Renate wusste genau, dass es dazu keine wissenschaftlich verwertbaren Erkenntnisse und Erfahrungswerte gab. In der Öffentlichkeit kursierte aber noch immer das nicht ausrottbare Vorurteil, Frauen wären besonders grausame und heimtückische Täterinnen.
Männer kamen hierbei besser weg. Sie griffen meist zum Messer, gingen den Gegner frontal an und machen kurzen Prozess mit ihm. Brutal und gewalttätig, aber nicht heimtückisch. Doch Renate kannte auch eine Reihe heimtückischer Taten, die nahezu ausschließlich von Männern durchgeführt wurden. Sie manipulierten die Bremsen oder das Steuer eines Autos und spannten Drähte als Stolperfallen vor eine Treppe oder in Halshöhe zwischen zwei Bäume.
VIER
Von der Maillingerstraße zur U-Bahn waren es nur wenige Gehminuten. Otto Fechter liebte die öffentlichen Verkehrsmittel. Während er mit der Rolltreppe sanft nach unten glitt, blies er die Backen auf und intonierte den markigen Rhythmus des bayerischen Defiliermarschs. Auf der gegenläufigen Rolltreppe schwebte Münchens Altoberbürgermeister Jochen Vogel, ebenfalls ein leidenschaftlicher U-Bahnfahrer, an ihm vorbei. Man kannte sich, man grüßte sich.
Am Bahnsteig tauchte Otto in die geballte Lebensfreude und Disziplinlosigkeit einer Schulklasse ein. Er konnte gar nicht hinsehen, wie die Vierzehnjährigen sich gegenseitig vor Übermut gefährlich nah an die Bahnsteigkante schubsten. Bot denn hier niemand diesem Treiben Einhalt? Endlich entdeckte er die Lehrerin. Jung, zierlich, freundlich lächelnd, kaum zu finden unter den groß gewachsenen Lümmeln. Drei der Schüler vergnügten sich damit, Papierkügelchen in ihre Anorakkapuze zu werfen. Otto schwoll der Kamm über den Sauhaufen, mit dem die Lehrerin auf Erkundung gehen musste. Mit ein paar schnellen Schritten war er bei den Übeltätern und stellte sie zur Rede. Zwei duckten sich sofort weg.
Der Dritte visierte mit einem Papierkügelchen erneut die Kapuze an und zischte: »He, Alter, das geht dich einen Scheißdreck an.«
Ottos Blut kam in Wallung. Wie eine Dampfwalze schob er sich auf den Jugendlichen zu, drückte ihn mit seinem Bauch an die Wand und sagte leise: »Du klaubst das Papier aus der Kapuze, und zwar sofort, sonst setzt es was.« Der Junge dachte gar nicht daran. Er vollführte eine Seitwärtsdrehung, um Ottos Bauch zu entgehen. Dabei trat er unglücklicherweise auf die eigenen offenen Schuhbänder. Er verlor den Halt, stürzte zu Boden und schlitterte bäuchlings direkt auf seine Lehrerin zu. Begleitet vom johlenden Gelächter seiner Kameraden rappelte er sich hoch.
Was dann geschah, konnte Otto leider nicht weiter verfolgen, da seine U-Bahn eingefahren kam.
Am Odeonsplatz begrüßte ihn die Theatinerkirche in ihrem satten Gelb. Beim Tambosi war jeder Stuhl besetzt. Die Münchner wussten eben, wie man das Leben genießt. Otto verkniff sich einen Tambosi-Espresso. Kaffee würde er bei Desch bekommen. Aber eines musste trotzdem sein. Mit wenigen Schritten stand er vor der Residenz und strich einem der Bronzelöwen, die vor dem Portal Wache hielten, zärtlich über die Schnauze. Das brachte Glück. Und weil alle Münchner an die Glück bringenden Löwen glauben, glänzen ihre Schnauzen mittlerweile in hellem Gold.
Deschs Galerie in der Brienner Straße war in einem frisch restaurierten Jugendstilhaus untergebracht und fiel vor allem durch ihr maßvolles Understatement auf. Nur zwei Bilder waren im Schaufenster zu sehen, natürlich ohne Preisangabe. Ein Bild zeigte eine Maschine-Mensch-Konstruktion, übergroß in eine weiträumige Landschaft gestellt. Entfernt erinnerte sie Otto an den Maler Giorgio de Chirico, die Künstlersignatur sagte ihm jedoch nichts. Als er das zweite Bild eingehend betrachtete, weiteten sich seine Augen. Den Stil kannte er. Der Desch hatte doch tatsächlich einen Kirkeby ergattert. Kein anderer konnte so elegant mit Farben und Formen spielen. Otto trat ein paar Schritte zurück, dann noch einen. Aus der Landschaft wurden mit einem Mal Personen. Wie bei einem Vexierbild. Dieser Däne Per Kirkeby war ein Magier unter den Malern.
Lautes Hupen ließ Otto aufschrecken. Kein Wunder, er stand mitten auf der Brienner Straße. Großzügig übersah er den Stinkefinger, der ihm gezeigt wurde, und schritt hoheitsvoll dem Galerieeingang zu.
»Desch, du krummer Hund, sagst mir nicht, dass du einen Kirkeby hast!«, platzte er heraus, kaum dass er durch die Tür war.
Ottos volltönende Stimme krachte hinein in die vornehme Stille des Raums und rief sofort Barbara Engel auf den Plan.
Sie begrüßte ihn mit gedämpfter Stimme. »Schön, dass Sie da sind, Herr Kriminaloberrat. Herr Desch erwartet Sie bereits. Wenn Sie mir bitte folgen wollen.« Mit langen Schritten ging sie ihm voraus durch die Schauräume.
Otto war das Tempo, das sie vorgab, gar nicht recht. Zu gern hätte er noch einen Blick auf die ausgestellten Bilder geworfen. Außerdem hatte er im Vorbeigehen äußerst interessante Kundschaft entdeckt. Zwei schwarz verschleierte Frauen, bei denen nur die Augen zu sehen waren, betrachteten konzentriert ein Gemälde. Ein junger Mann mit eindeutig arabischem Einschlag lehnte sichtlich gelangweilt an der Wand.
Ein amüsiertes Schmunzeln glitt über Ottos Gesicht. So, so, der Desch hatte Kundschaft aus den Emiraten. Da kam heute ordentlich Geld in die Kasse, und zwar bar auf die Hand.
Desch thronte hinter seinem weißen, geschwungenen Schreibtisch. Auf seinem PC flimmerten Zahlenkolonnen, die er mit einer Tabelle in einer Broschüre verglich. Er klappte sie zu und kam hinter dem Schreibtisch hervor. In kumpelhafter Freundlichkeit ergriff er Ottos Arm und führte ihn zu einer schwarzen Sitzgruppe.
»Schön, dass du da bist, Otto. Dein Espresso kommt gleich. Auch sonst hat Frau Engel, mein guter Stern, alles für dich vorbereitet.« Damit wies er auf den gedeckten Tisch und auf die süßen und salzigen Häppchen.
Eine junge Mitarbeiterin brachte zwei Espressi und verschwand diskret.
Wohlgefällig blickte ihr Otto nach. »Das muss ich dir lassen, nicht nur bei deinen Bildern, auch bei deinem Personal hast du ein geschicktes Händchen.« Er nahm einen Schluck von seinem Kaffee und rückte mit seinem Hinterteil so lange auf dem glatten Leder hin und her, bis es ihm behagte. Ohne Umschweife kam er zur Sache. »Conrad, du weißt, warum ich hier bin. Du sollst mir alles über deine Eibenmalerinnen erzählen. Wie hast du sie kennengelernt? Wo lebten sie? Wie lebten sie? Welchen Freundeskreis hatten sie?«
Auch Desch brachte sich in eine bequeme Sitzposition und schloss für einen Moment die Augen.
Erst jetzt bemerkte Otto, wie müde Desch wirkte. Seine Schultern fielen nach vorn, um die Mundwinkel gruben sich tiefe Falten. Ein müder, alter Mann. Da war nichts mehr von dem schlitzohrigen, lebenslustigen Napoleon vom Ammersee zu erkennen.
Otto war so tief in seinen Betrachtungen versunken, dass er beinahe überhörte, was ihm Desch berichtete.
»Zuerst habe ich Bettina Tauber kennengelernt. Das wird jetzt sieben Jahre her sein. Es war an der Kunstakademie, hier in München. Die Studierenden stellten ihre Jahresabschlussarbeiten aus. Dabei habe ich sie entdeckt. Ich wusste sofort: Das ist eine äußerst begabte Malerin. Schon damals hatte sie ein untrügliches Auge, war in jeder Maltechnik überdurchschnittlich und hatte bereits ihren Stil, ihre Formensprache gefunden.« Desch seufzte tief. »Weißt du, Otto, die musste nicht auf irgendeinen Larifari zurückgreifen, um Aufmerksamkeit zu erzielen. Sie ist – sie war – einfach gut.«
Otto nickte zustimmend. Er war von Bettina Taubers Können ebenfalls beeindruckt. »Deine Kunden haben das wohl auch schnell erkannt?«
Ein schlaues Lächeln nistete sich in Deschs Augen ein. »Gewissermaßen. Du weißt doch, wie das so läuft. Ist ein Künstler bekannt, dann haben seine Werke einen Wert, und der Käufer kann davon ausgehen, dass der Preis noch steigt. Eine gute Geldanlage also.«
Das machte Otto neugierig. »So wie ich dich kenne, heißt das, dass du bei der unbekannten Bettina in die richtige Trickkiste gegriffen hast. Wie ging das?«
Deschs Mundwinkel sanken unwillig nach unten. »Otto, wie derb du doch sein kannst. Nennen wir es lieber Strategie mit viel Psychologie. Ich kenne meine Kunden. Die einen überwachen sorgfältig den Kunstmarkt und erkennen sofort, wenn ein Künstler im Wert steigt. Die suchen eine möglichst gewinnbringende Geldanlage, denen bedeutet das Werk an sich wenig. Ja, und dann gibt es noch die anderen, die sich gern mit schönen Dingen umgeben und natürlich auch das Geld dazu haben.«
Otto nickte ungeduldig. Von dem ganzen Kunstgeschäft verstand er schließlich auch einiges. Er war nicht von ungefähr eine Zeit lang in der Abteilung Kunstraub tätig gewesen. Vorsichtig manövrierte er sich in Deschs Redefluss hinein. »Ich nehme an, für Bettina Tauber hast du einen finanzstarken Schöngeist gefunden.«
Desch nickte zustimmend. »Ja, dieser Käufer schätzt handwerkliches Können. Er spürt genau, ob Werk und Person übereinstimmen. ›In Bettinas Bildern kann ich regelrecht herumspazieren. Immer wieder fallen mir neue Details auf. Ihre Kreativität befruchtet meine Kreativität. Es ist also ein stetes Geben und Nehmen‹, sagte er einmal voll Begeisterung. Das machte es sehr einfach. Er kaufte einige Bilder und hängte sie, das muss ich betonen, äußerst geschickt in seinen Häusern und im Büro auf. Damit wurde Bettina auch für andere Käufer interessant, und die Nachfrage setzte ein. Aber die richtige Wertsteigerung erfolgte erst bei den Ausstellungen. Frankfurt, Köln, Basel, London. In die Tate Modern hatte sie es noch nicht geschafft, aber das ist nur noch eine Frage der Zeit.«
»Bei der Vernissage habe ich mir den Flyer genau durchgelesen«, unterbrach ihn Otto. Desch schien sich zunehmend für einen umfassenden Vortrag zu erwärmen. Dem wollte sich Otto keineswegs aussetzen. »Sie hatte ja sogar schon Ausstellungen in Amerika. Habe ich da nicht Namen wie das Cleveland Art Museum und das Museum of Fine Art in Houston gelesen? Ich bin beeindruckt.«
»Ja, nicht wahr?« Desch quittierte Ottos Einwurf mit einem selbstgefälligen Lächeln. »Das habe ich wirklich gut hingekriegt.«
»Aber wie kommen nun Laura Berger und Verena Bach ins Spiel?«, fragte Otto und konsultierte heimlich seine Uhr. Es war doch immer das Gleiche. Bei Desch konnte man Stunden verhocken. Dazu hatte er heute aber keine Zeit. Die Befragung von Barbara Engel stand ja auch noch an.
Desch setzte sofort wieder eine geschäftsmäßige Miene auf. »Laura ist bei mir seit ungefähr vier Jahren unter Vertrag. An ihrer Begabung und ihrem Können war nichts auszusetzen. Allerdings hatte ich anfangs kein Interesse daran, eine zweite Eibenmalerin zu fördern. Das war Barbara Engels Idee. Immerhin ist sie die Eventmanagerin. Und Lauras Bilder verkaufen sich inzwischen so gut wie die von Bettina. Barbara war es auch, die vor zwei Jahren darauf bestand, Verena Bach mit ins Boot zu holen.«
Otto blickte erstaunt auf. »Wer hat denn in deinem Laden nun das Sagen? Seit wann lässt du dir die Künstler vorschreiben?«
»Marketing. Mein lieber Otto, dafür hat Barbara ein untrügliches Gespür. Ich bin der Talentscout, wenn ich mal die Fußballsprache bemühen darf. Barbara Engel ist für die schlagzeilenträchtigen Inszenierungen zuständig. Aber ich meine, das soll dir am besten Barbara selbst erklären.«
Das war Otto sehr recht und er wandte sich zur Tür. Doch Desch hielt ihn noch einmal zurück: »Wie läuft es denn so mit dir und deiner fränkischen Kollegin? Franken und Oberbayern froh vereint, oder wie Hund und Katz?«
Otto lehnte sich mit einem breiten Grinsen gegen die Tür. »Ich sag es mal so: Eher geht ein arabischer Scheich mit der Lederhose zum Oktoberfest, als dass ein Franke seinen Patriotismus aufgibt. So gesehen sind die Franken die standhaftesten Bayern. Sie wissen es bloß nicht, und wir sagen es ihnen nicht.« Nach einer kurzen Pause setzte er nachdenklich hinzu: »Doch wir brauchen die Franken, gerade solche wie die Renate Wörlein. Blitzgescheit und voller Tatendrang.«
Er blinzelte Desch verschwörerisch zu. »Aber das sagen wir Oberbayern den Franken auch nicht. Sonst kennen die in ihren Forderungen bald überhaupt kein Maß und Ziel mehr.«
Dem stimmte Desch sofort zu und ergänzte: »Und machen uns womöglich noch die Schwaben, die Niederbayern und die Oberpfälzer rebellisch. Diese Kriminaldirektorin ist aber eine Fränkin, die ich gut leiden kann. Sie scheint sich immerhin für Malerei zu interessieren.« Nun klang Bedauern aus seiner Stimme: »Mit dem Bild, das ihr so gefiel, wird es halt jetzt nichts mehr.« Desch kam offenbar ein weiterer Gedanke, denn er hob die Hand und bedeutete Otto, noch zu warten. »Du solltest ihr von der Holzhausener Künstlerkolonie erzählen. Von den Malern der Künstlervereinigung Scholle. Ich denke da an Eduard Thöny, den berühmten Zeichner des Simplicissimus. Zeig ihr die Thöny-Villa am Ammersee. Erzähl ihr von Walter Georgi, der die wunderschönen Holzhausener Alltagsszenen gemalt hat. Und vergiss nicht, sie zum Brunnenbuberl am Stachus zu führen. Das ist ein Werk des Bronzegießers Matthias Gasteiger.«
Beim Reden war Desch an sein Bücherregal getreten und hielt Otto nun ein Buch hin. »Da, das schenkst du der fränkischen Renate. Es ist ein Buch über die Maler der Scholle. Und wenn ihr euch sowieso beruflich am Ammersee herumtreibt, solltest du sie zur Gasteiger-Villa führen und mit ihr zum Holzhausener Friedhof hinaufwandern. Dort sind viele Maler der Scholle begraben.«
Otto Fechter war ganz gerührt. Diese fürsorgliche Seite war ihm an Desch neu. Renate schien bei ihm einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben.
Mit dem Buch in der Hand machte er sich auf den Weg zu Barbara Engels Büro. Dabei zog er kurz Bilanz: Drei anerkannte Malerinnen. Zwei hatten es sogar in den hochpreisigen Bereich geschafft, die dritte konnte zumindest gut von ihrer Kunst leben, was nur wenigen Künstlern gelang. Die beiden erfolgreichen Malerinnen waren tot. Was steckte dahinter?
»Ja, wo kommen wir denn da hin! So geht das nicht. Machen Sie das etwa beim Zahnarzt auch so?«
Otto hatte bereits den Zeigefinger zum Klopfen gekrümmt. Interessiert ließ er die Hand nun sinken. Durch die Tür war aufgeregtes Gemurmel zu hören.
»Ganz richtig. Wenn Sie Zahnschmerzen haben, rufen Sie beim Zahnarzt an und vereinbaren einen Termin. Und bei uns machen Sie das gefälligst auch so.« Schneidend wie ein Schwert drang Barbara Engels Stimme nach draußen. Mit derselben scharfen Klinge schnitt sie ihrem Gesprächspartner das Wort ab. »Nein, Herr Desch hat jetzt keine Zeit. Nein, auch nicht für nur drei Bilder.«
Das Gemurmel bekam einen flehenden Unterton, dem Barbara Engel energisch ein Ende setzte. »Hier, ich habe Ihnen den Termin aufgeschrieben. Nein, nein, früher geht es nicht.«
Die Tür ging auf und ein junger Mann schob sich an Otto vorbei. Sein Gesicht wurde von der Künstlermappe, die er fest an sich drückte, halb verdeckt. Es war ein junges Gesicht. Ein Gesicht mit maßlos traurigen Augen. Otto sah mitleidig hinterher, als der junge Mann in Richtung Ausgang schlurfte.
Gramgebeugt legte der Künstler die Hand auf den Griff der Eingangstür. Doch dann straffte er die Schultern, blickte zurück und schrie: »Ja, dann leck mich doch am Arsch, du ungefickte alte Krähe.«
Mit einem leisen Plopp fiel die Tür ins Schloss, und Otto löste sich aus seiner Erstarrung.
»Das müssen Sie nicht so ernst nehmen, der kommt wieder, spätestens in sechs Wochen.«
Barbara Engel stand in der weit geöffneten Bürotür und strahlte Otto mit einem breiten Lächeln an. »Sie müssen wissen, Kunst kommt bisweilen von Können, aber Kunst und Kinderstube – ja, da sind wir des Öfteren auf zwei unterschiedlichen Planeten zu Hause. Ach, was soll’s.« Sie wies einladend in ihr Büro. »Nehmen Sie Platz. Herr Desch hat mich bereits vorgewarnt, dass Sie mich noch befragen werden.«
Otto versank in einem weißen Ledersessel und gestattete sich einen schnellen Rundblick. Eine Wandseite wurde von einem mächtigen Bücherregal beherrscht. Überwiegend schien es sich um kunsthistorische Werke zu handeln. Aber zwei Regalmeter wiesen klar erkennbar Literatur aus dem Wirtschaftsbereich auf.
Barbara Engel war seinem Blick gefolgt. »So, jetzt kennen Sie auch meine Ausbildung: Kunstgeschichte und Betriebswirtschaft.« Mit einem verhaltenen Seufzer setzte sie hinzu: »Allerdings glaube ich, Herr Deschs untrüglicher Blick für Kunst ist für mich unerreichbar. Selbst wenn ich mich alt und grau studiert hätte.«
Jetzt hatte Otto einen Einstieg in das Gespräch gefunden. Er verlagerte den Oberkörper leicht nach vorn und legte die Hände zwischen die Knie. »Sie sind für das Marketing zuständig. So hat es mir Conrad erzählt. Was muss ich denn darunter verstehen?«
Barbara Engel schlug entspannt ihre langen schlanken Beine übereinander.
Otto musterte sie wohlgefällig von oben bis unten. Sie trug einen schwarzen Samtblazer mit einem Dekolleté, das mehr Fragen aufwarf, als sie zu beantworten, zu einem schwarz schimmernden Satinrock über hauchzarten schwarzen Nylonstrümpfen mit Naht. Die waren ihm sofort ins Auge gestochen, als sie ihn durch die Ausstellungsräume geführt hatte. Otto konnte sich gar nicht mehr daran erinnern, wann er zum letzten Mal Strümpfe mit Naht zu Gesicht bekommen hatte. Hoch erotisch.
Bei Frauen bewunderte er das attraktive Äußere aus voller Seele, was aber bis jetzt nicht dazu geführt hatte, auch bei sich für ein Mindestmaß an Attraktivität zu sorgen. Gerade Renate ließ nichts unversucht, ihn von einem modischeren Outfit und den Vorteilen einer Gewichtsabnahme zu überzeugen. Doch ihre diesbezüglichen Vorschläge hörten sich an wie eine Frontalattacke auf seine Lebensfreude, eine Liste des reinen Verzichts und der abscheulichsten Zumutungen. Von allem weniger und von vielem, was ihm besonders gut schmeckte, nichts.
Das konnte und wollte er nicht. Lieber richtete er sich nach der Ansicht seines Vaters. Was macht einen Mann für eine Frau anziehend? Das hatte der ihn in einem ihrer seltenen Vater-Sohn-Gespräche gefragt und gleich selbst mit der Antwort aufgewartet: Geld, Macht und Einfluss. Das ist für Frauen das Erotischste überhaupt an einem Mann. Dafür sehen sie über eine Glatze, ein künstliches Gebiss oder eine Wampe großzügig hinweg.
Auf Macht und Einfluss war Otto nicht erpicht. Dazu fehlte ihm der Ehrgeiz. Aber das ordentliche finanzielle Polster, das sein Vater zu Lebzeiten angehäuft hatte, war ihm sehr willkommen. Es freute ihn zu sehen, wie es sich durch geschickte Geldanlagen quasi von selbst vermehrte. Er war wohlhabend und hätte es eigentlich gar nicht nötig, seine Zeit beim LKA zu vergeuden.
Er sah zu, wie Barbara Engel eine Strähne ihres schwarz gelockten Haares verspielt um den Finger wickelte. Eine attraktive Erscheinung. Wie alt mochte sie wohl sein? Er schätzte sie auf Mitte vierzig. So um den Dreh herum. Aber das Schönste an ihr waren ihre großen grünen Augen. In ihnen versank er nun – ohne Haltegriff und Schwimmhilfe. Wie konnte er es nur anstellen, Barbara Engel dezent davon in Kenntnis zu setzen, dass er zumindest eines der Dinge besaß, die Männer so anziehend und erotisch machten?
Was hatte sie gesagt? Nur mühsam konnte er den letzten Satz rekapitulieren. »Wenn Desch von einem Künstler überzeugt ist, dann schlägt meine große Stunde. Dann plane ich punktgenau die Vermarktungsstrategien.« Ja, so hatte sie es gesagt.
»Aha. Bei den drei Eibenmalerinnen sind Sie demnach auch so verfahren.« Otto räusperte sich gründlich. Irgendwie klang ihm die eigene Stimme plötzlich so nichtssagend, so ausdruckslos im Ohr.
»Davon können Sie ausgehen.« Barbara Engel nickte. »Herr Desch hat Ihnen sicher gesagt, dass er auf keinen Fall drei Eibenmalerinnen wollte. Aber da musste ich mich einfach durchsetzen. Drei ist eine magische Zahl, und die drei Malerinnen habe ich wie ein Gesamtkunstwerk konzipiert.«
»Ach was, das geht einfach so?« Ottos Gesicht war ein einziges Fragezeichen. »Waren denn die Malerinnen mit dieser Art von Vermarktung einverstanden?«
»Nicht unbedingt. Nein, eigentlich gar nicht. Zu Anfang musste ich schon mit Engelszungen reden. Besonders bei Bettina.« Ihre Augen verdüsterten sich, und ein harter Zug schlich sich in die Mundwinkel. Dann lachte sie auf. »Nomen est omen – Engel – Engelszungen. Das ist eben mein Metier. Darin bin ich Meisterin. Andere für eine Idee zu begeistern.«
Davon war Otto mittlerweile rundum überzeugt. »Wie sah die Strategie nun genau aus?«
»Schauen Sie, wenn Desch mir grünes Licht gibt, dann läuft bei mir ein ganzes Szenario ab. Die drei Malerinnen konnten mit ihrem Können überzeugen. Zunächst bei der Debütantenausstellung in der Kunstakademie und drei Jahre später beim BBK.«
Otto nickte. Er kannte sich aus. Für ihn war BBK nicht nur das Kürzel einer Krankenversicherung. Desch hatte ihn schon mehrfach mitgenommen in das Untergeschoss des Völkerkundemuseums. Dorthin lud der Bund der Bildenden Künstler junge, Erfolg versprechende Künstler etwa drei Jahre nach ihrem Examen ein. Sie durften ihre aktuellen Arbeiten vor einem anspruchsvollen Publikum präsentieren. So mancher Künstler wurde danach von einem Galeristen unter die Fittiche genommen. Die Verträge mit Bettina Tauber, Laura Berger und Verena Bach waren demnach auf die gleiche Weise zustande gekommen.
»Das ist der Zeitpunkt, ab dem es für den Galeristen teuer wird«, fuhr Barbara Engel fort. »Die Bilder müssen gezeigt werden. Nicht nur hier in den Schauräumen. Köln, Basel, London, dort sind die angesagten Messen. Wir bezahlen Unsummen für unsere Kojen.«
Otto lehnte sich zurück und blickte diskret auf die Uhr. So ein Arger aber auch. In einer Stunde hatte er einen Termin in der Maillingerstraße. Stundenlang könnte er dieser Barbara zuhören. Ihr Enthusiasmus war regelrecht ansteckend. Ihm fiel aber auch die Zielstrebigkeit auf, mit der sie ihrer Arbeit nachging. Er konnte sich gut vorstellen, dass so mancher Künstler davon überfordert war. Deshalb fragte er: »Lief es mit den drei Malerinnen denn so glatt, wie Sie es sich vorgestellt hatten?«
Barbara Engel lächelte amüsiert. »Ich sehe schon, Sie dringen schnell zu den wesentlichen Informationen vor. Speziell mit Bettina und Verena musste ich tatsächlich mehrfach ein deutliches Wort sprechen. ›Mädchen‹, habe ich gesagt, ›ihr müsst euch persönlich präsentieren. Und genau so, wie ich es plane.‹ Ich habe für die Messeauftritte die Kleidung ausgesucht und gekauft. Alle Dialoge habe ich mit ihnen durchgekaut. ›Merkt euch eines‹, habe ich immer gesagt: ›Der Käufer, der Sammler hat immer recht. Und wenn er im Bild Heidelbeeren sieht, dann sind es eben Heidelbeeren. Und wenn er in seinem Auftragsbild einen Arsch sehen will, dann malt ihm doch Arsche rein.‹«
Otto war verblüfft. »Das ließen die Malerinnen mit sich machen?«
»Laura schon. Laura musste ich gar nichts erklären, die hatte ihr Image virtuos ausgebaut. Verena zeigte zwar guten Willen, war aber doch sehr unbeholfen. Man sah ihr den oberfränkischen Dorftrampel noch ein wenig an. Aber Bettina. Ach Bettina. Die war nur glücklich, wenn sie hinter ihrer Staffelei stand.«
»Was ist daran auszusetzen? So stelle ich mir eine Künstlerin vor. Ohne Not muss die auch keine Ärsche reinmalen, wenn ich das so drastisch wiederholen darf.« So ein Tralafitti hatte doch eine wie Bettina Tauber gar nicht nötig. Und das sollte gutes Marketing sein? Otto befielen größte Zweifel.
Barbara Engel konnte seiner Mimik und Gestik offenbar die richtigen Informationen entnehmen. Das schien eine ihrer großen Stärken zu sein. Jedenfalls suchte sie jetzt seriöses Terrain. So kam es Otto zumindest vor.
»Ich gebe Ihnen ein Beispiel, damit Sie verstehen, mit welchen Schwierigkeiten ich es teilweise zu tun habe. London, die Kunstmesse Frieze Art Fair, letztes Jahr im Oktober.« Barbara Engels Gesicht glühte vor Stolz. »Von den Organisatoren der Messe wurden die drei zu einem Künstlergespräch eingeladen. Das ist etwas ganz Besonderes, eine Ehre für die Malerinnen und auch für unsere Galerie. Insgesamt verlief das Gespräch hervorragend. Die internationalen Kunstkenner waren begeistert. Anschließend standen unsere Malerinnen noch für weitere Interviews in unserer Koje bereit. Wir hatten eine extra große organisiert. Fragen Sie nicht, was uns das gekostet hat. Unsummen. Bei Laura und Verena lief es gut. Eigentlich nur, weil Laura dabei war. Die beherrschte den Künstlerjargon wie keine Zweite. Sie hatte auch Verena gut im Griff. Bei den beiden lief es also ganz ordentlich. Aber Bettina.«
Barbara Engel verdrehte ihre Augen himmelwärts. »Ein Bild der Verzweiflung. Sie stand da wie ein Stück Holz. Ihre Antworten beschränkten sich auf: ›Warum nicht? – Vielleicht. – Wenn Sie das sagen. – Das könnte man durchaus so sehen.‹ Dann, nach etwa einer Stunde, trat sie einen Schritt nach vorne und verkündete in voller Lautstärke: ›Schluss jetzt, die Affenfütterung ist vorbei, der Zoo ist geschlossen‹ Sie verschwand und ging in ihr Hotel. Wir hatten so ein Glück, dass sie es auf Deutsch sagte. So verstanden viele der Besucher, die überwiegend aus England und Amerika kamen, ihren ungezogenen Satz nicht. Als ich sie am nächsten Tag zur Rede stellte, antwortete sie mir tatsächlich: ›Der ganze Bohei geht mir am Arsch vorbei.‹ Stellen Sie sich das mal vor, Herr Fechter. Da müht man sich ab, setzt alle Hebel in Bewegung, und dann kommt das. Für mich war Bettina eine ausgesprochen schwierige Künstlerin.«
Noch über ihren Tod hinaus wurde Otto diese Bettina immer sympathischer. Betont beiläufig stellte er nun seine wichtigste Frage.
»Frau Engel, wo waren Sie eigentlich am Samstag in der Zeit zwischen zwei Uhr nachts und fünf Uhr morgens?«
»Sie meinen die Zeitspanne, während der Bettina und Laura ermordet wurden?« Barbara Engel wirkte keineswegs überrascht. »Das Fest endete nach dem Feuerwerk, also bald nach Mitternacht. Eine knappe Stunde später waren dann wirklich alle Gäste abgefahren. Mit dem ganzen Aufräumen hatte ich nichts mehr zu tun. Dafür haben wir hervorragend geschultes Personal. Ich denke, spätestens gegen ein Uhr bin auch ich gefahren.«
»Wohin?«
Nach München zurück. In meine Wohnung im Lehel. Wissen Sie, das brauche ich dann dringend. Nach so einem Trubel will ich niemanden mehr hören oder sehen. Es war kaum Verkehr. Ich glaube, um kurz nach zwei lag ich schon im Bett.«
»Kann das jemand bezeugen?«
»In der Tiefgarage und im Lift habe ich niemanden getroffen. Ich lebe allein.« Barbara Engel hob bedauernd die Schultern. »Ich befürchte, ich habe niemanden, der mein Alibi bezeugen könnte.«
Das hatte Otto insgeheim befürchtet. Das Alibi war nicht einmal ein Fingerschnippen wert. Und was war mit Desch? Himmel, den hatte er noch gar nicht nach seinem Alibi gefragt! Das musste er sofort nachholen. Er verabschiedete sich und kündigte an, noch einmal kurz bei Desch vorbeizuschauen.
Barbara Engel nahm das zum Anlass, ihm schnell noch einen Zettel in die Hand zu drücken.
»Geben Sie den bitte Herrn Desch. Dann kann er gleich den Termin für den jungen wilden Künstler in seine Agenda eintragen.«
Barbara Engel blieb im Türrahmen stehen und blickte Otto Fechter nachdenklich hinterher. Mit Männern kannte sie sich aus und wusste meist schon auf den ersten Blick, was von dem einen oder anderen zu halten war. Doch dieser Fechter ließ sich nicht so einfach einordnen. Er war zwar auf ihre dezent gesetzten erotischen Botschaften sofort angesprungen, aber nicht mit der Intensität, die sie erwartet hatte.
Es wurde ihr immer klarer, dass sie ihn nicht unterschätzen durfte. Von Kunst und vor allem vom Kunstmarkt verstand er mehr, als er im Gespräch mit ihr hatte durchblicken lassen. Das war ihr schon während der Vernissage an ihm aufgefallen. Ein unbedeutender Nebensatz, das Verharren vor einem Gemälde in einer bestimmten Pose, das Vorschieben der Unterlippe. Sie kannte sich aus mit der subtilen Körpersprache von Kunstkennern und Menschen im Allgemeinen und konnte sie mittlerweile treffsicher interpretieren. Otto Fechter vermittelte auf den ersten Blick den Eindruck eines gutmütigen Teddybären im ausgebeulten Trachtenanzug, der mit freundlichen dunklen Augen harmlos in die Welt schaute. Als er aber Deschs pompöser Selbstinszenierung überhaupt keine Aufmerksamkeit schenkte und dafür umso intensiver die anwesenden Gäste studierte, schrillten bei ihr die Alarmglocken.
Keine Sorgen machte sie sich dagegen um seine weibliche Begleitung, diese Kriminaldirektorin Wörlein. Von Kunst verstand die so gut wie nichts. Das war ihr nach wenigen Augenblicken klar geworden. Wenn sie ihr Eindruck nicht trog, waren sie im Team gleichberechtigt. Wer hatte denn nun das Sagen, doch nicht dieses unbedeutende Nichts von einer Frau? Ohne Schuhe würde sie ihr nicht einmal bis zur Schulter reichen. Zugegeben war ihr Gesicht mit den hellblauen Augen ganz hübsch, wenn man auf ungeschminkte Frauen stand. Aber sonst? Ein Landei im braven schwarzen Kostüm, mehr auch nicht. Wieso hatte ausgerechnet sie diese Position beim LKA? Hatte sie sich etwa durch diverse Betten nach oben geschlafen? Irgendwie war das wenig wahrscheinlich, bei dem unscheinbaren Aussehen. Möglicherweise brauchten sie eine Quotenfrau, damit die Geschlechterbilanz stimmte. Genau, das passte zu ihr. Das war eine, der es rein um die Karriere ging. Solche Frauen kannte sie zur Genüge. Mangelnde Fähigkeit verstanden sie hinter Effizienz und Sachorientierung zu verbergen. Mit meterdicken Scheuklappen liefen sie durch die Welt und kriegten nur das mit, was für die Karriere förderlich war. Von ihr drohte keine Gefahr.
Dagegen war bei Fechter allergrößte Vorsicht geboten. Auf keinen Fall war er ein Polizist, den man mit weiblicher Raffinesse locker um den Finger wickeln konnte.
***
Auf dem Weg zu Deschs Büro dachte Otto Fechter immer noch über Barbara Engels Alibi nach, das keinen Pfifferling wert war. Er hasste es, wenn Frauen, die ihm gefielen, in Schwierigkeiten steckten. Da war er ganz parteiisch.
Bevor er an Deschs Tür klopfte, warf er rasch einen Blick auf den Zettel, den Barbara Engel ihm mitgegeben hatte. Darauf stand der Termin für den jungen Künstler. Kein Wunder, dass der Bursche so ausfällig geworden war. Erst in sechs Wochen durfte er seine Werke präsentieren. Das war ja schlimmer als ein Facharzttermin bei den gesetzlichen Krankenkassen. Neben dem Datum waren vier kryptische Buchstaben vermerkt: c. n. e. p.
Otto klopfte und trat auch sofort ein.
Desch hob den Kopf und starrte ihn entgeistert an.
»Also, ihr vom LKA müsst Zeit ohne Ende haben. Du bist ja immer noch da. Was hast du so lange bei meinem Engel gemacht?«
»Ermittelt.«
Otto verschanzte sich hinter einer undurchdringlichen Miene. Einem Pokerface, wie er hoffte. Er kam heran und stützte beide Hände auf Deschs Schreibtisch.
»Conrad, ich habe dich noch gar nicht gefragt, was du nach dem Fest gemacht hast.«
»Ich hab mich ins Bett gelegt.«
»Wo und mit wem? Kann das jemand bezeugen?«
»Wie jetzt? Im Schlafanzug lass ich mich bei niemandem blicken. Da bin ich eigen. Na, in der Villa am Ammersee habe ich doch meine eigene kleine Wohnung mit Salon, Bad und Schlafzimmer. Da hat mich keiner gesehen. Und wenn einer auf getaucht wäre, dem hätte ich glatt den Kopf abgerissen. Männer in meinem Alter möchten nach Mitternacht ihre Ruhe haben.«
Das leuchtete Otto zwar ein, aber aus ermittlungstechnischer Sicht war es ein einziges Desaster. Er erinnerte sich zudem wieder an das Vernissagepublikum. Einige waren darunter gewesen, die er für sich sofort unter die Ganovenrubrik einsortiert hatte. Natürlich war der Weilheimer Kollege Jan Altinger mit der Überprüfung der gesamten Gästeliste befasst, trotzdem schadete es nicht, selbst auch einen Blick darauf zu werfen. Es ging ihm nur um zwei oder drei Typen. Deshalb bat er Desch um eine weitere Kopie der Gästeliste.
Conrad Desch holte sie aus einem Ordner und behielt sie noch einen Augenblick nachdenklich in der Hand.
»Mit dem sturen Hund von der Weilheimer Kripo war nicht zu reden, der hat mich gestern behandelt wie einen Schwerverbrecher. Von verschiedenen Kunden, die auch bei der Vernissage waren, habe ich mittlerweile Ähnliches gehört. Aber von dir kann ich hoffentlich mehr Taktgefühl erwarten.«
»Gesetzestreue Bürger behandle ich wie Kronjuwelen. Auf deiner Vernissage habe ich aber ein paar fragwürdige Visagen entdeckt.«
Mit mäßigem Interesse erkundigte sich Desch: »Wen zum Beispiel?«
»Das fällt mir schon wieder ein, wenn ich die Namen lese.«
»Otto, ich dreh keine krummen Dinger, das weißt du. Ansonsten bin ich Geschäftsmann. Für die Integrität meiner Kunden bin ich weiß Gott nicht verantwortlich.«
Otto griff nach der Liste und holte den Zettel von Barbara Engel aus der Tasche seines Trachtenjankers. Er schob ihn über den Schreibtisch. »Das soll ich dir von deinem Engelchen noch geben.«
Desch betrachtete die Botschaft, ein wissendes Lächeln glitt über sein Gesicht.
Otto war das nicht entgangen. Interessiert lehnte er sich über den Schreibtisch. »Habe ich jetzt etwa einen verschlüsselten Liebesbrief von Tür zu Tür getragen, oder was hat es mit den vier geheimnisvollen Buchstaben auf sich?«
»Otto, in Liebesdingen gehen Engelchen und ich getrennte Wege. Wir haben aber eine Wette laufen, und zwar, wer bei der Künstlerbeurteilung den richtigen Riecher hat. Also, wo Daumen rauf oder wo Daumen runter. Jeder gibt dabei sein spontanes Gutachten ab.«
»Sag bloß, das macht ihr über die vier Buchstaben?« Otto war jetzt wirklich neugierig.
»Cacatum non estpictum ist die Langform von c.n.e.p.«, deklamierte Desch mit gelangweilter Miene.
Otto zog indigniert die Augenbrauen hoch. »Cacatum … Ich krieg es jetzt zwar nicht mehr genau zusammen, aber in meinen Ohren hört es sich ausgesprochen schmutzig an. Habe ich recht?«
Desch nickte beifällig: »Hingeschissen ist noch nicht gemalt, heißt das. Also Daumen runter.«
Um seinen nächsten Termin einzuhalten, musste Otto nun doch ein Taxi in die Maillingerstraße nehmen. Was war bei der Befragung herausgekommen? Die Galerie Desch spielte im ganz hohen Preissegment mit. Aber das wusste er bereits. Barbara Engel, die Marketingkünstlerin, führte ein hartes Regiment, doch der Erfolg gab ihr recht. Ihr Alibi konnte man jedoch vergessen. Das war nicht einmal so viel wert wie das Schwarze unterm Fingernagel. Ebenso verhielt es sich mit dem von Desch. Schade. Beides bedauerte er.
Barbara Engel hatte es fertiggebracht, dass sein Herz bei ihrem Anblick bis zum Hals schlug. Er trug sich sogar mit dem Gedanken, sich einen neuen Trachtenanzug auf Maß schneidern zu lassen, der seine üppige Leibesmitte charmant überspielte. So weit war er für eine Frau selten gegangen. Mit Desch, dem schrulligen Eigenbrötler, fühlte er sich dagegen irgendwie seelenverwandt.
FÜNF
Trotz der sommerlichen Temperaturen fröstelte es Verena Bach. Zwei Eibenmalerinnen waren tot. Sie dagegen lebte. Eng schlang sie den flauschigen Bademantel um sich und wärmte die eiskalten Hände an der heißen Teetasse. Laura und Bettina waren tot. Im Briefkasten die Botschaft. Nur drei Sätze. Böse und bedrohlich: »Totholz. Sieh dich vor. Bald bist auch du totes Holz.«
Waren wirklich alle Fenster geschlossen und die Tür verriegelt? Sie stand auf und machte erneut einen Rundgang durch das Haus.
Bettinas Haus. Ein altes Bauernhaus am Ortsrand von Paterzell. Sie hatte es vor Jahren gekauft, damit sie nah am Eibenwald sein konnte. Bettina war keine arme Künstlerin. Sie stammte aus einem reichen Elternhaus und konnte einfach dort ein Haus kaufen, wo sie es wollte. Sie war aber auch großzügig. Laura und sie selbst durften bei ihr wohnen, wann immer und so lange sie wollten. Auch das Atelier, zu dem Bettina das gesamte obere Stockwerk hatte ausbauen lassen, benutzten sie nun schon seit Jahren gemeinsam.
War eigentlich die Tür zum Atelier verschlossen? Sie konnte sich auf einmal nicht mehr daran erinnern. Verena Bach stieg die knarrende Holztreppe hinauf und drückte die Türklinke nach unten. Offen. Ein bestialischer Gestank schlug ihr aus dem schmalen Spalt entgegen. Weiter ließ sich die Tür nicht öffnen. Irgendein Hindernis schien sie zu blockieren. Sie warf die Tür ins Schloss, drehte den Schlüssel um und raste die Treppe hinunter. Dabei stolperte sie über den Saum des Bademantels und stürzte. Atemlos rappelte sie sich wieder auf, rannte zurück in die Küche und verschloss die Tür.
***
Es war zwei Uhr nachmittags, als Renate am Ortseingang von Paterzell ihr Auto hinter dem Wagen der Weilheimer Kommissarin Amire Önar einparkte. Sie stieg aus und ging auf den schwarzen Golf zu.
In diesem Augenblick schwang die Fahrertür auf, eine schwarzlockige junge Frau setzte zackig ihre Füße auf die Erde und kam ihr mit einem strahlenden Lächeln entgegen.
»Servus. Ich bin die Amire, Amire Önar, Ich hab Sie glei wiederkennt im Rückspiegel, Frau Direktorin Wörlein. Ihre Vorträge über Motivanalysen, da war ich fei dabei.«
Renate schüttelte Amires Hand. »Wörlein genügt. Aber erklären Sie mir bitte, warum Sie so lupenrein den oberbayerischen Zungenschlag beherrschen.«
Amire lachte. »Das will jeder als Erstes von mir wissen. Alle erwarten nämlich von mir astreines Kanakendeutsch, sobald sie mich sehen und meinen Namen hören. Dann legen die gleich los mit Fragen wie ›Du verstehen Deutsch?‹ oder ›Woher du kommen?‹ und so.« Sie lachte wieder. »Ja mei. Ich bin halt pfeilgrad das gelungene Integrationsbeispiel.«
Erneut ließ sie ihr ansteckendes Lachen erklingen.
Renate stimmte herzlich mit ein. »Sie sind sich Ihrer außergewöhnlichen Wirkung auf andere aber schon bewusst, oder? Bei Ihrem durch und durch orientalisch anmutenden Aussehen mit den rabenschwarzen Haaren, den dunklen Augen und der braunen Haut überraschen Sie jeden, wenn Sie den Mund aufmachen und im schönsten oberbayerischen Dialekt reden.«
»Ja freilich. Ich kann schon Hochdeutsch, aber mir taugt es halt, wenn die anderen baff sind«, antwortete Amire mit einem lustigen Augenzwinkern und wurde gleich darauf ernst. »Das mit der Integration ist aber nicht immer einfach. Ich denke noch an meine Zeit als Umläuferin. Vor allem im Streifendienst wurde mir nichts geschenkt, und zwar von meinen eigenen Landsleuten. Gerade die jungen männlichen Türken sparten nicht mit gemeinen Beschimpfungen wie Bullenhure, Polizistenschlampe, Polizeifotze oder Schlimmerem.«
Über Amires Gesicht glitt ein trüber Schatten, den sie mit einem Lächeln sofort wieder wegwischte. »Inzwischen hat sich das geändert. Jetzt werde ich sogar bewundert und gefragt, wie ich es geschafft habe, bei der deutschen Polizei arbeiten zu dürfen.«
Renate kannte ähnliche Beispiele und vermutete deshalb: »Ich nehme an, hauptsächlich haben Sie das dem liberalen Denken und dem Integrationswillen Ihrer Eltern zu verdanken.«
Amire nickte zustimmend und griff nach einem Schnellhefter auf dem Rücksitz ihres Autos. »Hauptkommissar Altinger hat mir gesagt, Sie möchten die Informationen, die ich bis jetzt über Verena Bach zusammengetragen habe.«
Renate überflog die erste Seite. Dann klappte sie den Hefter zu. »Am liebsten würde ich gleich mit ihr persönlich sprechen. Sie wissen, wo sie wohnt?«
»Klar. Ich war gestern bei ihr. Fahren Sie mir einfach nach.«
Renate stieg wieder in ihren Wagen und folgte dem schwarzen Golf ein enges Sträßlein entlang. Sie kamen an blühenden Gärten vorbei und hielten bald darauf an einem kleinen Anwesen am Rand des Eibenwaldes.
Amire stand schon an der Haustür und läutete, als Renate erst noch das Auto verschloss und nachkam.
Amire läutete erneut. Niemand öffnete, und sie sah Renate verwundert an. »Ich habe Frau Bach heute Vormittag angerufen, weil ich sowieso noch einmal mit ihr sprechen wollte. Da sagte sie, sie würde den ganzen Tag hier sein. Seltsam. Gehen wir doch um das Haus herum. Vielleicht ist sie im Garten.«
Doch dort war niemand. Sie traten auf die bucklige Terrasse und schauten durch die kleinen Sprossenfenster der Terrassentür in ein Wohnzimmer mit rehbraunen Polstermöbeln. Von Verena Bach war nichts zu sehen. Die Hintertür war verschlossen, und sie kehrten wieder zur Haustür zurück. Amire läutete erneut, diesmal mit einer Hartnäckigkeit, dass Renate allein vom Zuschauen schon selbst der Daumen wehtat.
Sie spähte durch die Scheibengardinen am Fenster neben der Haustür. Täuschte sie sich oder hatte sie im Hintergrund nicht doch eine schattenhafte Bewegung wahrgenommen?
»Ich glaube, da drinnen ist jemand, läuten Sie weiter«, flüsterte sie Amire zu. Dann, ein wenig später: »Hören Sie mit dem Läuten auf. Ich habe ein Geräusch gehört.«
Nichts. Stille.
Amire wurde es offenbar zu dumm. Sie donnerte mit der geballten Faust gegen das Türblatt und rief: »Frau Bach, machen Sie doch auf. Wir sind es, Kripo Weilheim.«
»Frau Önar?«, fragte zaghaft eine leise Stimme hinter der Tür.
»Ja. Ich bin es. Amire Önar und Frau Wörlein.«
Die Haustür wurde von innen aufgeschlossen. In dem schmalen Spalt, den die Länge der Sperrkette zuließ, tauchte ein bleiches Gesicht auf. Verena Bach. Sie entfernte die Kette und öffnete die Tür.
Renate erschrak, als sie das verstörte Gesicht der jungen Frau im Bademantel sah. Das rote Haar stand strähnig und unordentlich vom Kopf ab. Dunkle Schatten lagen um ihre Augen, die Lippen schimmerten bläulich blutleer. Mit der bildschönen Frau im azurblauen Kleid, die auf Deschs Vernissage einer der Glanzpunkte gewesen war, hatte sie nur noch entfernt Ähnlichkeit.
»Um Himmels willen, Frau Bach, was ist denn los?«
»Ich weiß nicht. Ich fürchte mich.« Verena Bach taumelte.
Renate griff zu und packte sie fest um die Taille. Schritt für Schritt führte sie die junge Frau in die Küche und setzte sie auf einen Stuhl.
Aus ihrer Handtasche holte sie das Kreislaufmittel hervor, das sie für sich immer dabeihatte, und sah sich in der Küche nach Zucker und Löffel um. Auf einen Teelöffel voll Zucker träufelte sie einige Tropfen.
»Mund auf und runter damit«, befahl sie Verena Bach, »dann hinlegen.«
Widerspruchslos fügte sich die junge Frau. Sie ließ sich in das Wohnzimmer führen und auf das Sofa betten. Die Decke, die Renate über sie breitete, zog sie eng um die Schultern und schloss die Augen. Tränen quollen unter ihren geschlossenen Lidern hervor, und sie flüsterte: »Ich fürchte mich so schrecklich. Der Brief.«
Renate griff nach ihrer Hand, die sich eiskalt anfühlte, und fragte: »Was für ein Brief?«
»Küchentisch. Umschlag.«
Amire, die gespannt zugehört hatte, stand sofort auf, um sich auf die Suche zu machen.
Renate rief ihr hinterher: »Schauen Sie doch bitte gleich noch nach, ob Sie was zu essen auftreiben, und vor allem Kaffee.«
Kurz darauf kam Amire zurück. In der einen Hand, die sie mit einem Stück Küchenpapier abgedeckt hatte, hielt sie den Umschlag, in der anderen eine Tüte Cracker. Sie legte den Umschlag vor Renate auf den Tisch und sagte: »Ich weiß nicht, wovon die Frauen sich ernährt haben. Ich habe jedenfalls nur diese Cracker gefunden. Der Kaffee ist gleich so weit.«
Während Amire abermals in die Küche ging, streifte sich Renate Latexhandschuhe über. Sie griff nach dem Brief und musterte zunächst eingehend den Umschlag. Nichts. Keine Adresse, keine Briefmarke. Demnach könnte ihn der Schreiber selbst in den Briefkasten geworfen haben. Sie zog das Stück Papier aus dem Umschlag und las die kurze Botschaft.
Erschreckt weiteten sich ihre Augen. »Wann kam der Brief?«
Verena wandte ihr das tränenverschmierte Gesicht zu. »Ich weiß nicht. Ich habe erst heute Mittag in den Briefkasten geschaut. Da habe ich ihn gefunden.«
Amire kam mit drei Tassen Kaffee herein und stellte sie auf den Tisch. Dabei warf sie Renate einen fragenden Blick zu.
Die winkte sie zu sich heran und hielt ihr das Blatt hin. »Nur lesen, nicht anfassen. Ich nehme den Brief mit und lasse ihn im LKA-Labor auf mögliche Spuren untersuchen. Vielleicht gehört der Schreiberling zu denen, die zum Zukleben Briefumschläge abschlecken. Auf alle Fälle muss er ihn selbst eingeworfen haben. Theoretisch könnte er das wohl schon letzte Nacht getan haben, nicht wahr, Frau Bach?«
Verena Bach nickte stumm.
Nachdem auch Amire die knappe Botschaft gelesen hatte, fragte sie: »Frau Bach, wer könnte das geschrieben haben? Hatten Sie mit jemandem Streit? Vielleicht mit einem anderen Künstler? Gibt es einen Verehrer, den Sie abgewiesen haben? Denken sie nach. Wir müssen in alle Richtungen ermitteln.«
Verena Bach schüttelte stumm den Kopf. Sie setzte sich auf, griff nach der Kaffeetasse und trank einen Schluck. Abermals rollten Tränen über ihre Wangen, und sie schluchzte: »Ich will hier weg. Ich fürchte mich. Da oben im Atelier stimmt was nicht. Die Tür geht nicht auf, und es stinkt furchtbar.«
Alarmiert stellte Amire ihre Tasse auf den Tisch und erhob sich. »Ich schau nach, was da oben los ist.«
Auch Renate stand auf. »Das möchte ich mir ebenfalls ansehen.«
»Ich bleibe hier nicht allein«, jammerte sofort Verena Bach. »Ich komme mit.«
Zu dritt stiegen sie die Holztreppe hinauf.
Amire, die als Einzige bewaffnet war, entsicherte ihre Heckler-Koch. Sie schloss die Tür auf und drückte mit dem Ellbogen dagegen. Sofort spürte sie den Widerstand. Sie warf sich mit ganzer Kraft gegen das Türblatt. Renate griff mit ein. Zusammen gelang es ihnen endlich, die Tür so weit zu öffnen, dass man hineinsehen konnte. Im Raum war niemand. Es herrschte jedoch ein heilloses Durcheinander. Ekelerregender Gestank nach ranziger Butter und Erbrochenem schlug ihnen entgegen. Amire trat ein paarmal kräftig gegen die Tür. Endlich gab sie so weit nach, dass sie hineinschlüpfen konnte. Nun zeigte sich auch, warum die Tür so schlecht aufging. Ein schwerer Tisch stand dahinter. Sie wuchtete ihn zur Seite und ließ die anderen herein.
Verena Bach schrie auf und wollte in den Raum laufen.
Doch Renate hielt sie zurück. »Bleiben Sie, wo Sie sind. Sagen Sie uns einfach, was Ihnen auffällt.«
»Alle unsere Bilder sind weg, sogar das eine von Bettina, das halb fertig auf der Staffelei stand.«
»Wann waren Sie das letzte Mal im Atelier, und wann haben Sie zuletzt alle Bilder gesehen?«
Verena Bach überlegte kurz. »Am Sonntagnachmittag. Da bin ich mir ganz sicher. Ich hab nämlich an einem meiner Bilder weitergearbeitet, bis mir das Licht zu schlecht wurde. Es könnte sechs Uhr am Abend gewesen sein, als ich aufgehört habe. Danach habe ich mich noch durch die Fernsehprogramme gezappt und bin gegen zehn ins Bett gegangen.«
»Gut. Das genügt zunächst, Frau Bach. Wir gehen wieder nach unten.« Renate wandte sich an Amire. »Informieren Sie Ihre Weilheimer Kollegen. Wir brauchen sofort die KTU. Sagen Sie ihnen auch, dass Buttersäure versprüht wurde.«
Amire rief Jan Altinger an und gab ihm einen kurzen Überblick über die neue Sachlage. Danach schnitt sie eine jammervolle Grimasse. »Es dauert doch noch einige Zeit, bis die von der KTU hier sind. Inzwischen sterbe ich vor Hunger. Wenn es Sie nicht stört, Frau Wörlein, würde ich gern eine Kleinigkeit zum Essen besorgen.«
»Keineswegs. Sollte Ihnen dabei eine Leberkässemmel über den Weg laufen, dann bringen Sie die bitte für mich mit. Oder besser zwei«, fügte Renate mit einem Blick auf Verena Bach hinzu.
Mit einem beschwingten »Passd scho« wirbelte Amire davon.
Renate sah ihr verblüfft hinterher. »Passd scho« hatte sie gesagt. Wenn sie das P noch einen Hauch weicher ausgesprochen hätte, wäre ein typisch fränkisches »Bassd scho« daraus geworden. Dann musterte sie Verena Bach streng und befahl: »Sie gehen jetzt unter die Dusche und ziehen sich ordentlich an. Sobald Frau Önar zurück ist und wir eine Kleinigkeit gegessen haben, machen wir einen Spaziergang. Der ist gut für den Kreislauf und bringt Sie auf andere Gedanken. Außerdem dürfen wir der KTU nicht im Wege herumstehen.«
SECHS
Renate fielen die winzigen Veränderungen an Verena Bach auf, als sie nebeneinander den Weg durch den Eibenwald entlanggingen. Je tiefer sie in den Wald eindrangen, desto verschlossener wurde ihr Gesichtsausdruck. Auch ihre Körperhaltung wirkte zunehmend angespannter. Ruhelos schoss ihr Blick hin und her, dazwischen drehte sie sich immer wieder unvermittelt um. Sie hatte Angst, aber wovor? Vor wem? Der Eibenwald war an diesem späten Montagnachmittag wie ausgestorben, keine Menschenseele weit und breit.
»Erzählen Sie doch, wie Sie die beiden anderen Malerinnen kennengelernt haben.«
Verena Bach schreckte aus ihren Gedanken hoch. »Wie bitte?«
»Wie haben Sie Bettina Tauber und Laura Berger kennengelernt?«
»Beim Eibenmalen im Wald.«
»Hier? An welcher Stelle genau?«
Verena Bach schüttelte den Kopf. »Nicht hier. In einem anderen Eibenwald. Er ist in der Nähe von Gößweinstein, aber das sagt Ihnen sicher nichts. Ein kleiner Ort in Oberfranken.«
»Und ob mir das etwas sagt, zumindest Gößweinstein. Das ist ein berühmter Wallfahrtsort in der Fränkischen Schweiz. Die Basilika trägt ganz die Handschrift ihres genialen Baumeisters Balthasar Neumann. Ich komme aus Nürnberg. Da gehört das zum fränkischen Grundwissen. Bei Gößweinstein gibt es also auch einen Eibenwald?«
»Ja. Er ist auf den ersten Blick nicht so eindrucksvoll wie dieser hier. Die Bäume sind nicht so imposant, denn sie sind nicht so alt. Aber er ist auf andere Weise schön. Man muss ihn sich selbst erschließen, dann sieht man seinen Zauber. Das sind die Eiben vor den schrundigen Felswänden aus Dolomitgestein.« Verena Bach strebte einem umgefallenen Baumstamm zu und ließ sich darauf nieder.
Renate setzte sich dazu und betrachtete nachdenklich die alte Eibe vor sich mit den ringförmig in den Stamm gehackten Löchern und den Wülsten.
Verena Bach war ihrem Blick gefolgt. »Das ist die Spechteibe. Und sehen Sie dort drüben den umgefallenen Eibenstamm, aus dem nun die Äste senkrecht nach oben wachsen? Eine Eibe gibt nicht auf. Sie duckt sich unter dem hohen Blätterdach der Buche oder des Ahorns und schmiegt sich eng an sie an. Oder sie verwächst mit einer anderen Eibe wie mit einem Ehepartner. Eiben sind gesellig. Ich liebe diese Bäume. Sie sind meine Freunde. Sie inspirieren mich. Besonders Bettina fühlte ähnlich wie ich. Laura suchte an den Bäumen eher die extreme Form, das Außergewöhnliche.«
Ihr Blick strich über den am Boden liegenden Stamm, aus dem die Zweige trotzig nach oben strebten. »Wir begegneten uns zufällig im Gößweinsteiner Eibenwald. Ich saß schon an meiner Staffelei vor der Felswand, als sie zu mir heraufstiegen. Das könnte bald fünf Jahre her sein. Genau. Ich war zweiundzwanzig. Ich hatte mein Studium an der Nürnberger Kunstakademie beendet und arbeitete an einer Kunstmappe, die ich bei verschiedenen Galerien vorlegen wollte.«
»Wovon lebten Sie denn in dieser Zeit?«, hakte Renate interessiert nach.
»Hauptsächlich von meinen Eltern. Ich hatte zwar ein paar Nebenjobs, aber sonst lebte ich von der Unterstützung meiner Eltern. Peinlich, oder?«
»Bei meinen Kindern war das in dem Alter nicht anders. Glücklicherweise stehen sie jetzt auf eigenen Beinen. Meine Tochter ist einunddreißig und gerade dabei, mich zur Großmutter zu machen. Sie ist im vierten Monat schwanger. Heutzutage ist das in dem Alter nur normal. Ich war neunzehn, als ich sie bekam, und schaffte gerade noch mit Ach und Krach vor der Geburt das Abitur.«
Renate sagte das im lockeren Ton so dahin, dabei war die Zeit keineswegs locker abgelaufen. Mit neunzehn Jahren schwanger von einem Mann, der selbst kaum für seinen Lebensunterhalt aufkommen konnte – der Ärger in ihrem Elternhaus war perfekt gewesen. Vom ersten Tag an war Florian bei ihren Eltern unten durch gewesen. Er war zehn Jahre älter und hatte als Architekt immer noch nicht Fuß gefasst. Ein Versager. Wäre da nicht seine Mutter gewesen, Renates heutige Schwiegermutter. Eine Frau voll Tatkraft und Pragmatik. Sie sah sich wieder mit ihr zusammen auf der Terrasse des Hauses sitzen, in das sie gebeten wurde, als ihre Schwangerschaft Florians Mutter zu Ohren gekommen war. Charlotte stellte ihr mit abschreckender Direktheit, die eher einem Verhör glich, ihre Fragen: Liebst du Florian? – Ja. – Willst du das Kind bekommen? – Ja. – Du wolltest doch zur Polizei. Willst du das immer noch? – Ja. – Gut, dann packen wir es zusammen an. Auf Charlotte war von dieser Stunde an Verlass gewesen. Sie war stets zur Stelle, wenn sie gebraucht wurde, ganz im Gegensatz zu Renates eigenen Eltern. Bei denen standen immer die eigenen Bedürfnisse im Vordergrund. Rund um die Welt wollten sie. Etappe für Etappe hatten sie alle Länder rund um den Globus bereist, kannten alles. Unbekannt blieben ihnen allerdings ihre Enkel. Jetzt beklagten sie sich, dass kein Hahn nach ihnen krähte.
Renate betrachtete die junge Frau an ihrer Seite mit gemischten Gefühlen. Die Denkweise von Künstlern war ihr unbekannt. Deshalb fragte sie: »Wieso wollten Sie unbedingt Malerin werden?«
»Ich fühlte mich dazu berufen. Ich hatte Talent, das wurde mir schon früh gesagt. All die Einwände meiner Eltern, das sei eine brotlose Kunst, schlug ich selbstverständlich in den Wind. Auch die Tatsache, dass nur ein kleiner Prozentsatz an Künstlern allein von der Kunst leben kann, interessierte mich nicht. Ich wusste es besser. Ich war beseelt von meiner Berufung zur Künstlerin und überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis mir der große Wurf gelingt und damit der Durchbruch zum Erfolg.«
»Das ist Ihnen doch gelungen. Mit Ihren siebenundzwanzig Jahren können Sie schon eine beachtliche Karriere aufweisen.«
Verena beugte sich hinunter und riss einen Grashalm aus. Sie wickelte ihn um den Finger, streifte ihn wieder ab und warf ihn fort.
»Das habe ich nur Bettina Tauber zu verdanken. Als sie sah, dass ich mich auch mit Freskomalerei beschäftigte und eine gewisse Virtuosität in der Illusionismusmalerei entwickelt hatte, wie man sie aus dem Barock kennt, hat sie mir einen Auftrag gegeben. Ich durfte vor zwei Jahren einen der Ausstellungsräume der Tauber-Schmuckgalerie in Nürnberg illusionistisch ausgestalten. Die gehört ihr nämlich, ebenso wie die in München und die andere in London. Stellen Sie sich vor, sogar in Dubai hat sie eine.«
Verena Bach machte eine ehrfurchtsvolle Pause, die Renate nicht unterbrach. Sie wartete ab und hörte dann, als Verena Bach weitersprach, aufmerksam zu.
»Die hat sie von ihrem Vater geerbt. Geleitet werden die Schmuckgeschäfte aber von ihrem Cousin, Bernd Tauber. Der war so begeistert von meiner Raumgestaltung, dass er auch das Geschäft in London von mir ausgestaltet haben will. Ich könnte jederzeit anfangen. Frau Wörlein, ich muss weg von hier. Ich habe Angst. Darf ich weg?«
Trotz des kindlich naiven Tons in der Frage und des hoffnungsvollen Blicks musste Renate ablehnen. »Das geht nicht, Frau Bach. Wir brauchen Sie hier in Deutschland für unsere Ermittlungen. Ich werde aber mit Hauptkommissar Altinger sprechen, ob wir Sie nach Hause fahren lassen können, nach Gößweinstein.«
»Darüber wäre ich froh. Hier kenne ich doch niemanden, bei dem ich unterkriechen könnte. Ich fürchte mich so in Bettinas Haus.«
»Wir finden für Sie schon eine Lösung«, beruhigte Renate sie. »Aber noch einmal zurück zu Bettina Tauber: Durch sie begann also Ihre Karriere?«
»Richtig. Sie selbst war mit ihren Werken schon längst bei der Galerie Desch und hatte auch Laura Berger hingebracht. Desch hat sich meine illusionistische Raumgestaltung angeschaut und auch meine anderen Arbeiten. Er wollte wohl wissen, was ich sonst noch auf dem Kasten habe. Meine Installationen haben ihm sehr gut gefallen, besonders ›Totholz‹ und ›Eibenelegie‹. Deshalb war ich bei der Vernissage nicht mit meinen Bildern, sondern mit den Installationen vertreten. Desch hat ein Gespür für Qualität und fördert nur jemanden, der seinen handwerklichen Kriterien entspricht. Ich bin froh, dass ich bei seiner Galerie bin. Bei ihm fühle ich mich gut aufgehoben.«
»Wie war Ihr persönliches Verhältnis zu Bettina Tauber und Laura Berger?«
»Zu beiden gut.« Verena Bach überlegte. »Mit Bettina war ich vielleicht noch vertrauter. Sie war eine außergewöhnliche Frau, sie ruhte in sich selbst. Der ganze Kunstmarktrummel ließ sie kalt. Als sie voriges Jahr zusammen mit Laura beim Ranking des Kunstkompasses in der Zeitschrift Capital auf Platz eins kam, hat sie nur ironisch gelacht.«
»Und Laura Berger?«
Verena Bach schmunzelte in Erinnerung an die Reaktion der glücklichen Laura. »Vor Stolz war sie ganz aus dem Häuschen und richtete zur Feier des Tages ein riesengroßes Besäufnis aus. Wir haben förmlich in Champagner gebadet. Ich weniger, Alkohol ist nicht mein Ding. Wissen Sie, Frau Wörlein, was mir damals durch den Kopf gegangen ist? Bettina war als Mensch so unabhängig von der Meinung anderer, weil sie auch finanziell unabhängig war. Die Kriterien, die hinter dem Ranking stehen, haben sie überhaupt nicht interessiert. Fragen, etwa in dem Sinn, in welchem Museum sie ausgestellt hat, mit welchem Galeristen sie zusammenarbeitet, welcher Kritiker über sie schreibt oder welche Preise sie bekommen hat, waren ihr egal. Sie wollte nur in Ruhe malen und zwar das, was ihr gefiel. Nicht das, was das Publikum unbedingt wollte.«
»Bei Laura Berger sah das wohl anders aus?«, hakte Renate Wörlein nach.
»Na klar. Das war doch wie ein Ritterschlag. Ihre Bilder waren auf einmal viel Geld wert. Sie erregten Aufmerksamkeit. Endlich konnte sich Laura ein wenig Luxus leisten.«
»Erzählen Sie mir von Laura. Sie war mit ihren dreiunddreißig Jahren zwei Jahre jünger als Bettina Tauber. Wie war sie so?«
»Ja, wie war sie wirklich?« Grübelnd strich sich Verena Bach übers Kinn. »Temperamentvoll, extrovertiert, sprühend vor Ideen. Handwerklich hervorragend, sonst hätte Desch sie nicht genommen, und ein wenig glamourös. Sie inszenierte sich mit ihren Bildern gleich mit. Warum auch nicht? Ein Künstler braucht Aufmerksamkeit. Das sagt Barbara Engel immer. Leider bin ich eher wie Bettina. Mir liegt das auch nicht. Frau Engel hat deswegen mit Bettina und mir öfter geschimpft. Sie hat gesagt, gut sei das, was sich durchsetzt. Dafür müsse ein Künstler auch über den eigenen Schatten springen und sein Ego bezwingen. Das künstlerische Ego stünde dem Publikumsgeschmack nur im Wege.«
»Laura hatte mit dem Ablegen ihres Egos also kein Problem«, spitzte Renate das Thema zu.
Verena Bach warf ihr einen unwilligen Seitenblick zu. »Sie dürfen das nicht so negativ sehen. Laura machte die glamouröse Seite des Kunstmarktes einfach Spaß. Zusammen mit Frau Engel überlegte sie nach dem Ranking, wie sie sich gemeinsam mit Bettina vermarkten könnte. Frau Engel brachte eine blonde Perücke mit und stülpte sie Laura über ihr braunes Haar. Uns fiel sofort auf, wie ähnlich Laura und Bettina nun aussahen. Ab dem Tag färbte Laura ihr Haar in das gleiche Blond um, wie Bettina es hatte. Frau Engel kam dann noch auf die Idee, dass beide bei den Events die gleichen Kleider tragen sollten, wenn sie gemeinsam auftraten.«
»Wie fand Bettina das?«
»Schrecklich. Sie hat es nur für Laura gemacht.«
»Noch eine Frage: Mit wem waren die zwei zusammen, wen hatten sie zum Freund oder zur Freundin?«
Verena Bach saß zusammengekrümmt auf dem Baumstamm. Das Haar fiel ihr ins Gesicht. Sie strich es hinters Ohr und sah Renate an. »Frau Önar hat mich das auch gefragt. Ich mag ungern darüber reden. Das ist doch alles viel zu persönlich. Es war deren Angelegenheit.«
»Bei Mord kann darauf leider keine Rücksicht mehr genommen werden. Reden Sie.«
Verena Bach setzte sich gerade hin. »Na gut. Bettina war mit ihrem Automechaniker zusammen.«
Sie hielt inne, als sie Renates überraschten Gesichtsausdruck wahrnahm.
»Ja. Mit ihrem Automechaniker. Was ist daran so ungewöhnlich? Ihm gehört die Werkstatt, die immer für sie den Kundendienst machte. In der Landsberger Straße in München. Frau Önar hat sich alles aufgeschrieben.«
»Sie mögen es vielleicht anders sehen, aber mir kommt es trotzdem ungewöhnlich vor, dass eine bekannte und wohlhabende Künstlerin ausgerechnet mit ihrem Automechaniker liiert ist. Wie kam das?«, fragte Renate interessiert nach.
»Bettina saß stundenlang bei ihm und sah ihm bei seiner Arbeit zu. Es hat sie fasziniert. In ihren Augen war er ein Künstler. Der Zusammenhang von Mensch und Maschine hat sie sehr interessiert. Sie hat auch ein paar Skizzen gemacht. Ich habe sie gesehen. Die waren technisch zwar gut, aber noch nicht ausgereift. Der geniale Funke hat gefehlt.«
»Ach so. Das war dann kein Liebesverhältnis.« Aus Renates Stimme war Enttäuschung herauszuhören.
»Doch. Sie liebte ihn wirklich. Er liebte sie auch, und er liebte ihre Kunst. Über ihren künstlerischen Erfolg konnte er sich von Herzen freuen. Außerdem war er einfach da, wenn sie ihn brauchte. Er erdete sie.«
»Aha.«
Darüber musste Renate Wörlein noch nachdenken. Mit dem Mechaniker würde sie so schnell wie möglich sprechen.
»Und wie sah es bei Laura Berger aus? Mit wem war sie befreundet?«
»Ich habe Ihnen doch erzählt, dass sie ganz anders war als Bettina. Extrovertiert, sprühend vor Energie und Lebensfreude. Sie zog immer einen Rattenschwanz von Verehrern hinter sich her.«
»Wen zum Beispiel?«
»Maler, Musiker, Fotografen, Käufer ihrer Bilder. Was weiß ich?« Verena Bach zuckte mit den Achseln.
Allein bei dieser vagen Aufzählung drehte es Renate schier den Magen um. Bei Laura Berger schienen sich persönliche Motive ins Uferlose zu häufen. Das konnte heiter werden. Sie probierte es mit Namen, die ihr im Augenblick einfielen. »Hatte sie was mit Conrad Desch, dem Galeristen?«
Belustigt lachte Verena Bach auf. »Mit Desch? Nie im Leben. Desch hat nie was mit Frauen. Möglicherweise ist er schwul, aber sicher weiß ich das nicht.«
»Mit Sebastian Klenk, dem Fotografen?«
»Ja, schon. Aber nichts Ernstes.«
»Machen Sie bitte für uns eine Liste der Personen, die mit den beiden Malerinnen Umgang pflegten.« Renate sah auf die Uhr. »Wir müssen zurückgehen. Hauptkommissar Altinger hat sicher noch einige Fragen an Sie.«
Auf dem Rückweg durch den Eibenwald musterte Renate Verena Bach immer wieder von der Seite. Bis jetzt hatte sie noch keine klare Vorstellung von ihr, konnte sie nicht richtig einordnen. Durch das lange Gespräch schien sie sich aber emotional ein wenig stabilisiert zu haben. Sie fragte: »Wann haben Sie Bettina und Laura auf der Vernissage zuletzt gesehen?«
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Neuausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2013
- ISBN (eBook)
- 9783942822602
- DOI
- 10.3239/9783942822602
- Dateigröße
- 2.3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2013 (Mai)
- Schlagworte
- Paterzell Paterzeller Eibenwald Nürnbergkrimi oberfranken oberbayern Gößweinstein krimi mord regionalkrimi kunstszene giftmord künstler künstlerinnen ritualmord