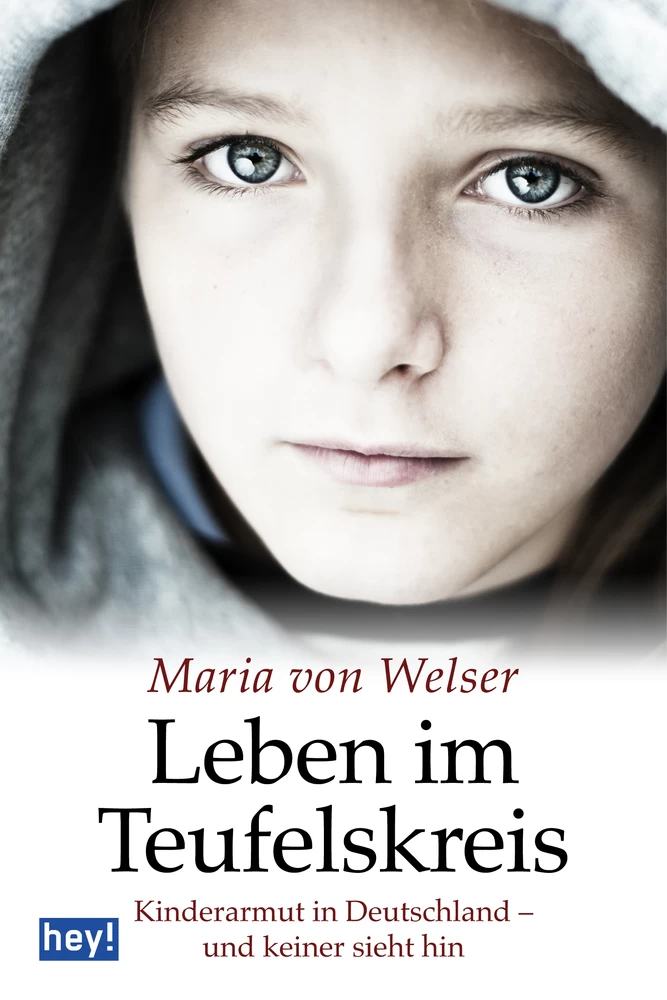Leben im Teufelskreis
Kinderarmut in Deutschland - und keiner sieht hin
Zusammenfassung
Maria von Welser widmet sich einem heiklen Thema. An ergreifenden Beispielen zeigt die engagierte Journalistin das wachsende Elend armer Kinder in Deutschland. Mit ihrem aufrüttelnden Buch will sie dazu beitragen, dass Politik und Gesellschaft handeln: damit auch die Schattenkinder eine Perspektive für die Zukunft haben.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt – und verfügt im statistischen Vergleich mit anderen europäischen Staaten über die höchste Anzahl an Kindern, die unter dem Existenzminimum leben. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren, deren Eltern Hartz IV beziehen oder durch andere staatliche Sozialleistungen unterstützt werden müssen, weil das Einkommen für den Lebensunterhalt einer Familie nicht ausreicht.
Das ist eine Schande!
Gerne wird von Vertretern des Familienministeriums betont, dass diese Zahlen zurückgehen. Reicht das aus? Das sogenannte Bildungspaket mit 700 Millionen Euro ist beispielsweise bis heute nur zur Hälfte abgerufen. Die Anträge sind oft zu kompliziert, die Hürden für viele Menschen zu hoch.
Die internationale Kinderrechtsorganisation UNICEF fordert, dass Kindern Verfassungsrechte eingeräumt werden. Alle Staaten der Welt – mit Ausnahme der USA, dem Südsudan und Somalia – sind mit der Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention von 1990 die Verpflichtung eingegangen, Kinder zu schützen und ihren Anspruch auf Bildung, passende Kleidung und eine ausreichende und ausgewogene Ernährung zu sichern.
Dennoch leiden und sterben jedes Jahr weltweit Millionen Kinder an Unterernährung oder Vernachlässigung. Und nicht nur in Krisengebieten und Entwicklungsländern, sondern auch in den sogenannten Wohlstandsnationen – wie Deutschland.
Warum?
Weil sie beispielsweise als Pflegekinder bei drogensüchtigen Pflegeeltern landen und an Methadon geraten. Kinder wie Jessica, Lara Mia und Chantal. Weil Jugendämter angesichts der Vielzahl von Fällen der Fürsorge oftmals nicht ausreichend nachkommen können. Weil Kinder missbraucht werden, in den meisten Fällen im familiären Umfeld. Weil sie frieren, hungern und keinen Zugang zu Bildung und sozialen Kontakten haben – Bildung und Freizeit kosten Geld. Geld, das arme Familien fürs Überleben brauchen.
Wenn Kinder Verfassungsrechte hätten, müsste so etwas nicht passieren. Dann gäbe es Kläger und Richter, die diese Rechte verteidigen und den Kindern den Respekt zukommen lassen, den sie verdienen.
Dieses Buch handelt von drei Kindern im Norden Hamburgs, die ich ein Jahr lang begleiten durfte. Geschrieben habe ich ihre Geschichte 2008 – das Thema hat aber bis heute (leider) nicht an Relevanz verloren. Im Gegenteil. Es sind immer noch zu viele. Das ist und bleibt eine Schande.
Einleitung – Drei Kinder stellvertretend für fast drei Millionen
Ein Jahr mit Vanessa, Melanie und Kevin. Drei Kinder in einer großen deutschen Stadt, stellvertretend für alle, die in diesem Land von Hartz IV leben. Ich habe die Kinder ein Jahr begleitet. In der Schule, auf dem Weg nach Hause, im Tanzkurs und vor allem im BOOT, einem Mittagstisch für Kinder, die zu Hause kein warmes Essen bekommen. Ich habe ihre Namen verändert, sie so beschrieben, dass sie nicht wiedererkannt werden können. Aber alles, was diese drei Kinder in dieser Geschichte erleben, ist tatsächlich passiert. Die drei sind keine Einzelschicksale. Nein – über drei Millionen Kindern geht es wie ihnen. Drei Millionen von rund 10,5 Millionen Kindern unter 14 Jahren in Deutschland.
Das hat wenig damit zu tun, dass die Welt von einer Wirtschaftskrise ohnegleichen geschüttelt wird. Nein, die Zahl der Kinder, die von Hartz IV lebt, steigt an, seit 2005 die Zusammenlegung von Arbeitslosengeld und Sozialhilfe eingeführt wurde. Schon damals warnte der Deutsche Kinderschutzbund vor einem Ansteigen der Kinderarmut. Zu Recht. Seitdem ist jedes sechste Kind in diesem Land von Sozialleistungen abhängig.
Ihnen stehen rund 200 Euro monatlich zu. Ein allein lebender Mensch erhält laut Tabelle 856 Euro monatlich, eine Familie mit zwei Kindern bekommt 1798 Euro. Aber weder der Single noch das Elternpaar sind der Normalfall, wenn ich hier in diesem Buch über Kinderarmut schreibe: Die meisten dieser Kinder wachsen bei Alleinerziehenden auf.
Davon sind es zu 95 Prozent die Mütter, die mit ihren Kindern in dieser Situation allein gelassen werden. Dazu steigt die Zahl der so genannten »Aufstocker«-Menschen, die mit ihrem meist halbtags verdienten Lohn ihren Lebensunterhalt nicht mehr finanzieren können. Also auch wieder überwiegend Frauen. Wenn der Kinderzuschlag von aktuell 140 Euro nur um zehn oder 20 Euro steigen würde, dann könnten 700.000 Aufstocker-Familien aus dem Hartz II-Bezug geholt werden, rechnet der Kinderschutzbund vor.
Kinderarmut ist ein Skandal! Aber wer regt sich wirklich auf? Wer tut etwas dagegen – wirkungsvoll und nachhaltig? Es sind ein paar Bücher erschienen in den letzten beiden Jahren, auch einige wenige Dokumentarfilme in ARD und ZDF gesendet worden, auch wissenschaftliche Untersuchungen gibt es – aber geändert hat sich nichts. Dabei ist alles bekannt, nachlesbar, aber wohl nicht nachzuvollziehen. Oder nicht nachzufühlen?
Schotten wir uns alle ab, wollen wir nicht wahrhaben, dass es Kinderarmut hier in unserem reichen Land und nicht nur in den so genannten Ländern der Dritten Welt gibt? Egal welche Regierung an der Macht ist, schwarz-rot oder rot-grün – dem Thema »steigende Kinderarmut« hat sich seit 2004 noch keiner ernsthaft zugewandt. Die Frauen-, Jugend- und Familienministerin Ursula von der Leyen ist sich der Dramatik bewusst. Immerhin. Doch auch sie gesteht mir in diesem Buch:
»Ich glaube, ein tiefes Gefühl der Ohnmacht und der Hilflosigkeit lässt viele verstummen.«
2009, zehn Monate nach dem Beginn der Weltwirtschaftskrise, wird in Deutschland gewählt. Da geht es um die zum Jahresende auf fünf Millionen geschätzten Arbeitslosen, sie streiten um den Gesundheitsfonds, um den Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan oder die Milliarden-Rettungsschirme für Banken. Einige Politiker äußern sich provokant über den Missbrauch der Gelder für Hartz IV-Empfänger. Ein Aufschrei beim Thema Kinderarmut? Fehlanzeige.
Dabei haben mal wieder in Deutschland Richter die Entscheidungen von Politikern gerade gerückt: Was braucht ein Kind?
Wie viel Geld benötigt eine in finanzielle Not geratene Familie tatsächlich? Das Urteil des Bundessozialgerichtes vom Januar 2009 zu den umstrittenen Hartz IV-Regelsätzen macht mehr als 1,5 Millionen Kindern in Deutschland Hoffnung. Das Gericht sieht vor allem einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes als gegeben an. Dass Kinder nur 60 Prozent des Regelsatzes von Erwachsenen bekommen sei »nicht ausreichend begründet«. Jetzt ist noch das Verfassungsgericht gefragt und wird wohl die Regelsätze für Kinder neu berechnen müssen.
Dabei riskieren wir in Deutschland nicht mehr und nicht weniger als die Zukunft unseres Staates, wenn wir uns nicht um die Chancen aller Kinder in diesem Land intensiv bemühen.
Erstaunlicherweise scheint es viele Menschen hier nicht wirklich zu berühren, wenn sie von Kinderarmut hören. Offensichtlich können sie sich das nicht vorstellen. Aber wenn schon das Mitgefühl fehlt, dann sollten wir unseren Verstand und unser ökonomisches Denken einschalten. Denn es geht um existenzielle Fragen: Welches Land kann es sich wirklich leisten, rund drei Millionen Kinder als benachteiligte Randgruppe aufwachsen zu lassen? Inzwischen gibt es Familien, die in der dritten Generation von Sozialgeld leben und dabei immer mehr verelenden. Auf der anderen Seite sehen Politiker tatenlos zu, jammern, wir bekämen zu wenige Kinder, wir würden vergreisen und eines Tages könnten die noch vorhandenen wenigen Kinder die Renten für die ältere Generation nicht mehr erwirtschaften. Adieu Generationenvertrag.
Die traurige Wahrheit aber lautet: Menschen ohne Arbeit und in Armut geben stets aufs Neue ihre Armut weiter. Sie scheint erblich, wenn auch nur im übertragenen Sinn: Ein Teufelskreis, den es dringend zu durchbrechen gilt.
Denn wir brauchen jeden jungen Menschen. Gut ausgebildet und engagiert. Wir werden es uns nicht leisten können, eine wachsende Schar Hartz IV-Empfänger zu ernähren. Wer das erkannt hat, muss handeln, kann nicht die Augen weiter verschließen und so tun, als ginge das alles den Staat nichts an.
Wir wissen es alle: Die Zahl der Geburten ist in den vergangenen 40 Jahren dramatisch gesunken. Sie hat sich beinahe halbiert. Die Zahl der Schulabgänger sinkt seit 2007 jährlich um rund 200.000 Kinder. Auf der anderen Seite fehlen Jahr für Jahr mehr Fachkräfte. Zum ersten Mal konnten 2008 die freien Ausbildungsplätze in der Wirtschaft nicht besetzt werden. Ausgebildete junge Menschen werden also zu einem kostbaren Gut. Wir müssen sie fördern und alles tun, damit sie eine Chance und eine Zukunft in diesem Land haben. Statt fehlender Empathie dann eben Rationalität.
Bei der Recherche zu diesem Buch ist mir etwas Erstaunliches aufgefallen, was ich so nicht erwartet hatte: Die meisten der Kinder, die mir im vergangenen Jahr begegnet sind, sind mutig und voller Zuversicht. Sie sind stark, möchten sich wehren und ihre Lebenssituation verbessern. Wer wie ich von außen kommt und bei den kostenlosen Mittagstischen in einer deutschen Großstadt am Rande zusieht, wundert sich. Selbstbewusst und fröhlich kommen hier die meisten der täglich bis zu 100 Kinder an, die fast alle nicht gefrühstückt haben und jetzt heißhungrig zum Mittagessen anstehen.
Dabei sind sie zugleich Weltmeister im Verbergen ihrer privaten Lebenssituation. Schützen ihre Eltern, ihre Väter und Mütter wo es nur geht. Jugendämter sind erst mal Feinde. Die Mitarbeiter müssen sich ganz schön bemühen, wollen sie das Vertrauen dieser Kinder gewinnen. Was aber dringend erforderlich ist – sonst können sie nicht wirklich helfen. Denn gerade diese Helfer stehen sofort am Pranger, wenn ein Kind verhungert aufgefunden wird, wenn vermeintlich wieder mal die Gesellschaft versagt hat. Hier fehlen eindeutig noch weitere Netzwerke, die im Vertrauen mit den Kindern frühzeitig – als Frühwarnsystem – schwierige und gefährliche Situationen für die Kinder erkennen und so größere Dramen verhindern.
Wenn dieses Buch von drei Kindern berichtet, die von Sozialgeld leben, dann geht es dabei vordergründig nicht um Hunger. Sicher auch darum – weil die meisten kein Frühstück bekommen, kein Geld haben, um für die Pause etwas zu kaufen. Es geht auch um die Gesundheit dieser Kinder. Fachärzte berichten, dass sich allein am Gesundheitszustand der Kinder der Grad der Armut exakt messen lässt. Je weniger Geld eine Familie zur Verfügung hat, umso häufiger leiden die Kinder an Asthma oder Neurodermitis. Sie sind meist zu dick, sie hören, sehen und sprechen schlechter oder nässen ein. Eine weitere alarmierende Zahl belegt, dass 13,8 Prozent aller armen Kinder in ihrer geistigen Entwicklung beeinträchtigt sind. In den vermögenderen Schichten der Gesellschaft sind es 0,8 Prozent. Eltern, die keine Arbeit haben und von Sozialgeld leben, bringen ihre Kinder weniger häufig zum Arzt. Auch weil sie die zehn Euro Praxisgebühr nicht haben oder weil sie in der eigenen Verzweiflung so gefangen sind, dass sie die Krankheiten und Nöte ihrer Kinder übersehen.
Und keiner schreit auf in diesem Land? Fünf Milliarden Euro gibt der Staat jährlich für »Hilfen zur Erziehung« aus. Das Geld geht an Kinderheime, Pflegefamilien und Beratungsdienste. Aber wenn wir uns mehr um Kinder aus ärmeren Familien kümmern würden, könnten von diesem Geld ohne große Probleme mehr Kindertagesstätten und Ganztagsschulen gebaut werden. Denn drei Viertel aller Kinder, die vom Jugendamt dauerhaft in Pflegefamilien untergebracht werden, kommen aus Familien, die vom Sozialamt unterstützt werden. Die Hälfte aller Kinder in Pflegefamilien wurde vorher von einem Elternteil allein betreut. Noch einmal: zu 95 Prozent sind es die Mütter. Es kommt aber noch dicker: Eltern, die von Hartz IV leben, haben keinen Anspruch auf Ganztagsbetreuung in einem Kindergarten oder Hort. Die Begründung haben sich Bürokraten fernab jeglicher Lebenswirklichkeit ausgedacht: die Eltern seien ja zu Hause und nicht berufstätig. Aber gerade diese Kinder aus »bildungsferneren« Schichten brauchen die fördernde Ganztagsbetreuung dringender denn alle anderen.
Wir alle, jeder von uns, kann etwas tun. Und wenn es nur einmal in der Woche ist, dass man bei einer »Tafel« hilft, Lebensmittel zu verteilen. Oder einen Tag im Monat in einem Kinderzentrum mit den Kindern malt oder bastelt. Ich habe im Kinderzentrum BOOT mittags sehr oft Frauen getroffen, die mit den fremden Kindern erst zu Mittag essen und ihnen dann nachmittags in den Lernzimmern bei den Hausaufgaben helfen. Ihre eigenen Kinder sind aus dem Haus, sie wollten etwas »Sinnvolles« tun, und sind glücklich und zufrieden diesen Kindern zu einer besseren Schulnote zu verhelfen.
Schulnoten, Schule, Bildung: Das sind ohnehin die Schlüsselworte, wenn man diesen Kindern eine Zukunft ermöglich will.
Die niedersächsische Bischöfin Margot Käßmann fordert darum auch vehement im Gespräch mit mir für dieses Buch: »Lehr- und Lernmittelfreiheit muss eine Grundbedingung in unserem Land sein.«
Dazu bedarf es im ganzen Land der Ganztagskindergärten, kostenlos, mit Mittagessen für die, die es sich nicht leisten können. Alle Kinder sollten verpflichtend in solche Kindergärten gehen müssen. Die so genannte »Herdprämie« für Eltern, die ihre Kinder zu Hause behalten, ist eine Sackgasse.
Dann brauchen wir flächendeckend im ganzen Land endlich Ganztagsschulen, in denen den Kindern nicht nur Mathematik und Deutsch beigebracht wird, sondern wo sie soziale Kompetenz lernen, unterstützt werden von der Gruppe und von engagierten Lehrern. Die sich wiederum nicht überfordert fühlen, weil die Klassen zu groß sind.
Das BOOT, in dem ich die drei Kinder Vanessa, Melanie und Kevin gefunden habe, ist bunt. Nicht nur die Hauswände außen und innen – die Kinder sind bunt. Ihre Eltern kommen aus der ganzen Welt, von Afghanistan bis Simbabwe, aus den kurdischen Teilen der Türkei bis aus dem Irak. Im BOOT scheint es, sind die deutschstämmigen Kinder in der Minderzahl. Was sich hier aber im Kleinen abbildet, macht im Großen das ganze Bild: Die Mehrzahl der Kinder, die unter der Armutsgrenze leben, hat einen Migrationshintergrund. Nun reden zwar Politiker landauf landab über die dringend nötige Integration der Ausländer. Jedoch geschieht wenig. Dabei sollte es uns ein elementares Anliegen sein, die Integration der Schwachen in unsere Gesellschaft zu ermöglichen. Gerade jetzt und gerade dann, wenn eine Weltwirtschaftskrise jeden einzelnen Haushalt erreicht. Gerade dann müssen wir zusammenstehen. Helfen, egal, ob es deutsche oder ausländische Kinder sind. Dieses Land braucht alle. Und alle haben das Recht auf eine Chance. Die UN-Charta für die Rechte der Kinder formulierte das bereits 1989 im »Übereinkommen über die Rechte des Kindes« ganz präzise. Kinder werden darin nicht als Unmündige angesehen, vielmehr haben sie ein Recht darauf, ernst genommen und respektiert zu werden. Erstmals in einem völkerrechtlichen Vertrag sind damals für Kinder politische Bürgerrechte, kulturelle, wirtschaftliche und soziale Rechte zusammengeführt worden.
An dieser Stelle aber auch ein Appell an die Väter: Es kann doch nicht sein, dass rund 500.000 getrennt lebende Väter die gesetzlich vorgeschriebenen Zahlungen an ihre Kinder und an ihre frühere Frau einfach nicht erfüllen.
Die einen hören auf zu arbeiten, lassen sich vom Sozialamt ernähren. Die anderen ziehen heim ins Hotel Mama und rechnen sich ihr Einkommen vor den Gerichten so klein, dass es den Selbstbehalt von 1.000 Euro nicht überschreitet. Wieder andere setzen sich ins Ausland ab. Der Steuerzahler begleicht die Rechnung: 900 Millionen Euro zahlt der Staat Jahr für Jahr an verlassene Kinder und ihre Mütter. So wundert es nicht, wenn in Deutschland alleinerziehende Mütter die ersten sind, die vom sozialen Abstieg und späterer Altersarmut bedroht sind.
Dieses Buch werden weder die Eltern noch die Kinder lesen, die von Hartz IV leben. Es richtet sich vielmehr an alle, die nicht unter der Armutsgrenze leben. Es will informieren mit den Geschichten von Vanessa, Melanie und Kevin. Es will aber auch Zahlen und Fakten an die Hand derer liefern, die etwas tun können. Das ist jeder von uns, die wir einen Job haben, ein regelmäßiges Einkommen, einen Freundeskreis besitzen, der uns trägt, und die wir einmal, zweimal im Jahr in Urlaub fahren. Jeder von uns kann helfen. Und wenn es nur mit einer Spende für einen Mittagstisch in der eigenen Stadt, in der kleinen Gemeinde ist. Denn diese Mittagstische können nur durch Spenden täglich den Kindern ein Frühstück und ein Mittagessen bieten. Da hilft kein Staat, manchmal die Kirche.
Denken Sie einmal darüber nach, ob in Ihrer Nähe nicht eine Kleiderkammer ist. Packen Sie alles zusammen, was Ihre Kinder oder Enkelkinder ein Jahr lang nicht getragen haben – die Not ist größer, als man das im Wohlstand so glaubt.
Wenn Sie sich nach der Lektüre dieses Buches ein wenig schämen, dass es in unserem Land so viele Kinder in Armut gibt, dann bin ich zufrieden. Denn wer sich schämt, hat ein Gewissen. Denn Kinderarmut ist eine Schande – und darüber hinaus ganz sicher der soziale Sprengstoff von morgen. Schauen wir nach Großbritannien oder nach Skandinavien, wo Kinderarmut durch politische Aktionen signifikant gesenkt wurde. In Schweden zum Beispiel auf 2,4 Prozent. Das müssten wir doch auch schaffen können – oder?
Hamburg, im September 2009, Maria von Welser
Sie hasst Ferien. Kickt wütend mit der rechten Fußspitze einen Stein auf die Straße. Vanessa trödelt seit 10 Uhr morgens durch den Stadtteil Bergfeld. Außerdem ist sie hungrig. Gegessen hat sie noch nichts. Wieder einmal ist das Frühstück ausgefallen. Weil Mama schon um halb acht Uhr weg musste zum Putzen. Melanie, ihre kleinere Schwester, darf heute bei der Oma sein. Die kann immer nur eine der beiden hüten. Heute ist nicht Vanessas Tag.
So was von doof.
Dabei zeigt sich die Stadt gerade an diesem Vormittag von ihrer schönsten Seite: Über den blauen Himmel ziehen leichte, hauchzarte Wolken. Es weht ein frischer Wind durch die Straßen. Überall riecht es nach Sommer. Vanessa mag gar nicht daran denken, wo ihre Freundinnen zurzeit überall herumschwirren. Zwei sind ganz bestimmt auf Sylt. Deren Eltern haben dort Häuser. Ihre beste Freundin ist auf Ibiza. Nächstes Jahr, so hat ihr Catarina in die Hand versprochen, darf sie mit. Vanessas erste große Reise! Ob der Traum wahr wird?
Aber wie soll sie das Flugticket bezahlen? Wenn schon jeder Klassenausflug ein finanzielles Drama ist? Lieber nicht dran denken, noch nicht, vor allem heute nicht … Heute ist heute. Und heute ist im BOOT Kinderparty. In der Kirche. Darauf freut sie sich. Wenn sie Glück hat, ist ihr Los heute keine Niete, sondern ein Gewinn. Vanessa findet, dass sie endlich dran ist.
Aber noch macht das BOOT nicht auf. Erst um 13 Uhr. Dann gibt es Essen. Umsonst. Kaufen könnte sie sich keine warme Mahlzeit. Gerade mal zwei Euro hat sie noch in ihrem kleinen roten Geldbeutel. »Zur Sicherheit«, hat ihr die Mama gesagt. Nur: welche Sicherheit? Was kann sie damit anfangen? Sie könnte aus dem Telefonhäuschen ihre Mama anrufen – allerdings müsste ihr jemand helfen, die Tasten zu drücken. Dafür ist sie noch zu klein. Trotz ihrer zehn Jahre.
Schon zehn! Vanessa fühlt sich ziemlich erwachsen. Auch weil sie vieles ganz allein schaffen muss. Viel zu Hause erlebt hat. Die Eltern geschieden, seit sechs Jahren schon. Vanessa war damals gerade vier und hat alles mitbekommen. Die Mutter, die ohne Unterstützung des Vaters von Hartz IV leben muss und nebenbei ein wenig dazuverdient durch Putzen. Vanessa ist Mamas »Große« und damit auch immer verantwortlich für die kleine Melanie. Sie kann schon ein wenig kochen, putzen sowieso und die Wohnung halbwegs aufräumen. Das muss alles sein, damit sie Platz hat für die Schularbeiten.
Aber jetzt sind ja Ferien. Und der Alltag ist ganz anders. Am Bergfelder Damm ist heute um 12 Uhr richtig tote Hose. Nix los. Gerade mal ein paar Autos, die vorbeifahren. Auf der Fußgängerbrücke, die die Hochhäuser mit dem Einkaufszentrum verbindet, lässt sich auch keine Menschenseele blicken. Nur vor der Dönerkneipe sitzen vier ältere Männer auf weiß-grauen Plastikstühlen, vor sich Tee im Glas. Kein Bier, das fällt Vanessa auf.
Sie holt tief Luft. Was soll sie noch bis 13 Uhr anfangen? Sie schlendert durch die kleine Straße, die hinführt zur Friedenskirche. Hier findet bald die Kinderparty statt. Da drin saß Vanessa auch mit ihrer Schwester und ihrer Mama, als der Pastor den Gottesdienst für Bianca abgehalten hat. Das war das kleine Mädchen, das sie nie gesehen hat, das aber in ihrer Nähe, gleich um die Ecke in einem der Hochhäuser gewohnt haben soll und verhungert ist. Damals hat ihre Mutter sie und Melanie ganz fest in die Arme genommen und an sich gedrückt. Vanessa spürte die Angst, die Trauer, die Hoffnungslosigkeit ihrer Mama – nie wird sie das vergessen.
Kevin kommt ihr auf dem Bürgersteig entgegen. Er ist drei Jahre älter als Vanessa. Sie findet ihn eigentlich ganz nett. Seine Haut ist ziemlich dunkel, die Haare lustig gekräuselt. Er lacht sie gerne an. Aber nur, wenn keiner seiner Freunde in der Nähe ist. Wie heute.
»Na, willst Du auch zur Kinderparty?«, fragt Kevin. Vanessa nickt: »Logisch, mal schaun, ob ich heute was gewinne …«
Sie geht neben ihm auf das Haupthaus vom BOOT zu. Da warten schon ein paar andere Kinder. Sie kicken sich eine Cola-Dose zu. Ein beliebter Zeitvertreib. Zwei Mädchen sitzen auf der kleinen Mauer und lesen gemeinsam ein Comic-Heft. Vanessa knurrt jetzt richtig der Magen. Was es wohl heute gibt? Gestern hatten sie Kartoffelbrei und kleine Fleischknödel, dazu grünen Salat und danach Obst. Das könnte sie heute auch wieder essen. Vanessa mag fast alles, was auf den Teller kommt. Hauptsache, sie wird satt. Mäkelig sein? Das käme ihr nicht in den Sinn. Das hat sie sich schon längst zu Hause abgewöhnt.
Normalerweise kommen hierhin jeden Mittag um diese Zeit 80 bis 100 Mädchen und Jungen zwischen vier und 14 Jahren. Von Montag bis Freitag, vor allem in der Schulzeit. Jetzt in den Ferien sind es 20, 30 Kinder. Das BOOT bietet allen ein warmes Mittagessen. Dazu gibt es Sprudelwasser, Saft oder Milch. Alles umsonst, auch das Obst und der Joghurt, die kleinen Zwischenmahlzeiten am Nachmittag. Nach dem Essen erledigen die Kinder ihre Hausaufgaben. Dabei werden sie betreut. Einige Frauen aus der Stadt helfen sogar dabei und geben den Schülern Nachhilfe, die allein mit dem Lernstoff nicht klarkommen und zusätzliche Förderung brauchen.
Nach der Lernzeit locken Spielzimmer, Computerraum und draußen, wenn es nicht regnet, der tolle neue Spielplatz mit viel Sand. Das BOOT ist einfach insgesamt ein geeigneter Ort für alle Kinder, deren Eltern mittags nicht kochen, die nicht zu Hause sind, weil sie arbeiten müssen oder sich auch sonst nicht richtig kümmern können oder wollen.
Vanessa denkt über all das nicht viel nach. Sie ist froh, dass sie nach der Schule weiß, wohin sie gehen kann. Zusammen mit ihrer Schwester. Aber um 18 Uhr schließt das BOOT. Im Winter, wenn es um diese Zeit schon dunkel ist, bringt Sozialarbeiter Ulli alle Kinder, die nicht in der direkten Nachbarschaft wohnen, mit dem hauseigenen Bus bis vor die Haustür. Aber egal ob Sommer oder Winter: Bevor sie nach Hause geht, muss Vanessa immer anrufen. »Zur Sicherheit«, ob ihre Mama auch wirklich da ist. So ganz glaubt sie diese Begründung nicht. Aber sie liebt ihre Mama heiß und innig. Würde ihr am liebsten die ganzen Sorgen nehmen. Die sie auch wegen ihr und Melanie hat.
Jetzt aber ist Ferienzeit. Vanessa geht zu den beiden Mädchen, die auf der Mauer hocken. Guckt ihnen über die Schulter. Aber das Comicheft, das die beiden gerade lesen, langweilt sie. Sie liest lieber von ihrem Schwarm Eragon in »Die Weisheit des Feuers«. Oft auch noch abends unter der Bettdecke, mit der Taschenlampe, die ihr Papa letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt hat. Mama weiß nichts davon, und Vanessa hält sie auch immer gut versteckt unter ihren Pullovern im Regal.
Endlich 13 Uhr! Achim öffnet die große Glastür mit dem blau gestrichenen Stahlrahmen und auch das Gittertor zum Garten und zum neuen Spielplatz. Die Ferienkinder drücken ins Haus. Drängeln sich am Tresen mit der Essensausgabe. Heute haben Maritta und Peter Küchendienst. Sie stehen hinter dem Tresen und fangen sofort an, die Teller aufzufüllen. Peter wird später die CD's bei der Kinderparty auflegen. Vanessa mag den freundlichen Hausmeister, der im BOOT Ordnung schafft, vieles repariert und bei der Essensausgabe immer ganz besonders große Portionen verteilt. Auch heute. Spaghetti und Tomatensauce, sowieso eines von Vanessas Lieblingsgerichten. Wird ja heute vielleicht doch noch alles gut, denkt das Mädchen und wickelt sich die langen Nudeln um die Gabel, wie sie es von Mama gelernt hat. »So machen es auch die Italiener«, hat die ihren Töchtern erklärt. »Spaghetti darf man nicht klein schneiden.«
Im Flur des Kinderhauses hängt eine weiße Plastikuhr von Ikea. Vanessa sieht sehnsüchtig hin. Die Kinderparty geht erst um 16 Uhr los. Hausmeister Peter schreibt noch für ein anderes Kind Einladungen zum Kindergeburtstag bei McDonald's. Vanessa bekommt keine, das weiß sie schon vorher. Denn Tessa ist nicht ihre Freundin, geht in eine ganz andere Schule. Macht nichts, denkt sich das Mädchen … zu meinem Geburtstag lade ich sie auch nicht ein. Obwohl es ihr einen Stich gibt, dass sie nicht bei Tessas Feier dabei sein darf. Oh je – Kindergeburtstag. Noch so ein unerfreuliches Thema. Zu Hause feiern geht nicht. Sagt Mama, und ehrlich, Vanessa würde sich auch schämen für ihr Zuhause mit den zusammengewürfelten Möbeln. Alles Sachen, die andere Leute nicht mehr gebrauchen konnten und nicht mehr schön fanden. Aber vielleicht könnte sie wie Tessa zur Kinderparty bei McDonald's einladen? Das wäre einfach Spitze. Oder bei ihrer Oma feiern? Das wäre auch nicht schlecht. Die lässt sich vielleicht dazu überreden. Denn Oma hat einen Garten in Marienbüttel im Norden der Stadt, da könnte sie mit ihren Freundinnen toll Verstecken und Schwarzer Mann spielen. Aber Vanessa hat im Winter Geburtstag, am 2. Februar – und da war es noch nie was mit draußen spielen.
Mit der Serviette wischt sie sich den Tomatensaucenmund ab. Neben der Treppe im BOOT steht ein stählerner Wasserbrunnen. Sie füllt sich ihren blauen Plastikbecher, trinkt schnell leer und füllt noch mal nach. Die Tomatensauce hat sie durstig gemacht. Dabei schaut sich Vanessa die Bilder an, die die anderen Kinder hier gemalt haben: »Bonjour … welcome … akuaba« – diese drei Worte stehen auf einem Plakat. Auf dem Bild daneben marschiert eine richtige Familie mit Vater, Mutter und zwei Kindern an der Hand auf die Friedenskirche zu. Und das dritte, knallbunte Gemälde zeigt eine lachende Maske, wie sie zum Karneval in den Geschäften verkauft wird. Alle Bilder machen gute Laune.
Bis 16 Uhr trollt sich Vanessa auf den neuen Spielplatz und schaukelt in den Himmel. Immer höher, heute traut sie sich. Wenn das Wetter grau ist und regnerisch, hat sie keine so große Lust dazu. Beim Träumen auf der Schaukel vergeht die Zeit. Die Jungen balgen sich in dem meterhohen Sand, drei Mädchen schicken sich gegenseitig SMS auf ihre Handys. Sie beneidet die Mädchen. Denn Vanessa weiß, dass sie ihre Prepaid-Karte gut hüten muss, damit das Guthaben lange hält. Aber ihrer Schwester Melanie würde sie jetzt auch gerne eine SMS senden. Wissen will sie unbedingt, was die gerade bei Oma so alles macht.
Vor der Kirchentür stehen schon 15 Minuten vorher die Kinder Schlange. Die Kinderparty, die jeden Donnerstag steigt, ist vor allem in den Ferien ein Hit. Sie ist das Highlight in der sonst eher langweiligen schulfreien Zeit. Vanessa drängelt sich hinter Kevin. Der ist groß und breit und stark. Der boxt sie beide rein. Das weiß sie. In der Kirche ist es angenehm kühl im Vergleich zu der drückenden Hitze draußen. DJ-Peter hängt noch im Altarraum Luftballons auf, Girlanden schmücken schon die Wände. Wie jeden Donnerstag. Die geben sich hier richtig Mühe, denkt Vanessa und freut sich. Mitten im Kirchenraum schwebt ein hölzernes Schiff. Das hängt aber immer da, passt als Deko aber auch perfekt zur Kinderparty.
Jetzt geht es gleich los. Der Kirchenvorstand macht die Eingangstür zu. Etwa 30 Mädchen und Jungen sind gekommen. Sabine, die Sozialpädagogin, ruft die Namen aller Kinder für die Verlosung auf – juhu! Vanessa ist dabei. Jetzt muss sie nur noch Glück haben und bei den vielen Spielen erfolgreich sein. Sie hat vorher schon geguckt, was es diesmal zu gewinnen gibt: Fußbälle, Schreibblöcke, Puzzles. Na ja …
Peter stellt die Musik ganz laut. Es sind Texte, die Vanessa alle kennt inzwischen, die Melodien auch: »Gott hat Dich in sein Herz geschlossen, von Deinem Kopf bis zu den Flossen …«
Gleich kommt das erste Wettspiel. Die Betreuer wählen von beiden Seiten aus den Kirchenbänken die Kinder aus, die dabei mitmachen dürfen. Die Finger schnellen in die Höhe. Aufgeregte Kinder-Stimmen: »Ich, ich, bitte ich.« Aber Sabine, die Sozialpädagogin, winkt ab, energisch:
»Wenn der Kuchen spricht, sind die Krümel leise«, donnert sie in den Kirchenraum.
Das hilft. Für zwei Minuten … Sabine hat ein Headset am Kopf. Alle sollen sie gut hören können. »Auch heute gilt: Alle Handys aus.«
Alle Kinder haben nämlich ein solches Telefonteil in den Taschen ihrer Jacken oder Hosen oder im Rucksack. So klein sie auch sind – Handys gehören beinahe zur Grundausstattung eines jeden BOOT-Kindes. So wenig Geld zu Hause auch da ist für das tägliche Leben – für ein Mobiltelefon reicht es. Vanessa schaltet ihres auch ab. Geht einfach. Denn ihre Mama hat ihr auf die einzelnen Tasten die wichtigsten Nummern gespeichert: Die von Mama, Papa, Oma und auch die von Melanie, ihrer kleinen Schwester. »Zur Sicherheit«, sagt Mama. Das sagt sie oft und gern zu ihren Töchtern.
Das erste Spiel geht los. Die Kinder sind in zwei Gruppen eingeteilt. Vanessa gehört zu den Kleineren. Die Aufgabe: Teebeutel so weit wie möglich werfen. Das ist lustig, und gar nicht so einfach. Vanessas Gruppe verliert. Die anderen bekommen 40 Punkte. Dann: Frucht-Gummistangen ganz schnell essen, sechs Stück hintereinanderweg und alles, ohne die Hände zu benutzen. Da muss Vanessa zugucken. Kevin ist auf der rechten Seite dabei, bei den Größeren. Er isst rasend schnell, die ganze Gruppe gewinnt. Wieder 40 Punkte.
Jetzt kommt Zeitungstanzen mit Musik. Die Papierunterlage, die erst ganz groß ist, wird in jeder Runde kleiner. Wer daneben tritt, fliegt raus. Wer als letzter zur Musik noch auf einem kleinen Stück Zeitung tanzen kann, hat gewonnen. Wieder ist es Vanessas Gruppe. Weitere 40 Punkte. Es steht richtig gut für sie alle. Zum Schluss folgt immer die Polonaise. Aber auch die hat ihre Tücken: Die Kinder müssen ganz schnell ganz viele Kleider, Jacken, Hosen, Mützen, Handschuhe und Schals anziehen. Wer ein Teil nicht an hat, fliegt raus. So dick eingepackt, muss jeder so schnell wie möglich um die Kirchenbänke herumlaufen.
Dann gilt es, das An- und Ausziehen in Windeseile und im Laufschritt zu trainieren. Was der eine »abwirft«, muss der andere wieder anziehen.
Dieses Geschicklichkeitsspiel ist ganz nach Vanessa Geschmack – da ist sie richtig gut drin. Gewinnt mit ihrer Gruppe. Ihre Wangen sind inzwischen rot und heiß, die schulterlangen, blonden Haare verwurstelt, sie macht sich ganz schnell einen Pferdeschwanz mit einem Gummiband aus der Hosentasche ihrer hellblauen Caprihose. Auf die ist sie ganz stolz. Die Hose ist neu. Sie hat sie letzte Woche aus der Kleiderkammer vom BOOT ergattert. Die Kleiderkammer ist nämlich zurzeit ziemlich leer. Und nagelneue Klamotten liegen auch nicht jede Woche in den Regalen.
»Wenn ich falle, hebst Du mich auf …« singen am Ende des Spielenachmittags alle zusammen. Und Peter schaut sich glücklich im Kirchenraum um. Auch er liebt die Kinderpartys. »Wie schön, wenn die alle lachen und strahlen. Das ist unter der Woche nicht oft so«, erzählt er Sabine. Die jetzt nach zwei Stunden action ziemlich fertig auf die Treppen zum Altarraum sinkt.
Vanessa darf sich unter den Preisen einen aussuchen. Sie nimmt ein Puzzle Ein weißes Pony will sie zusammensetzen. Puzzeln kann sie gut. Und schnell. Zu schnell. Weil dann die Zeit viel langsamer vergeht, findet sie. Jetzt ist es gleich 18 Uhr. Mama anrufen und dann nichts wie heim. Aber Mama geht nicht ran. Komisch, denkt sich Vanessa. Aber trabt trotzdem los. Sie muss vorn an der Ecke in den 21er Bus. Nur zwei Haltestellen, schon ist sie da. Hinauf in den fünften Stock, in die kleine Zwei-Zimmerwohnung. Hoffentlich ist Melanie von der Oma zurück. Dann kann sie mit ihr auf dem Sofa noch klönen, den Schokoriegel aus der Snackpause im BOOT mit ihr teilen. Nächste Woche sind auch noch Ferien. Aber Montag ist dann »ihr« Tag, da darf Vanessa zur Oma, in das kleine Häuschen mit dem Garten. Und Melanie muss zum BOOT.
Vorher aber noch ist Wochenende für die kleine Restfamilie aus Mama und den beiden Töchtern. Und Monatsende. Das heißt: Kein Geld mehr und Unternehmungen sind gestrichen. Fernsehen schon früh morgens nach dem Aufwachen. Denn die Mama schläft immer lange aus. Dann vielleicht ein Spaziergang rund um den Bergfelder Weiher. Nicht gerade das, wovon Vanessa träumt. Aber sie hat ja noch das Puzzle …
Vanessa löst ihren Karabinerhaken von der Hosenschlaufe. Schließt die Tür auf – und freut sich. Melanie ist schon da. Die neunjährige Schwester lümmelt auf dem orangefarbenen Sofa, das mit Kaffeeflecken und Brandlöchern übersät ist. Melanie schiebt sich gerade genüsslich ein Bounty rein. Sie ist eindeutig zu dick für ihr Alter. Aber Oma steckt ihrer Lieblingsenkelin alles zu, was diese mit Leidenschaft und in großen Mengen vernascht: Schokolade, Chips in Tüten, Puddings und Pizza. Lauter ungesunde Dickmacher.
Aber Vorhaltungen kriegt nur Vanessa zu hören: »Iss nicht so viel, sonst wirst Du so dick wie Deine Schwester!« Vanessa findet solche Ermahnungen ziemlich unlogisch, aber das alles macht ihr nicht wirklich was aus. Wichtig ist: Sie versteht sich gut mit ihrer Schwester. Sie sind ein Team. Manchmal gegen Mama, immer gegen Papa. Und zuweilen auch gegen den Rest der Welt. Der Rest der Welt ist für die beiden Mädchen manchmal die Wohngegend rund um das Hochhaus mit den 12 Stockwerken.
Vanessa knallt ihre Tasche mit dem Puzzle-Kasten auf den Boden im Flur, direkt unter den Garderobeständer. Der große Beutel aus festem Jeansstoff kann das offensichtlich ab.
»Krass. Du futterst schon wieder oder immer noch?« Vanessas Begrüßung fällt nicht sonderlich freundlich aus. Melanie aber isst ruhig weiter, guckt nicht mal hoch.
Im Kühlschrank ist noch ein Erdbeer-Joghurt. Vanessa holt sich den Becher raus. Dazu einen Löffel aus der Küchenschublade.
»Was hast Du bei Oma alles gemacht?«, will sie wissen. »Ooch – nicht viel. Ich hab mit Oma ferngesehen, ab Mittag. Im Haus ist es kühler als draußen auf der Terrasse. Sie hat Spaghetti gekocht, aber den Salat dazu musste ich nicht aufessen …« – Vanessa schaut sich um: »Wo ist eigentlich Mama?«
»Keine Ahnung, macht doch nichts, komm lass uns Mensch-ärgere-Dich-nicht spielen, ja?«
Vanessa lächelt jetzt ihre kleine Schwester an: »Okay. Machen wir.«
Auf dem Couchtisch wird das Spielbrett ausgelegt, die vier Figuren je Spielerin aufgestellt, gewürfelt – und schon sind die beiden Mädchen vertieft in vorwärts-rückwärts, raus und mit der Sechs wieder rein. Sie merken nicht, wie die Zeit vergeht. Hunger haben sie auch nicht mehr. Als es dunkel wird, sieht Vanessa auf die Uhr: Halb zehn … wo nur ist Mama? Beide Mädchen holen gleichzeitig tief Luft. Sie bekommen Angst. Nicht vor dem Alleinsein. Nein, das können sie ganz gut, sie sind ja zu zweit. Aber dass Mama wieder abgestürzt sein könnte. »Abgestürzt« nennen es die Mädchen, wenn die Mutter betrunken und laut redend nach Hause kommt. Wenn sie sie anschreit – was sie sonst nicht tut. Sich auf das Sofa knallt und sofort tief und fest einschläft.
Aber heute passiert das hoffentlich nicht. Die Mama ist nur noch nicht zu Hause, sonst nichts. Vanessa und Melanie hören draußen im Hausgang Schritte. Ob es Mama ist? Aber die Schritte gehen weiter, einen Stock höher. Wieder nichts. Die Mädchen wissen, dass sie Papa anrufen sollen, wenn Mama nicht nach Hause kommt.
Das aber ist das Allerletzte, was sie tun wollen. Sie haben Angst, dass sie sonst ganz zu Papa müssen. Und davor graut ihnen noch mehr als vor einer betrunkenen Mama. Inzwischen ist es 23 Uhr und draußen ist es stockduster.
Sie weiß, dass ihre beiden Töchter auf sie warten. Aber sie kann noch nicht zurück in die dunkle 66 Quadratmeter große Wohnung im Hochhaus. Sie kann nicht, weil sie getrunken hat. Andrea hat sich am Nachmittag von ihren letzten 20 Euro ein paar Flaschen Bier und einen Flachmann vom Discounter besorgt und hinter die Binde gekippt. Zum ersten Mal in dieser Woche, beruhigt sie sich. Und überhaupt, sie könne ja jederzeit damit aufhören, wenn sie es nur wolle. Meistens glaubt sie das auch.
Jetzt aber bleibt sie erst mal auf der Steinbank im Park von Bergfeld sitzen, versucht einen klaren Gedanken zu fassen. Wie soll sie nur ihre Schulden loswerden? 5000 Euro – die Summe ist so gewaltig. Eine Fünf mit drei Nullen, Zahlen die ihr immer wieder und wieder durch den Kopf schwirren. Schulden, die ihr nach der Scheidung von Jan geblieben sind. Weil sie bei der Bank auf Drängen des Bankdirektors den Kredit ihres Mannes mit unterschrieben hatte. Damals war sie mit Jan noch verheiratet gewesen. Damals hatte sie keine Ahnung, wie sich ein sozialer Absturz anfühlt, wie Schulden drücken.
Seit der Scheidung vor fünf Jahren lebt Andrea von Sozialhilfe. Sie bekommt 351 Euro im Zuge der Hartz IV-Zahlung für sich, und für beide Töchter je 227 Euro. Nach Abzug aller Fixkosten bleiben ihr 594 Euro für Lebensmittel, Bekleidung, Putzmittel, Anschaffungen, Reparaturen, Telefon, Freizeit und alle übrigen Ausgaben.
Miete und Nebenkosten für die Wohnung übernimmt das Sozialamt. Andrea hat ausgerechnet, dass sie mit den Kindern pro Tag mit 19,60 Euro auskommen muss. Mehr ist nicht drin. Sicher, im Vergleich zu manchen so genannten Geringverdienern ist das nicht wenig. Hartz IV sichert zumindest das Überleben. Aber wehe wenn eine Anschaffung ansteht. Wenn das neue Schuljahr beginnt, die Waschmaschine kaputtgeht, oder die Kinder wie jedes Jahr wieder aus ihren Schuhen und Hosen herausgewachsen sind, dann wird das Geld sehr knapp.
Früher gab es im Winter und im Sommer Kleidergeld vom Sozialamt, aber mit der Einführung von Hartz IV wurde dieser Zuschuss gestrichen.
Andrea gehört in ihrer Großstadt zu den 10,8 Prozent Leistungsempfängern nach dem Sozialgesetzbuch II kurz SGB II. So hat sie das auf dem Sozialamt gelernt. Von diesem Geld soll sie laut Schuldnerberater jetzt Monat für Monat auch noch ihre Schulden abzahlen. Sie hat ein Insolvenzverfahren beantragt, damit kann sie in sieben Jahren schuldenfrei sein. Hartnäckig musste der Schuldnerberater mit der Bank verhandeln, bis die sich darauf eingelassen haben. Andrea zahlt jetzt 60 Euro im Monat. Da bleibt am Ende eines Monats kein Cent mehr übrig. Wie jetzt. Die 20 Euro für den Alkohol sind ihr von den 160 Euro geblieben, die sie für vier Stunden putzen die Woche, viermal im Monat in einem feinen Hamburger Haushalt bekommt. Bekommt, nicht verdient, wie sie sich immer wieder sagt. Nein, verdienen könnte sie mehr, wenn nicht alles in ihrem Leben so verdammt schiefgelaufen wäre.
Sie arbeitet schwarz, erzählt auch den Kindern nicht viel davon. Sie könnten sich verplappern. Andrea weiß, dass Schwarzarbeit für jeden verboten ist.
Die kühle Luft im Park klärt allmählich auch Andreas Kopf. Sie muss zu den Kindern, das weiß sie genau. Noch zehn Minuten, nur noch ein bisschen Ruhe haben und weit weg von den alltäglichen Sorgen und Problemen bleiben. Das gönnt sie sich jetzt. Ihre Mädchen werden den Papa schon nicht anrufen und erzählen, dass sie weg war die ganze Nacht. Nein, das würden ihre Kinder nie tun. Sie hat Angst, dass Jan doch irgendetwas rauskriegt und sie bei der Jugendbehörde anschwärzt. Diese furchtbare Angst, dass ihr die Kinder weggenommen werden, die schnürt ihr oft den Hals zu.
Dabei war Jan einmal ganz anders. Damals, vor elf Jahren, als sie sich in einer Kneipe in der Altstadt kennen gelernt hatten. Er war 30 Jahre alt, Elektriker, ein gut aussehender Blondschopf mit blitzenden, blauen Augen. Sie, ganze 21 Jahre, jung und hübsch, hatte gerade nach der Hauptschule und Lehrzeit die Gesellenprüfung als Friseuse abgelegt.
Im Hinterkopf hatte sie dabei immer schon, dass sie diesen Beruf auch weiterhin, neben Kindern und Familie würde ausüben können. Jan verdiente nicht schlecht, sie trafen sich bald jedes Wochenende, er hatte ein Zimmer in einer Männer-WG, da kam sie manchmal mit. Sie spazierten am Fluss entlang, vorbei an den tollen weißen Villen und den hochherrschaftlichen Gärten. Hand in Hand und von einer schönen gemeinsamen Zukunft träumend.
Jan erzählte oft von seinem Chef, über den er sich furchtbar ärgerte und der ihm auf den Keks ging. Allein schon sein Geschäftsraum – voll gestellt mit Lampen und Elektrogeräten, kein Kunde konnte sich zurechtfinden. Sein Traum war ein eigenes Unternehmen. »Elektriker werden immer gebraucht«, sagte er zu Andrea, »eines Tages mache ich mich mit einem eigenen Laden selbstständig.« »Und ich mit einem Friseurgeschäft«, konterte die junge Frau fröhlich und selbstbewusst.
Eines Tages im Frühsommer saß Andrea ganz still und ein wenig deprimiert vor einem Cafe in der Innenstadt. Dort hatte sie sich in der Mittagspause mit Jan verabredet. Ihm fiel zunächst nichts Ungewöhnliches auf. Er bestellte einen Cappuccino und ein Wasser für seine Freundin. Erst als Andrea so gar nicht antworten wollte, nur am Wasserglas nippte, wunderte er sich: »Was ist los, was hast Du?« Da kamen ihr die Tränen. »Ich bin schwanger.« Andrea schluchzte. Ihr war klar, was das für die nächste Zeit bedeutete. Aus der Traum vom eigenen Job, vom selbstverdienten Geld. So kam es dann auch.
Jan lernte nun Andreas Eltern kennen. Die waren von ihrem künftigen Schwiegersohn sehr angetan, ein gut aussehender Mann mit einem soliden Beruf. Handwerker, das ist doch was. Damals lebte Andreas Vater noch. Auch er freute sich auf das erste Enkelkind von seiner einzigen Tochter.
Hochzeit und Wohnungssuche verliefen problemlos – noch hatte jeder sein eigenes Einkommen. Auch wenn es nicht viel war, was sie verdienten, zusammen konnten sie sich schon was leisten. Drei Zimmer – das sollte es dann doch sein. In einem urbanen aber nicht zu schicken Stadtteil wurden sie zu einem relativ günstigen Mietpreis fündig. Vanessa kam dann am 2. Februar zur Welt. Und Andrea kündigte ihren Job im Friseursalon in der Innenstadt. Das war ihr erster großer Fehler.
Am Anfang ging alles gut. Jan freute sich über seine kleine Tochter, ein Jahr später kam Melanie zur Welt. Aber: Zeitgleich kündigte Jan bei seinem ungeliebten Chef, ging zur Bank und bekam einen Kredit über damals 20.000 Mark als Startkapital. Damit machte er sich als Elektriker selbstständig. Andrea konnte kaum mehr schlafen vor Angst. Das Geschäft lief nicht so, wie sich Jan das vorgestellt hatte. Die Kunden rannten ihm nicht wie erhofft die Bude ein, sondern sie blieben weg. Abends, wenn er frustriert nach Hause kam, ließ er seine schlechte Laune und seine Enttäuschung immer öfter und immer heftiger an Andrea aus. Zuerst verpasste er ihr ein paar Ohrfeigen, wenn er ein paar Bier intus hatte. Dann setzte es Schläge, brutal und wie von Sinnen prügelte er auf Andrea ein, später auch auf die Mädchen. Da flog auch mal eine der beiden gegen die Wand, da krachte ein Stuhl auf Andrea nieder. Jan schlug im Bad einmal so brutal auf Andrea ein, dass sie blutüberströmt am Boden liegen blieb.
Später, beim Arzt im Krankenhaus, der die Wunde am Kopf nähte, schwindelte Andrea etwas von einem Sturz im Badezimmer. Nur ein Unfall, sie wollte der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen.
Es war eine schreckliche Zeit. Nach jeder Gewaltattacke bettelte Jan am nächsten Tag um Verzeihung, bat um Verständnis und entschuldigte sich weinend bei Andrea. Er überdeckte sie mit Küssen und schwor jedes Mal: Das passiert nie wieder, es war wirklich das letzte Mal. Aber er schlug immer wieder zu. Eines Tages packte Andrea ihre beiden damals vier und fünf Jahre alten Mädchen und flüchtete in eines der städtischen Frauenhäuser. Es war das Ende ihrer Ehe. Übrig blieb ein Scherbenhaufen, das Ende all ihrer Träume, ihrer Illusionen. Aber es war auch der Anfang eines neuen, selbstbestimmten Lebens. Andrea war voller Hoffnung. Jetzt konnte es für sie und die Kinder nur noch besser werden. Aber es sollte anders kommen. Vorbei mit der Träumerei. Jetzt muss sie aber wirklich nach Hause. Ganz schnell. Sie fühlt sich nüchtern genug. Damit Vanessa und Melanie nichts merken. Sie würde ihnen schon irgendwas erzählen, von »länger arbeiten«, »zusätzlich noch helfen« und so. Die Mädchen geben ihr Sicherheit, sind ihre Bank – zuverlässig, immer auf ihrer Seite. Mit den beiden fühlt sie sich stark. Obwohl ihr auch klar ist, was den Kindern alles fehlt.
Andreas Calypso-Klingelton ertönt. Ganz fremd in diesem Park, an diesem Sommerabend.
»Mama. Wo bist Du, wann kommst Du, es ist schon so spät …« Melanie klingt ängstlich. Andrea spürt, dass sie jetzt wirklich dringend nach Hause muss. »Ich bin auf dem Weg, komme gleich. Musste noch in dem Haus helfen, die hatten heute Besuch …«
Klingt alles plausibel, Andrea hat kein sehr schlechtes Gewissen, wenn sie ihre Töchter anschwindelt. Zögernd steht sie auf, merkt noch den Alkohol im Kopf. Jetzt aber nichts wie nach Hause. Und morgen ist ein neuer Tag: Samstag, Putztag. Da müssen die Kinder mithelfen, aufräumen, Staub wischen, saugen und im Keller in der Waschküche Wäsche waschen, im Bad zum Trocknen aufhängen … weiter will Andrea nicht denken.
Diese ganze Gegend hier hängt ihr zum Hals raus. Wie viel schöner war es in der ersten kleinen gemeinsamen Wohnung mit Jan. Bergfeld – wer das hört, spitzt schon die Ohren und ist auf Abwehr. Bergfeld steht für sozialen Brennpunkt, für Hartz IV und Jugendliche ohne Jobs.
Dabei gehört dieser Stadtteil zu den »ordentlichen« Stadtteilen der Millionenstadt. Früher war hier die Universität der Bundeswehr, in den Einfamilienhäusern wohnten die Familien der Soldaten. Es gab drei Kasernen, ein ruhiger, gemütlicher Stadtteil. Aber 1970 entstanden die dringend benötigten Sozialwohnungen, teilweise in anonymen Hochhäusern. Die Arbeitslosigkeit stieg an, dazu die Kriminalitätsrate. Rund um das Einkaufszentrum spielt sich heute das Leben in Bergfeld ab. Überdurchschnittlich viele Sicherheitsbeamte tummeln sich dort – was aber nicht wirklich hilft. Wenn Andrea mit den Kindern mal Luft schnappen möchte, ein wenig laufen will am Wochenende, dann geht sie am liebsten in den Nordwesten Bergfelds, zum Teich im Bergfelder Moorpark. Das ist Natur pur, das liebt sie. Es erinnert sie an den kleinen Garten ihrer Mama in Marienbüttel … und an die Wälder und Auen rund um den großen Fluss in Richtung Norden, da wo sie ihre Kindheit verlebt hat.
Langsam steigt sie die Treppen hinauf, in den fünften Stock, zu ihren Töchtern. Sie weiß, der Kühlschrank ist fast leer. Das letzte Geld ging für den Alkohol drauf. Erschwerend kommt hinzu, dass morgen Samstag ist, dazu Monatsende und dann auch noch Ferien. Schlimmer könnte es nicht kommen. Am Wochenende sind die Kinderzentren geschlossen. Dort gibt es nur Montag bis Freitag ein warmes Essen – umsonst. Unter der Woche während der Schulzeit könnten die Kinder dort sogar kostenlos frühstücken, bevor sie in die Schule gehen. Aber morgen – da sieht es finster aus. Bleibt nur die Oma. Wie schön, dass die in den Ferien immer einen Tag eine der beiden Enkeltöchter aufnimmt. Dafür ist Andrea sehr dankbar. Wenn sie sich auch nicht mehr gut mit ihrer Mutter versteht, seit dem Tod ihres Vaters vor sechs Jahren, ausgerechnet in dem Jahr, in dem sie geschieden wurde. Plötzlich war ihre Mutter auf der Seite von Jan, unfassbar für Andrea. Alles, was ihr die Tochter damals von den Schlägen zu Hause erzählt hat, wollte die Mutter nicht hören. Seitdem sind sich die beiden fremd geworden. Andrea will das Ganze auch nicht verzeihen. Sie trägt es ihrer Mutter bis heute nach.
Langsam und schweren Herzens sperrt sie jetzt die Haustür auf. Ziemlich schäbig sieht die aus, von außen und auch von innen. Die Wohnungsbaugesellschaft macht rein gar nichts, obwohl die Stadtverwaltung pünktlich die Sozialmiete überweist. Für einen Vermieter wie die Wohnungsbaugesellschaft sind die Sozialgeldempfänger eigentlich die sichersten Mieter. Denn der Staat zahlt pünktlich. Dafür könnten die ruhig auch mal was tun, außen an der Fassade des Hochhauses, oder im Treppenhaus, an den Wänden und Türen – das kommt denen wohl nicht in den Sinn. Darüber ärgert sich Andrea noch, als schon die Töchter auf sie zustürmen. »Mama, endlich, wo warst Du so lange … es ist spät, ganz dunkel. Aber den Papa haben wir nicht angerufen!«
Melanie hat den letzten Satz schnell hinzugefügt und ihre Mama erwartungsvoll angeschaut. Aber Vanessa riecht das Bier und den Schnaps an ihrer Mutter. Sie hat mit ihren zehn Jahren schon ein sehr feines Gespür für diese Art von Gerüchen entwickelt. Alkohol ist ihr zuwider. Sie ekelt sich und mag ihre Mama nicht mehr umarmen, wenn die eine Fahne hat. Da liebt sie sie nur noch zu »einem Prozent«, wie sie das schon mal ihrer besten Freundin Catarina anvertraut hat. Das war, als Vanessa bei ihrer Freundin zu Hause auf dem Kinderzimmerboden saß und beide Mädchen das Spiel spielten: »Was ich mag und was ich nicht mag an meinen Eltern …«
Andrea spürt wie sich Vanessa zurückzieht, ihr ablehnend begegnet. Sie dreht sich weg. Das tut ihr im Augenblick richtig weh. Die ältere Tochter blickt schon ziemlich gut durch, das weiß sie. Sie nimmt sich ganz fest vor, dass es das letzte Mal war, dass sie das Wochenendgeld in Alkohol gesteckt hat.
»Ich geh ins Bett, Mama«, sagt Vanessa noch, und zieht unter dem Kissen im unteren Stockbett ihren Schlafanzug hervor. »Ich lese euch noch vor, wenn ihr wollt«, bietet Andrea ein wenig zögerlich an. Sie hat Angst vor einer Abfuhr ihrer Töchter. Aber beide scheinen sich zu freuen. Vor allem Melanie strahlt. »Oh ja, aus der >Unendlichen Geschichte< am besten, das ist richtig spannend zurzeit.«
Beim Vorlesen kuschelt Melanie im unteren Bett noch bei Vanessa. Danach muss sie nach oben. Was sie ärgert. Aber das war schon immer so: die Kleinere oben, die Größere unten. Angeblich, weil Vanessa mehr wiegt als Melanie … so ein Schwachsinn. Aber jetzt liest erst mal Mama vor.
Später starrt Andrea an die Decke, die Fenster sind auf, jetzt, in der Sommernacht, wird es immer kühl in der Großstadt. Der Wind kommt vom Meer, das tut gut. Vielleicht kann sie heute bald schlafen. Ihre Gedanken drehen sich im Kreis: Wie kommt sie raus aus diesem Tief, aus dieser Aussichtslosigkeit? Wie kann sie ihren Töchtern eine bessere Zukunft bieten? Sie will ja etwas ändern, will wieder zurück in ihren Job als Friseuse. Nur: Die Schule von Vanessa und Melanie endet mittags. Andrea weiß, dass die Halbtagsschule kein Argument ist. Schließlich gibt es ja in ihrem Stadtteil das BOOT. Da können die Kinder hin, da kriegen sie alles, was sie brauchen: Essen, Betreuung bei den Hausaufgaben. Im BOOT können sie spielen und Freunde treffen. Das funktioniert auch jetzt bereits sehr gut. Eigentlich sind ihre Mädchen von Montag bis Freitag, von morgens um sieben bis abends um sechs Uhr rundherum gut versorgt. Da könnte sie als Mutter eigentlich beruhigt zur Arbeit gehen und eigenes Geld verdienen. Da wollte sie doch immer. Eigentlich.
Immer wieder surft Andrea nachts im Internet, wenn die Kinder schlafen, und sucht nach einem Job. Aber bisher erfolglos. Denn: Für Andrea als Hartz IV-Empfängerin lohnt es sich erst bei einem relativ hohen Gehalt, eine Stelle anzunehmen. Auf dem Sozialamt hat ihr einmal ein Beamter vorgerechnet, dass weniger als 2.050 Euro brutto für sie als Alleinerziehende mit zwei Kindern gar keinen Sinn macht. Aber das kann sie knicken. Denn so viel bekommt sie nie in einem Friseurgeschäft.
Laut Tarifvertrag verdient eine Friseuse 1.150 Euro brutto im Monat. Das entspricht einem Stundenlohn von 6,65 Euro. Halbtags käme sie nur auf 26,60 Euro zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr. Allerdings muss sie Trinkgelder dazu rechnen, die in ihrem Job schon mal gezahlt werden. Das macht auch der Arbeitgeber bei der Festlegung des Gehaltes.
Bisher hat sie immer nach Halbtags-Jobs Ausschau gehalten. Wenn sie dann noch sagt, sie sei alleinerziehend, mit zwei kleinen Kindern, da lachen die Besitzer eines Friseurgeschäftes nur: »Halbtags, ausgeschlossen – drei Tage die Woche, darüber könnte ich mit Ihnen reden.«
Noch zwei, drei Jahre denkt Andrea, dann kann ich springen. Hinein ins Berufsleben und das Geld für die Kinder und mich selbst verdienen und nicht auf den Staat angewiesen sein. Vielleicht sogar in den Urlaub fahren. Und vielleicht bekommt auch Jan mal wieder einen Job. Im Augenblick arbeitet er als 400-Euro-Jobber in einer Behörde. Für die Kinder geht da nichts ab. Unterhalt – von wegen. Den hat er noch nie bezahlt. Als sie damals im Frauenhaus unterkam mit den Mädchen, hat er sogar noch argumentiert: »Du bist ja davon, nicht ich … und dann soll ich zahlen?«
Beim Scheidungstermin verdonnerte ihn der Richter auf Unterhaltszahlungen für den Zeitpunkt, an dem er selbst wieder Geld verdient. Dass er sich deshalb nicht sonderlich engagiert um einen Job bemüht, hat er Andrea immer wieder wissen lassen. Wenn er die Kinder sieht – alle zwei Wochenenden, Sonnabend oder Sonntag und nie über Nacht, steckt er ihnen Streuselschnecken oder Pizza zu, mal einen Schlüsselanhänger oder einen Karabiner für die Jeans. Es geht ihm wohl wirklich nicht gut. Andreas Mitleid für Jan aber hält sich in Grenzen. Über diesen Gedanken schläft sie ein. Morgen klingelt der Wecker nicht um 5.45 Uhr wie sonst. Ausschlafen … Sonnabend.
Kapitel 3 – Wochenende und bald Schulanfang
Im Halbschlaf sieht Vanessa die Hand ihrer Schwester. Es macht tock, tock, tock, an die Bretterwand ihres gemeinsamen Stockbettes. »Vanessa, wach auf, es ist Samstag. Die Mama schläft noch, wir könnten doch surfen … wach endlich auf!«
Melanie ist hellwach. Vanessa blinzelt verschlafen in Richtung Wecker. Die Zeiger stehen auf acht Uhr. Durch das kleine Fenster im Kinderzimmer blitzt blauer Himmel. Also wieder ein sonniger Sommertag. Noch eine Woche Ferien. Vanessa will noch eine Runde schlafen. Aber die kleine Nervensäge Melanie gibt nicht auf. »Jetzt komm endlich, Du Schlafmütze …«
Die Schwester zerrt die Decke weg und Vanessa am Arm aus dem Bett. Die Neunjährige ist im Gegensatz zu Vanessa ganz wild auf das Surfen im Internet, auf Internet-Spiele und alles, was das »world wide web« so bietet. Auch wenn es nicht unbedingt für Kinder geeignet ist. Ihre Mama hat ihnen unter der Woche das Surfen verboten. Der Laptop ist dann in Mamas Schrank weggesperrt. Aber am Wochenende dürfen sie. Das hat auch der Papa für sie durchgesetzt. Wenn sie bei dem sind, dann sitzen sie die ganze Zeit vor dem Computer. Im BOOT gibt es auch ein Computerzimmer, jedes Kind darf eine halbe Stunde dort surfen. Aber immer unter Aufsicht. Hier zu Hause kriegt die Mama nichts mit. Sie schläft tief und fest. Vanessa brummt vor sich hin. »Ich hab Hunger.«
Sie trottet in die Küche. Gestern Abend hat sie den letzten Joghurt vertilgt, es herrscht gähnende Leere im Kühlschrank. Ein halber Liter fettarme Milch ist noch da, im Schrank steht ein Paket Schokopulver. Das ist schon mal ganz gut für den Anfang, denkt sich Vanessa, und füllt Milch und Pulver in ein Glas. Brot? Brötchen? Fehlanzeige … Wie immer am Monatsende hat Mama höchstens noch ein paar Cent im Geldbeutel.
Vanessa hofft, dass ihre Schwester noch einen Vorrat an Süßigkeiten hat. Oma steckt ihr doch so gerne was zu. »Melanie, hast Du von der Oma noch einen Schokoriegel übrig?« Aber die schüttelt den Kopf. »Alles aufgefuttert.«
»Das sieht man Dir an.« Vanessa hat Hunger. Und ein knurrender Magen macht schlechte Laune. Das soll die verwöhnte kleine Schwester ruhig spüren.
Melanie hat inzwischen aus Mamas Tasche den Schrankschlüssel gefischt, und den Laptop auf den Boden im Kinderzimmer aufgeklappt. Im Wohnzimmer geht es nicht, da schläft ja Mama, und in der Küche gibt es keinen Tisch.
»Spickmich.de« ist die richtige Webadresse – das beliebte Schülertreff-Portal. Vanessa und Melanie haben dort ihre Namen, ihre Schule und ihre Hobbys eingegeben. Auch schon ein paar Fotos, die sie im BOOT nachmittags im PC-Raum digitalisiert haben.
Jetzt an diesem Morgen sind beide ganz gespannt, ob sich wieder jemand gemeldet hat, mit dem sie chatten können. Ein Junge, ein wenig älter, mit dem sie sich dann die große weite Welt der Erwachsenen vorstellen – Liebe inbegriffen – das erträumen sich die beiden Kinder.
»flick, dick«, schon sind sie da. Sie haben sich die Adresse unter ihren Passwörtern und den Favoriten gespeichert, damit die Mama das nicht entdeckt. Whow, ein neuer Name, ein Junge, 15 Jahre alt. Er heißt Philipp. Er findet ihre Fotos ganz toll, schreibt er, will ihre Adresse wissen, damit sie sich mal sehen können. Sollen Sie? Die Adresse? Vanessa und Melanie gucken sich an, dann grinst Melanie: »Warum eigentlich nicht?«
Aber erst wollen sie noch mehr von dem Jungen erfahren. Vanessa tippt die Fragen ein, mit zwei Fingern, besser kann sie es noch nicht.
»Schick uns auch mal Fotos von Dir. Was sind Deine Lieblingsfilme? Gehst Du ins Kino? Hast Du eine Freundin? Was macht ihr so …«
Die Mädchen haben viele Fragen, der Junge antwortet schnell, er sitzt wohl wie sie beide an diesem Morgen vor dem PC, während seine Eltern schlafen.
Nein, ein Foto habe er gerade nicht zur Hand von sich. Aber in der Klasse sagen sie alle von ihm, er sei ganz nett. Und Kino? Harry Potter, na klar. Computerspiele sind außerdem seine Leidenschaft. Er hat einen eigenen Laptop in seinem Zimmer.
So geht das eine Stunde. Die Frage nach den Berufen ihrer Eltern beantworten die Mädchen einfach nicht. Aber sonst alles. Und am Schluss geben sie auch ihre Adresse ein. Vanessa ist erst immer noch dagegen, aber Melanie schiebt sie weg von der Tastatur und gibt die Straße und die Hausnummer ein. Schreibt aber dazu: »Wir kommen abends beide immer erst mit unseren Eltern nach Hause. Tagsüber sind wir nicht da.«
»Wann könnten wir uns dann mal sehen? Nach der Schule? Wo seid ihr nachmittags? Oder seid ihr in Ganztagsschulen? Ich kann mich ja zuerst auch mal nur mit einer von euch beiden treffen, ja?«
Philipp will offensichtlich unbedingt ein Date. Vanessa zögert. Melanie stupst sie mit dem Ellenbogen in die Seite. »Schreib doch«, überredet sie ihre Schwester: »Melanie geht immer nachmittags nach der Schule in das BOOT, das kennst Du ja. Auf dem Weg dorthin gibt es ein Cafe, davor könntest Du auf Melanie warten.«
»Okay, am kommenden Donnerstag?«
»Okay, ich bin da.«
Click, dick, die Mädchen gehen ganz schnell raus und rüber auf die Facebook-Seite. Jetzt holen doch beide erst mal tief Luft. »Meinst Du, der ist nett?«
Melanie hat jetzt doch Bauchschmerzen. »Ich kann ja auch einfach einen anderen Weg gehen, oder vorher an der Ecke stehen bleiben und ihn mir angucken, oder?«
Vanessa bleibt still und nachdenklich. Dass der Typ kein Foto eingestellt hat, irritiert sie, dass er gleich beim ersten Chatten ein Date ausgemacht hat, ist ungewöhnlich. Normalerweise wird erst ein paar Wochen gechattet, bevor man sich trifft. Das weiß sie auch von Catarina, die damit allerdings nicht viel am Hut hat. Auch Catarinas Mama warnt vor diesen Chatrooms und überwacht viel strenger als ihre Mama, was ihre Tochter so alles im Internet treibt.
Inzwischen ist auch die Mama aufgewacht. Die Sonne scheint von Osten in das Wohnzimmer. Das grelle Licht blendet sie und der Kopf brummt. In der Küche an der Spüle trinkt Andrea jetzt erst einmal drei Gläser Wasser. Danach fühlt sie sich besser. Leise öffnet sie die Tür zum Kinderzimmer und guckt kurz hinein. Die Töchter lassen sich nicht beim Computerspielen stören. Das Spiel ist viel faszinierender. Andrea ist eher erleichtert, dass sie jetzt erst mal Ruhe hat und nicht viel reden muss.
Der Kühlschrank ist leer, fast leer. Das alte Lied an jedem Monatsende. Im Schrank steht noch eine Packung Reis, eine Flasche Ketchup und zwei kleine Dosen Erbsen. Damit ist das Mittagessen gerettet. Nachmittags kann sie ja mit den Kindern zu ihrer Mutter fahren. Ungern, aber es geht nicht anders. Die kennt das schon. Am Monatsende stehen sie alle drei oft vor ihrer Tür, wenn die Tochter abgebrannt ist und die Kinder Hunger haben.
Aber Andrea hat heute noch ein viel größeres Problem. In einer Woche geht die Schule wieder los. Beide Töchter brauchen dann eine komplett neue Schulausstattung. Andrea hat hin und her gerechnet. Sie braucht 200 Euro pro Kind, das ist das Minimum, der absolute Mindestbetrag. Ihr wird ganz schwindelig, wenn sie daran denkt, dass sie 400 Euro aufbringen muss. Woher soll sie das viele Geld nehmen? Wer könnte ihr helfen? Da fällt ihr nur Pastor Ruge von der Friedenskirche ein. Mit dem kann sie so gut reden. Und der hat ihr schon oft geholfen. Vielleicht weiß er jetzt auch eine Lösung. Vielleicht gibt es auch einiges im BOOT für die rund 80 bis 100 Kinder, die da in der Schulzeit jeden Tag zum Mittagessen auftauchen. Zum Schuljahresbeginn haben die anderen Familien sicherlich die gleichen Sorgen. Schulhefte, Stifte, Bücher – das kostet alles Geld, viel Geld.
Vanessa soll zudem die Schule wechseln, von der Grundschule am Bergfelder Damm hinüber in die Gesamtschule. Dort kann sie alle Schulabschlüsse machen. Das Mädchen hat bisher gut gelernt und prima Noten mit nach Hause gebracht. Melanie fällt das Lernen nicht so leicht. Sie bleibt ohnehin noch ein Jahr in der Grundschule. Sicher, die Kinder sind dann nicht mehr zusammen in einer Schule, aber schon jetzt hatten sie unterschiedliche Unterrichtszeiten. Wenn es das BOOT nicht gäbe, wüsste Andrea nicht, wie sie das Ganze bewerkstelligen sollte. Das Geld reicht hinten und vorne nicht. Sie ist froh, wenn sie mittags nichts kochen muss. Denn der Tagessatz von 19,80 Euro reicht nie aus, um alles an Lebensmitteln, Putzmitteln, Kleidung und Schulbedarf zu bezahlen. Auch weil Andrea raucht und trinkt – das geht ins Geld. Noch versucht sie jedem Kind am Morgen einen Euro für das Frühstücksbrötchen auf dem Weg zur Schule mitzugeben. Allein das macht 44 Euro im Monat.
Pastor Ruge hat ihr zwar schon zweimal ins Gewissen geredet, aber das lässt sie nicht an sich heran. »Wo bleib denn ich«, hat sie ihn gefragt, wenn er auf Andreas Zigarettenkonsum anspricht. Dass sie trinkt, will sie überhaupt nicht wahrhaben. Die Abhängigkeit schiebt sie beiseite. Will es sich nicht eingestehen. Sie kann ja jederzeit aufhören, sagt sie sich. Wenn das Geld gar nicht mehr reichen sollte …
»Dir bleibt viel mehr Geld für Dich und die Kinder, wenn Du das Rauchen und den Alkohol einstellst«, rechnete Pastor Ruge auch bei ihrem letzten Gespräch der jungen Frau vor.
Aber heute ist Sonnabend. Und Andrea will sich nicht weiter mit diesen unangenehmen Themen belasten. Da sie sowieso kein Geld mehr hat, kann sie weder rauchen noch Bier trinken. Das ist für sie erst recht der Beweis, dass sie das jederzeit sein lassen kann. Und jetzt muss erstmal die Wohnung auf Vordermann gebracht werden.
»Kinder, Schluss mit dem Surfen, jetzt wird geputzt und aufgeräumt«, ruft Andrea ihre beiden Töchter ins Wohnzimmer. Melanie hat sich auch noch ein Glas Milch aus dem Kühlschrank geholt, mit Kakaopulver angerührt und runtergeschüttet.
»Ooch, wir sind mitten drin, muss das jetzt sein?« Die beiden Mädchen zeigen sich alles andere als erfreut. Aber Andrea lässt nicht mit sich handeln. Lockt mit Erbsen, Ketchup und Reis zum Mittagessen und verteilt Staubtücher. Der Staubsauger hat längst den Geist aufgegeben. Außerdem sind die Staub-Beutel aus. Aber Putzlappen und Wasser gibt es zur Genüge, Spülmittel ist auch noch da – und dann helfen alle zusammen. Nach zwei Stunden sieht es schon ganz ordentlich aus. »Uff, fertig, jetzt wird gekocht. Und dann besuchen wir Oma.«
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Neuausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2013
- ISBN (eBook)
- 9783942822466
- DOI
- 10.3239/9783942822466
- Dateigröße
- 1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2013 (März)
- Schlagworte
- Kinderarmut Politik Gesellschaft Familie Zukunft Deutschland ebook hey Maria von Welser teufelskreis Margot Käßmann Ursula von der Leyen hans bertram hamburg die tafel unicef