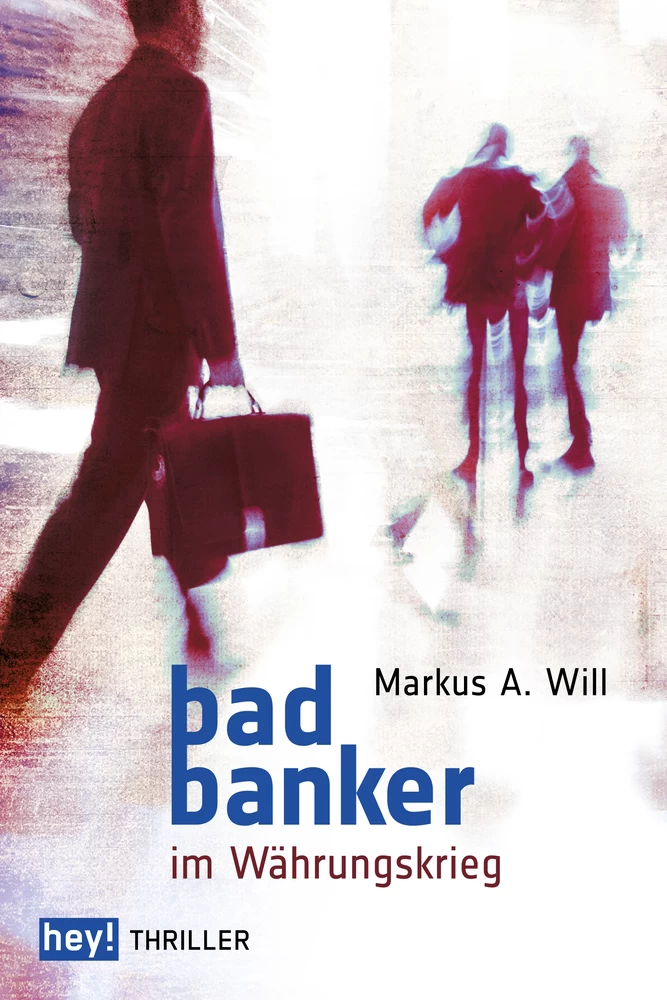Zusammenfassung
Wer hätte gedacht, dass der Euro zu einer griechischen Tragödie mutiert? Oder dass China und die USA einen Krieg führen, von dem niemand so richtig etwas mitbekommt? Der Schweizer Bankier Carl Bensien will mit Hilfe einer geheim operierenden "Viererbande", die seit Jahren über den "Schwur von Piräus" verbunden ist, die Welt vor dem drohenden Desaster bewahren. Während sich die Staaten wie in einem Stellungskrieg belauern, beginnt Bensien wie ein Agent in feindlichen Lagern zu operieren. Doch nicht nur den Bad Banker ist Bensien ein Dorn im Augen, sondern auch dem ein oder anderem Staat ...
Markus A. Will liefert mit "Bad Banker im Währungskrieg" eine brandaktuelle Erweiterung von "Der Schwur von Piräus" (2011), in der die Verbrechen um die Eurokrise in über 60 Extraseiten bis Ostern 2013 weitergeschrieben werden.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Letztes Abendmahl
„Cyprus was not too big to fail.” Wenn er über die Eurokrise sprach, rutschte Dr. Konstantin Diospolos immer wieder ins Englische. Seine dazu passende, herablassende Handbewegung brachte Stratos auf die Palme. Von seinem wütenden Zittern klapperte sogar das Messer leicht auf dem säuberlich leer gegessenen Teller. Der im feinen Zwirn gewandete Europäische Zentralbanker Diospolos war sein letzter Gast an diesem Gründonnerstagabend 2013.
Dieser Arroganzling, vor dem Stratos, der Chef des „El Greco“ mit dem Geschirr stand, war nicht mehr der Diospolos, den er kannte, als dieser noch in den niederen Chargen der Europäischen Zentralbank gearbeitet hatte. Er war nicht mehr der junge Grieche aus bestem sozialistischem PASOK-Hause, der mit Unterbrechungen schon viele Jahre in seinem Restaurant in Frankfurts Innenstadt etwas Heimat suchte. Nicht der Diospolos, der ihm Kunstwährungen á la Bitcoins und der Deutschen Liebe zur alten D-Mark so leichter Hand erklären konnte. Doch Diospolos war es überdrüssig, diese Verrücktheiten noch normalen Menschen zu erklären, einfach zu müde geworden. Ausgelaugt war der monetäre Powerman. Zurzeit schienen die Bürger irgendwie allen alten oder digitalen Währungen mehr Vertrauen entgegenzubringen als dem Euro.
Natürlich wusste der kleine Restaurantbesitzer Stratos nicht, mit welchen Problemen die großen Zentralbanker zu kämpfen hatten. Bitcoins schossen in die Höhe, obwohl kein Mensch sie garantierte, sondern ein Algorithmus im Computer sie berechnete. Deutsche Volkswirtschaftsprofessoren gründeten eine „Alternative für Deutschland“ und wollten alternativlos raus aus dem Euro. Was war dagegen diese kleine mickerige Insel der Aphrodite im Mittelmeer?
Aber das wusste Stratos natürlich nicht. Doch noch einmal würde er für seinen späten Stammgast aus der EZB wohl nicht wieder selbst die Küche anschmeißen, nachdem schon alle Gäste weg waren und ihm eine kleine Platte mit Gyros, Souvlaki, Zaziki und Taramasalata machen. Stratos griff nach dem klappernden scharfen Messer, mit dem Diospolos ungestüm das Fleisch bearbeitet hatte. Selbst beim Essen hatte er kaum mehr Zeit. Gehetzt, gestresst und genervt. Das war seine seit Monaten vorherrschend unbeherrschte Art geworden.
Der Währungskrieg hatte auch aus ihm einen bad banker gemacht. Ob es schon die Zeit beim Internationalen Währungsfonds, die kurze Episode als Staatsminister in Athen oder die Sonderrolle in Italien gewesen war, wusste Stratos nicht. Doch spätestens seit er als Büroleiter von Mario Draghi, dem Präsidenten der EZB, arbeitete, war er anders geworden. „Decisiveness“ war seine Lieblingsvokabel, zur Beschreibung der in unzähligen Krisen zur einzig wahren Macht in Europa aufgestiegenen EZB.
Wenn die Zentralbanker wie in der letzten Woche über Zypern ihren Daumen zu senken bereit waren, dann ging die Schlacht in ihre entscheidende Phase. Unmissverständlich hatte der Rat der EZB den Zyprioten ein Ultimatum gesetzt: ELA sollte wegfallen. Das war kein Kosename für eine Muse, sondern die Kurzform für die Emergency Liquidity Assistance, mit der die zypriotischen Banken mit Geld versorgt wurden, das ihnen niemand anders mehr geben wollte.
Erst nach dieser kleinen Argumentationshilfe – anderen nannten es Erpressung – knickten die Zyprioten ein. „Anderenfalls wäre es so gewesen, als würden einem Intensivpatienten die lebenserhaltenden Apparate abgestellt“, hatte Dispo Stratos während des Hauptganges erklärt, um sein Gleichnis dann selbst lachend als „schief“ zu bezeichnen, „weil die Zyprioten ja gar nicht leben wollten.“ Da war Stratos zum ersten Mal der Kamm geschwollen, aber er hatte sich noch einmal zurückgehalten.
„Was erlaubte sich dieser griechische Arroganzling eigentlich, seit er mit diesem Italiener ohne jede demokratische Legitimation Europa unter das Kuratel der Zentralbank stellte?“, schoss es ihm durch den Kopf. „Angeführt ausgerechnet von einem italienischen Geldgeneral, dessen eigenes Heimatland noch nicht einmal eine stabile Regierung zustande brachte, hoch verschuldet und neben Frankreich doch das wahre Risikoland für den Euro war. So sah es doch aus“, glaubte Stratos. Außerdem schien alles ein bisschen ruhiger in Europa geworden zu sein, seit Griechenland gerettet und die anderen Südländer versorgt waren. Aber das war nur eine trügerische Ruhe gewesen.
Dann kam Zypern. Es war das Zeichen, wie (be)trügerisch doch eigentlich alles war. Stratos verstand die Welt nicht mehr. Auch er hatte jetzt natürlich begriffen, dass das Geschäftsmodell der Mittelmeerinsel, das bislang fast die Hälfte der Wirtschaftsleistung ausgemacht hatte, nicht mehr existent war. Allein der Gedanke daran ließ nun auch noch die Gabel auf dem Teller klappern. Der griechische Inselteil hatte als Teil des Eurosystems russische Schwarzgelder und sonstige Mafiamoneten mit hohen Renditen für griechische Staatsanleihen auf die Mittelmeerinsel gelockt. Die zypriotischen Banken hatten sich noch mit griechischen Anleihen vollgesogen, als wirklich alle anderen schon mit einem Schuldenschnitt rechneten.
Zwischen Nikosia, Moskau und Athen gab es seit Jahren jedenfalls regen Flugverkehr an Privatjets, wie die Zeitungen jetzt süffisant berichteten. Man hatte die Zyprioten machen lassen, Brüssel hatte weggeschaut. Dann war es zu spät.
Das war es nun auch für den griechischen Zyprioten Stratos Vangelos. Von seinem sauer in Deutschland zusammengearbeiteten und –gesparten, auch noch ehrlich versteuerten Geld waren 40 bis 50 Prozent weg; denn Stratos hatte weit mehr als 100.000 Euro auf die Bank gebracht. Zum ersten Mal in der Geschichte ging es Sparern wie Stratos ans Eingemachte. Für ihn würde es nichts werden mit der Heimkehr auf die Insel der Aphrodite, wo selbst die kälteste Jahreszeit ein ewiger Frühling war und nicht so ein Winter wie dieses Ostern 2013. Stratos fröstelte, das Klappern auf dem Teller ging weiter, angetrieben von Wut und Kälte.
Europa war nicht mehr wie früher. Die Arbeitslosigkeit explodierte in der Europäischen Union, in der in manchen Ländern jeder zweite Jugendliche keine Arbeit und damit keine Zukunft mehr hatte. Täglich sah Stratos im Fernsehen die Bilder der Trostlosigkeit, gemischt mit drohenden Konjunktureinbrüchen. Erst mit seinem Geld auf Zypern war er persönlich betroffen; denn ansonsten lebte er ja auf der Insel der wirtschaftlichen Glückseligkeit - in Deutschland.
Immer weniger Europäer mochten die Deutschen, immer weniger Deutsche mochten Europa. Und immer mehr Deutsche wollten ihre D-Mark zurück. Eine Partei mit dem Namen „Alternative für Deutschland“ befand sich in Gründung und wollte den Austritt Deutschlands aus dem Euro verhandeln. Ausnahmsweise gab Stratos hier Diospolos recht, der sich über die „apolitischen und weltfremden Professoren“ aufregte, die „den Deutschen eine Alternative vorgaukeln, die es nicht gibt.“ Müde erhob sich der Europäische Zentralbanker. „Rezession, Isolation, Konfrontation, Eskalation und dann, mein Lieber, kommt unsere eigene Exekution.“ Dabei hielt er Stratos die fünf Finger seiner Hand vor das Gesicht. „Das kommt dabei heraus. Und du jammerst über das mickrige Zypern.“
„Wieso habt ihr uns nicht wenigstens gewarnt, Konstantin?“ Schließlich hatte man auch Griechenland, Spanien, Portugal und sogar Italien immer wieder unter die Arme gegriffen und die Lage eigentlich ganz gut stabilisiert. Stratos hatte kleine Schweissperlen auf der Stirn, die im die Wut aus den Poren gepresst hatte.
„Es war doch offensichtlich. Du hättest dein Geld halt abziehen sollen, als es noch gegangen wäre.“ Konstantin hatte seit zwei Wochen kaum geschlafen, seit nach den ersten Verhandlungen sogar die Kleinsparer zur Schuldentilgung herangezogen werden sollten. Seitdem grassierte die Angst vor dem Verlust des Ersparten – zumal der neue Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem dieses Vorgehen als Vorbild für andere Krisenstaaten bezeichnet hatte.
Er hatte diese Aussage zwar sofort wieder zurückgezogen, aber es war in den Köpfen der Menschen. Worte und Währungen als Waffen gehörten zu Diospolos‘ Wachkoma. Seit eineinhalb Jahren an der Seite Draghis kannte er dieses latente Schlafdefizit vor, während und nach den unzähligen Krisengipfeln. Die letzten 14 Tage aber hatten nicht zuletzt wegen des jungen Holländers Dijsselbloem alles in den Schatten gestellt.
„Ich bin Zypriot und Patriot,“ entrüstete sich Stratos.
Diospolos wollte beim besten Willen nicht mehr erklären und verteidigen, was man in den letzten Wochen getan hatte. Er wollte nur noch heim und endlich einmal ausschlafen.
„Stratos, du bist zwar Zypriot, aber kein Patriot, sondern ein Idiot.“ Natürlich hätte er ausgeschlafen nie so etwas gesagt, was er nun müde vor sich hin grummelte, während er eine 50er-Note auf dem Tisch warf. Er hätte die Gabel klappern hören, das Messer sehen können, aber er hörte eben nicht mehr richtig zu und sah nicht mehr richtig hin. „Stimmt so, mein Lieber. Für den Neuanfang.“ Dabei klopfte er Stratos auf die Schulter.
„Ich mag zwar ein Idiot sein, aber dafür war das dein letztes Abendmahl.“ Stratos rammte ihm das Messer mitten ins Herz.
Teil I: Sprachlos in Davos
7. und 8. Januar 2010
Die Viererbande
Immer am ersten Donnerstag eines neuen Jahres traf sich die Viererbande bei einem Griechen. Am 7. Januar 2010 um 20 Uhr in Frankfurt am Main im “El Greco“, einer ehemaligen Kneipe mit typisch deutscher Einrichtung: schweres dunkles Holz, große Theke und einfache Stühle mit Tischen, denen man die Jahrzehnte Stammtischrunden mit Pils und Korn noch ansah. Mit Bildern der Akropolis und ein paar Skulpturen von Athena bis Zeus verziert, sah das El Greco nicht wirklich griechisch aus, aber Stratos war weit und breit der beste griechische Koch, wie der Gastgeber des Abends besser als alle anderen beurteilen konnte: Dr. Konstantin Diospolos war an der Reihe die Viererbande zu bewirten.
Da es am Montag noch einmal kurz zurück an den Arbeitsplatz bei der EZB, der Europäischen Zentralbank, ging, hatte ‚Dispo‘, der Grieche der Viererbande, nach Frankfurt geladen. Elegant in dunkelblauem Cord, ohne Krawatte, stand der kleine Währungsspezialist mit viel zu stark gegeltem Haar bei Stratos, dem Restaurantbesitzer, und wartete auf seine Gäste. An Frankfurt und seine hessische Küche konnte und wollte er sich auch nach fünf Jahren nicht gewöhnen. Berlin, wo er 1970 auf die Welt gekommen war und fünf Jahre mit seinen Eltern im Exil gelebt hatte, war ihm deutlich näher. Seine Mutter war Deutsche, eine waschechte Berlinerin, die sich in einen jungen heißblütigen Griechen verliebt hatte. Die Odyssee durch die Finanzkapitalen dieser Welt würde alsbald eine neue Etappe bieten: Büroleiter des IWF-Chefs in Washington sollte er Ende Januar werden, noch rechtzeitig vor dem World Economic Forum in Davos.
Als Erste der Bande traf ‚Friedhof‘ im El Greco ein, immer ein wenig überpünktlich, was ihrem generell überkorrekten Charakter entsprach. Annafried Olson geborene Fjordhof und von allen deshalb nur Friedhof genannt. Ein Name, den ihr das deutsche Bandenmitglied Ellen Klausen verpasst hatte. Friedhof verband den Trip nach ‚Mainhattan‘ mit einem Besuch beim Statistischen Bundesamt in Wiesbaden, aber natürlich zahlte sie die Tage vor der Arbeit in Wiesbaden aus ihrer privaten Schatulle. Als Beamtin bei EUROSTAT, dem Statistischen Amt der Europäischen Union in Luxemburg, war sie bis zum Jahresende für Deutschland zuständig gewesen. Als solche musste sie noch das Zahlenwerk für 2009 abschließen, wofür sie ein paar Tage brauchen würde. Dass sie nun ausgerechnet Chefin für die südeuropäische Gruppe würde, war zwar ein Gehalts- und Karrieresprung, aber um die Zahlen der Südländer hatte sie bislang einen großen Bogen gemacht. Seit das Land 2001 dem Euro beigetreten war, gab es Verfahren gegen und Schwierigkeiten mit Defiziten von Griechenland.
Der neue Job würde alles andere als ein Zuckerschlecken sein. Griechenland war auf dem besten Weg, das Sorgenkind der Europäischen Union zu werden. Sie spürte förmlich, dass die Eurozone in den nächsten Monaten eine griechische Tragödie erleben würde. Im Herbst 2009 hatte die neue griechische Regierung unter Giorgos Andrea Papandreou zugeben müssen, dass die Neuverschuldung viel höher war als bislang offiziell angegeben: 12,7 Prozent statt der erlaubten drei Prozent. Noch im Dezember hatten Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit Griechenlands herabgestuft und damit einen gewaltigen Risikoaufschlag der Staatsanleihen ausgelöst. Die Schulden wurden unbezahlbar.
Griechenland war das Problem des Euro und damit von nun auch das von Friedhof. Griechenland hatte sich in die Eurozone hineingelogen. Anna traute der ganzen Sache nicht, selbst den neuen Zahlen nicht. Sie wollte sich erst einmal richtig in die Datenmengen eingraben. Die Griechen hatten Militärausgaben nicht als solche deklariert und damit ihre Verschuldungsquote gedrückt. Aber die früheren griechischen Regierungen hatten vor allem ihr Volk belogen, hatten ihnen vorgegaukelt, dass sie besser im europäischen Wettbewerb lägen, als sie es am Ende taten. Sie hatten mit Staatsgeldern ein System aufrechterhalten, das schon lange nicht mehr funktionierte. Griechenland war zu teuer, um im europäischen Wettbewerb zu bestehen.
Nun musste die neue Regierung unter Papandreou das alles ausbaden. Den stolzen Griechen nicht nur die Wahrheit sagen, sondern auch den Europäern, die es aber alle im Prinzip zumindest geahnt haben mussten. Die Heuchelei ging Anna schon jetzt fürchterlich auf die Nerven. Das jetzige Tamtam ging gegen die griechische Ehre – da musste sie sich nur den heißblütigen Dispo anschauen –, aber Annafried wusste genau, dass es keine Alternative gab. Sonst drohte die Staatspleite, etwas, das in der Eurozone nicht vorgesehen war.
Nicht nur das hatte sie der Bande zu berichten, sondern auch die stille Trennung von Mr. Olson. Nach dahinplätschernden, aber nicht unglücklichen Jahren mit ihm hatte Annafried im Herbst feststellen müssen, dass der Gute sie seit Jahren betrog. Betrug war nicht ihre Sache. Entwaffnend war allerdings sein einziger Vorwurf, den der Mann, mit dem sie zehn Jahre verheiratet war, ihr gegenüber gemacht hatte: „Sieh dich doch an, Anna, sexy ist etwas anderes“. Zwar änderte das nichts für die blonde Dänin, doch machte sie sich selbst Vorwürfe, sich zu sehr in die Arbeit vergraben zu haben. Eben darum wollte sie ihr Leben ändern, aber ohne Mr. Olson.
Annafried wusste, dass sie ihren neuen Stil noch finden müsste. Sie hatte sogar einen style coach aufgesucht. Statt dunkle trug sie nun helle Farben, vorzugsweise beige, und dies selbst im Winter. Die glatt geschnittenen Haare waren einem hübschen Stufenschnitt gewichen, und selbst Schmuck zierte die schlanke mittelgroße Dänin. So war es vielleicht auch gar kein schlechter Zufall, dass sie die Südländer übernehmen musste. Die bevorstehenden Reisen nach Lissabon, Madrid, Rom und Athen würden sicher auch interessanter werden als die Besuche in Wiesbaden und Frankfurt. Aber dort war nicht nur das Leben lockerer, sondern auch die Zahlenlage.
Dispo war Annas neue Lockerheit sofort aufgefallen. Doch ehe er etwas sagen konnte, kam die Dritte im Bunde schon durch die Eingangstüre: ‚Miss Money‘, Dr. Ellen Klausen, lange schon geschieden und Single. Sie sah wie immer klasse aus, stellte Dispo fest, als ihr am Eingang aus dem Mantel geholfen wurde. Klein, aber klasse – alles in den richtigen Proportionen. Ganz entspannt lächelte sie beide an, was auch damit zu tun hatte, dass der junge Chinese, den sie betreute, ihr vor dem Abendessen eine Vollkörpermassage hatte angedeihen lassen, wie man sie von Europäern nicht bekam. Und Ellen kannte den Vergleich.
Ellen war froh, dass Wang Li mit nach Frankfurt gekommen war, auch wenn er sich bis zu ihrer Rückkehr alleine vor dem Fernseher im Hilton vergnügen musste. Und näher als über Wang Li konnte sie an die chinesischen Währungskrieger gar nicht herankommen. Bislang hatte sie chinesische Männer nur mit einer einzigen Ausnahme in ihr Bett gelassen. Mit Wang Li kam allerdings jemand zwischen ihre Laken, der kein Planwirtschaftler mehr war – weder im Bett noch auf dem Parkett. Vielmehr ein in feines italienisches Tuch gewandeter Kommunist. Der junge Chinese war Mitglied der KP, aber wie viele inzwischen war er auch an den besten Universitäten der Welt ausgebildet worden. Und da er unter anderem auch an der ETH in Zürich studiert hatte, sprach er sehr gut Deutsch und war somit der richtige Mann für die Basler BIZ, die Bank für den Internationalen Zahlungsausgleich.
Wang Li war Ellens neues Filetstück. Da es in der BIZ immer wieder Frischfleisch gab, wenn die Mitgliedsländer ihre Fachkräfte auswechselten, die zudem oftmals auch ihre Familien in den Heimatländern liessen, hatte die extrem gutaussehende Ellen unter der Woche nicht nur viel Arbeit im Generalsekretariat der BIZ, sondern auch ein äußerst zufriedenstellendes Liebesleben. Da die Deutsche fest zur BIZ gehörte, wurde sie auch nicht ausgetauscht und hatte ihren Hauptwohnsitz in Basel, während ihre wechselnden Lover oft am Wochenende nach Hause flogen.
Das Schöne an Wang Li war, dass er ganze zwölf Monate in Basel blieb und nur selten nach Hause flog. Sechs Monate waren bald rum. Mr. Li sollte danach im Umfeld des chinesischen Notenbank-Präsidenten eingesetzt werden und damit im Zentrum einer der inzwischen bedeutendsten Machtfaktoren internationaler Währungspolitik. Hier saß die eine Armee der Währungskrieger, die gegnerischen Truppen, zunehmend schwächer werdend, in Washington.
Ellen war klar, dass Wang Li in Basel den letzten Schliff bekommen sollte, um hinterher dem Yuan in die westliche Welt zu helfen, das heißt, ihn zu einer echten Währung zu machen. Das hatte sie jedenfalls im Freundeskreis ausgeplaudert, was dort zu einigen überraschten Blicken geführt hatte: Die Chinesen wollten sich von niemandem diktieren lassen, was sie wann und wie mit ihrer Währung zu tun hätten.
Auch wenn alle drei gute Jobs hatten, schauten sie dennoch etwas neidisch auf David Wagner. ‚Goliath‘ war nicht nur ein Bär von Mann, er hatte auch den dicksten, bestbezahlten Job der Viererbande. Das sah man zwar seiner meist uneleganten Freizeitkleidung nicht an, war aber so. Als Chef des gesamten Währungsbereichs der Carolina Bank und Managing Director dürfte er Millionen Dollar verdienen oder besser bekommen. Letztes Jahr hatten sich die vier Freunde beim Griechen in London in die Haare gekriegt, weil die anderen drei ihren Goliath so richtig in die Zange genommen hatten, für das, was die Investmentbanken 2008 verbockt haben. Wenn sie sich nicht alle seit gut fünfzehn Jahren gekannt hätten, hätte Dave wohl kein Wort mehr mit diesen drei Zahlenverdrehern, Bedenkenträgern und Währungshütern gesprochen.
1995 waren alle vier Teilnehmer einer ‚European Currency Union Summer School‘ gewesen. Als beste Studenten ihrer Jahrgänge hatten sie ein intensives Auswahlverfahren bestanden und zwei Monate auf Kosten des damals gerade frisch gegründeten Europäischen Währungsinstitutes konzentriert über die bevorstehende Währungsunion geforscht und diskutiert. Das hatte ihnen alle Türen und Tore geöffnet. Denn wo gab es um diese Zeit schon junge Absolventen der Geld- und Währungspolitik, die nicht nur die reine Ökonomik, sondern auch die politische Dimension des Projektes verstanden hatten?!
Gerade dieses Jahr freute sich Dave auf seine alten Kumpel, mit denen er 1995 unvergessliche Monate in Piräus verbracht hatte – gut untergebracht in einem im Sommer verwaisten Internat in Hafennähe. Die Griechen, seit 1981 als zehntes Land Mitglied der Europäischen Union, waren schon früh dabei, sich auch für die Währungsunion zu qualifizieren, sogar mithilfe einer Summer School in Piräus.
Zufällig waren die vier am zweiten Tag in eine Arbeitsgruppe gepackt worden, die sich für ein paar Stunden um die Integration von Geldpolitik und Staatsfinanzen Gedanken machen sollte. Da Dispo aus einer guten linken griechischen Familie kam, genügte ein Anruf und die Gruppe tagte auf der Terrasse des Greek National Yacht Clubs, der auf einem Hügel am Rande des alten Hafens lag und von vorne an eine Schiffskommandobrücke erinnerte. Einer von Dispos vielen Onkeln, der in der Griechischen Zentralbank arbeitete, faxte auch gleich mal ein Argumentationspapier, sodass sie sich weite Teile des Nachmittages der Sonne widmen konnten. Nur Friedhof hatte ein schlechtes Gewissen. Doch auch sie machte zwei Monate alles mit, sie ließ sich eigentlich immer gerne mitziehen – und so entstand die Viererbande.
Als Goliath kurz vor acht Uhr die Türe zum El Greco im Frankfurter Westend aufriss, hatte er allerdings ziemlich beschissene Laune und musste sich mal richtig auskotzen. Dass Carl Bensien Mitch Lehman als Kapitalmarktchef der Carolina Bank gefolgt war, hatte er ja noch geschluckt. Doch als Bensien ausgerechnet Allan Smith, den Finanzchef der Carolina Bank, nach Kramers Tod und Carls Berufung an die Spitze der Bank, zum neuen Kapitalmarktchef gemacht hatte, stank Dave gewaltig. Auf einen ‚Dr. No Risk‘ folgte ein ‚Mr. Number Cruncher‘. So sehr Dave Carl auch als Chef schätzen gelernt hatte, Smith war ein Nichts für einen Währungskünstler wie David Wagner. Noch im Eingang stolperte Dave beinahe über Ellen, die gerade dem Kellner, der mit ihrem fast bodenlangen Ledermantel beschäftigt war, ihren schwarzen Schal reichte.
„Hallo, Miss Money, du siehst wie immer umwerfend aus.“
„Eigentlich müsstest du ja Mr. Money heißen, Goliath“. Ellen drehte sich freudig zu Dave und küsste ihn auf die Wange.
„Dann wären wir ja verheiratet, Süße.“
„Dich würde ich nur des Geldes wegen heiraten.“
„Es hat schon sinnlosere Gründe für Eheschließungen gegeben.“
„Wem sagst du das!“ Ellen löste sich aus Daves Armen, hakte sich bei ihm unter und zog ihn in das gut gefüllte Restaurant.
„Dispo hat etwas Populäres ausgesucht, scheint mir. Dahinten sind wir aber alleine.“ Im hinteren Teil, auf den Ellen deutete, gab es ein kleines Separee. Durch die offene Schiebetüre entdeckten sie Friedhof und Dispo, die ihnen freudig entgegensahen.
„Da ist ja unsere graue Maus.“
„Sei nicht so unfair, Ellen. Nicht alle können so blendend aussehen wie du. Und wenn ich recht sehe, ist sie heute gar nicht grau gekleidet.“ Dave wies mit einer kleinen Kopfbewegung auf Annafried.
„Stimmt“, erwiderte Ellen und blickte überrascht in Richtung Separee. „Recht hast du. Außerdem weißt du, dass ich Friedhof mag.“
„Ja, nicht zuletzt, weil sie dir die Daten für deine Doktorarbeit besorgt hat.“
„Du Ekel!“ Ellen boxte Dave leicht in die Seite, der dabei lachte. „War ein cum laude, und das für die Krönung.“ Nur ungern wurde sie daran erinnert, dass ihre Arbeit über ‚Die Krönungstheorie als ultima ratio der Europäischen Währungsunion‘ nicht gerade ein akademischer Hammer war. Doch anders als Annafried, die freudig strahlend auf ihre Freundin Ellen zukam, hatte Ellen politisches Gespür für das weiterentwickelt, was machbar war, und zwar mehr als alle anderen der Viererbande zusammen. Eine Krönungstheorie, bei der man erst abwarten wollte, bis alle europäischen Staaten am besten in einer Fiskalunion gleich liefen, ehe man ihnen eine einheitliche Währung überstülpen könnte, lag ihrer Meinung nach außerhalb der politischen Realität. Deshalb saß sie auch im Generalsekretariat der BIZ, und nicht in der Statistik oder einer ähnlich langweiligen Institution. Da musste sie sich nicht mit einzelnen Währungen herumschlagen, sondern arbeitete am großen Ganzen: am Währungs- und Finanzsystem, und das war immer politisch.
„Ellen, schön dich zu sehen!“, sagte Annafried und herzte die deutlich kleinere Ellen lange.
„Anna“, entgegnete sie und streichelte ihr dabei über die Wange, „toll siehst du aus. So anders.“ Ellen hielt Annafried auf Armlänge, um sie zu betrachten. „Ich freue mich auch, dich zu sehen. Mehr als die Jungs selbstverständlich.“
„Fällt dir nichts auf, Ellen?“
„Doch, nein, anders siehst du aus. Mehr Farbe und ein schöner Hosenanzug.“
„Die Brille.“
„Wie bitte?“
„Ich trage keine Brille mehr. Gelasert!“ Annafried zeigte mit einem V-Zeichen auf ihre beiden Augen.
„Stimmt, die Brille ist weg. Und du hast Farbe aufgelegt.“ Überrascht nahm Ellen eine Hand vor den Mund, während auch die Jungs sich ihnen beiden zuwandten.
„Dispo hat es auch noch nicht gemerkt.“ Der angesprochene Grieche verzog das Gesicht, als wäre er in einen ganz großen Fettnapf getreten. Den wahren Grund wollte sie sich fürs Essen aufsparen. Ellen ergriff die Chance, die Peinlichkeit zu mildern, und ging in Richtung des Griechen, während hinter ihr Friedhof und Goliath einander in den Armen lagen.
„Ich habe es sofort gesehen, kleines Superhirn.“
„Ich glaube dir kein Wort, du alter Charmeur. Aber danke, Dave. Es tut gut. Das habe ich auch erst vor den Weihnachtsferien machen lassen, um mich in der Pause daran zu gewöhnen. Mal sehen, was die im Büro sagen werden.“ Das Lasern der Augen war der Schlussstein ihrer Stiländerung gewesen, die Mr. Olson ausgelöst hatte. Nachdem sich zum Schluss auch Konstantin und Dave mit heftigem männlichem Schulterklopfen begrüßt hatten, gab es den obligatorischen Ouzo vor dem Essen.
„Nur einmal im Jahr trinke ich Ouzo als Aperitif“, verkündete die Dänin und schüttelte sich so heftig, dass ihre neue Frisur eigentlich auffallen musste.
„Dieses Schütteln und Schaudern, Friedhof, machst du auch schon seit fünfzehn Jahren.“ Dave legte behutsam seine große Pranke um die Schulter der zierlichen Dänin, die für seinen Geschmack hundert Mal besser aussah als noch letztes Jahr. Richtiggehend anziehend.
„Kinder, ich habe Hunger!“ Als Gastgeber des Abends befahl Konstantin Diospolos die Viererbande an den Tisch, eine große runde Tafel, um die herum sich eine gar nicht mehr so unscheinbare Dänin, eine mondäne Deutsche, ein alerter Grieche und ein bulliger Engländer setzten. Hätten diese vier sich nicht in Piräus per Zufall gefunden, sie würden heute kein Wort miteinander wechseln, so unterschiedlich sind sie.
Als die große griechische Vorspeisenplatte mit Taramasalata, Zaziki, Fetakäse, Hummus, Oliven, kleinen Sardellen und Sardinen, scharfen Fleischbällchen und allen anderen Leckereien auf den Tisch kam, fühlten sich die vier Freunde binnen Sekunden nach Piräus versetzt, wo man sich damals selbst als Student opulente griechische Platten leisten konnte. Der damalige günstige Wechselkurs der Drachme war ein Segen für den Tourismus.
Bis Goliath mit seiner Frage alle zurück in die Wirklichkeit holte.
„Gibt's was Neues? Ich bekomme einen richtigen Scheißchef. Carl hat mich nicht befördert.“ Derweil steckte er sich eines der kleinen Bällchen in den Mund.
„Wieso?“ Ellen fragte als Erste, ganz erstaunt. „Der kennt dich doch seit fünfzehn Jahren.“
„Vielleicht gerade deshalb.“ Das Lächeln sollte Dispos Aussage zum Witz machen, aber niemand lachte.
„Keine Ahnung, ich sehe ihn erst nächste Woche zum Vier-Augen-Gespräch.“
„Nur weil er uns vor fünfzehn Jahren betreut hat, muss er dich ja nicht zum Chef machen. Ist doch ohnehin ein purer Zufall, dass du dem letztes Jahr wieder über den Weg gelaufen bist.“
„Das stimmt auch wieder, Ellen.“
„Ich gehe übrigens zum IWF, ganz in die Nähe von Strauss-Kahn. Schon im Februar, endlich. Ein Superjob in einer Scheißzeit, würde ich sagen.“ Dispo löffelte mit etwas Brot nach der Taramasalata.
„Mich trifft's noch beschissener.“ Annafried verschluckte sich dabei fast an ihrem Stück Feta. „Ich bin seit 1. Januar Chefin der Südländer-Statistiken.“ Fast entschuldigend hob sie die Arme. Mit Messer und Gabel in der Hand sah es allerdings eher angriffslustig aus. „Inklusive Griechenland, mein Lieber.“
„Wieso erfahre ich das nicht früher, so ein Scheiß?!“ Etwas gereizt begann Konstantin Diospolos zu überlegen, was es für sein Land bedeutete, wenn Anna die Zahlen kontrollierte. Nur gut, dass er damit nichts direkt zu tun haben würde.
„Das Wort Scheiße ist für heute Abend ab sofort verboten. Gratulation an euch beide.“ Ellen ergriff das Wort in die Stille hinein. „Und noch eine Runde Ouzo für alle. Heute müssen wir noch viel lockerer werden, vor allem ihr zwei.“ Sie blickte nach rechts und links und dachte kurz an ihre Lockerungseinheit mit Mr. Li, die sich der Massage angeschlossen hatte.
Der Ouzo erfüllte seine Aufgabe. Schnell löste sich die Anfangsspannung wieder auf und jeder erzählte, ohne dass heikle Querverbindungen gezogen wurden. Ellen war eine Meisterin darin, bilaterale Gespräche zu moderieren. Das brachte zwar genauso wenig, wie bilaterale Wechselkurse zu moderieren, war aber besser, als sich wieder zu streiten: Nach Goliaths Boni vom letzten Jahr nun Dispos Euro-Drachme?
„Im Übrigen ist Griechenland ja wahrlich nicht das einzige Problem im weltweiten Währungsgefüge.“
„Wie meinst du das?“ Anna konnte so nett naiv fragen.
„Es kann Krieg geben.“
„Krieg?“ Wieder war es Anna, die erschrocken nachfragte, die Hand vor dem Mund, während die Herren zuhörten.
»Währungskrieg! Zwischen den USA und China. Dann wäre Griechenland das geringste Problem, nicht wahr, Dispo?“
„Kann sein.“ Er blieb fast regungslos sitzen, da er als globaler Fachmann und als Grieche wusste, was passieren konnte.
„Wie soll das gehen?“ Interessiert beugte sich Anna ein bisschen nach vorne, als Dave seine Hand auf ihren Unterarm legte.
„Die Währungsarmeen können abwerten, inflationieren, verschulden, fremde Devisen bunkern, Zinsen drehen, Geld drucken, mit Zöllen drohen, konvertieren, manipulieren. Es gibt ein großes Arsenal an Währungswaffen, das die Staaten nutzen können. Und inzwischen haben die Chinesen nicht nur eine Volksarmee mit Millionen von Soldaten, sondern auch Währungsreserven in zig Milliardenhöhe. Weit über zweitausend Milliarden Dollar. Wehe, wenn sie damit Unsinn machen!“
„Und ihr Kapitalmarktsöldner?“
„Wir, Anna, machen bei allem mit. Man muss nur wissen, auf welcher Seite der Front man gerade steht. Eine globale Bank hat ja kein Heimatland mehr.“
„Also auch weiter bad banker!“
„Ja, aber dieses Mal sind wir bad banker im Währungskrieg.“ Dave musste etwas verschmitzt lachen, denn er sah sich natürlich nicht als einen bad banker an.
„So ist es, Dave!“, kommentierte Ellen und biss lächelnd in ein Stückchen Brot, das sie mit einer Sardine belegt hatte.
„Es ist ein Kampf der Blöcke, Anna. Ein regelrechter Krieg. Vergiss deine Statistiken. Dollar gegen Euro runter, Euro gegen Yuan mit, Yuan im Sog des Dollar, dazu ein paar Real, Yen oder Franken, der mal wieder zur Fluchtwährung wird, als wären wir noch im Kalten Krieg. Und die Deutschen kämpfen im Welthandel gegen die USA und China, haben aber keine eigene Währungswaffe mehr. Die chinesische Währung ist nur eine heimische Recheneinheit, die im Ausland keiner haben will oder darf. Such dir etwas aus. Es ist ein großes Durcheinander.“
David Wagner hatte sich eigens einen smarten MBA-Absolventen gesucht, den er den ganzen Tag über nichts anderes machen ließ, als internationale Währungsstrategien, deren Ankündigungen und Umsetzungen mit den realen Entwicklungen an den Märkten zu vergleichen.
„Lass uns heute Abend nicht nur über Währungen reden, und schon gar nicht über Währungskriege.“ Ellen hatte die ganze Weihnachtszeit über kaum etwas anderes getan. Wang Li war nicht nur ein sehr guter Lover, er war auch ein Quell der geldpolitischen Erkenntnis. Und von denen gab es in China nicht viele. Ellen öffnete er jedenfalls die Augen für die eine oder andere Entwicklung. Informationen, die sie sehr gut für ihre Aufgaben gebrauchen konnte.
Schnell waren sie weg von den Problemen der Welt. Und als Annafried auch noch erzählte, dass sie „Mr. Olson ausgebucht“ hatte, dachte niemand mehr an Griechenland, Amerika, China, Deutschland oder wen auch immer. Ohne dass es ein Zeichen zum Aufbruch gab, standen alle vier kurz nach Mitternacht auf: Zeit für das jährliche Ritual.
Fast feierlich griff Dispo in seine Jacketttasche und zückte einen Zettel. Die anderen taten es ihm gleich. Während die Damen ihre Zettelteile aus ihren Handtaschen kramten, genügte Goliath ein einziger Griff in seine Innentasche. Alle vier schoben ihre in Plastik eingeschweißten Zettel-Viertel in die Mitte des inzwischen frei geräumten Tisches. Da sie alle, und zwar seit fünfzehn Jahren, immer in der gleichen Anordnung saßen, fügte sich das Bild aus den vier gleich großen Teilen wie immer perfekt zu einem DIN-A4-Bild zusammen: “Währungssystem à la Diospolos, Fjordhof, Klausen und Wagner“, doppelt unterstrichen.
Das stand jedenfalls handgeschrieben oben drüber – ein paar Fettflecken von Gyros und Zaziki waren auch drauf. Und unten drunter stand: “Der Schwur von Piräus“. Alle vier hatten mit ihren Spitz-, aber auch mit ihren richtigen Namen unterschrieben: Friedhof, Dispo, Goliath und Miss Money – jeweils in der Ecke ihres Zuständigkeitsbereiches. Anfangs, als sie noch Studenten waren, hatten sie sich im Sommer für ein paar Tage getroffen, seit zehn Jahren jedoch am ersten Donnerstag des neuen Jahres.
Der Zettel zerteilte das W in vier Teile, da die Währung in der Mitte ihrer Zeichnung stand. Und weil sie damals noch nicht wussten, wie die europäische Währung heißen würde, hatten sie ein W mit einem Kreis gemalt.
„Weißt du noch, wie lange wir damals benötigt haben, um es auf die wesentlichen Dinge zu reduzieren?“
„Die halbe Nacht, mit viel griechischem Wein. Aber du hattest die Lösung, Friedhof.“ Ellen war heute noch neidisch auf die analytischen Fähigkeiten der Dänin.
„Wenn es einmal durchdacht ist, ist es ja auch ganz einfach und stimmt im Übrigen heute noch, selbst wenn echte Theoretiker über den Zettel sicher die Augen verdrehen würden: Wo sind die Zinsdifferenzen? Wo die Inflationsraten, wo das Geldmengenwachstum? Wo der freie Kapitalverkehr?“
„Recht hast du, das braucht man alles erst, wenn man die Grundfragen geklärt hat.“ Konstantin hatte schon lange nicht mehr auf das ganze Gefüge geschaut, da ja jeder nur sein Viertel besaß. Anna hatte die FISKALPOLITIK mit der VERSCHULDUNG, Dave die GELDPOLITIK mit den ZINSEN, Ellen die WÄHRUNGSPOLITIK mit dem WECHSELKURS und er die allgemeine WIRTSCHAFTSPOLITIK mit dem WACHSTUM. Wenn man alles zusammen betrachtete, konnte man viele Probleme mit diesem einen Blatt lösen.
„Zinsen bewegen nicht nur den Wechselkurs, sondern auch die Verschuldung. Die Verschuldung beeinflusst auch die Wachstumsdynamik und diese wiederum die relative Stärke eines Landes nach außen hin und damit auch den Wechselkurs.“
„Oder, meine liebe Anna“, fügte Ellen spitz hinzu, „stabiles Geld im Innern verhindert Inflation und stützt Wachstum. Das wiederum ist eine Folge solider Wirtschaftspolitik mit guter Bildung, Technologie und Infrastruktur. Das spült Steuern in die öffentlichen Kassen und erlaubt eine solide Verschuldung.“
„Nur dass die in letzter Zeit in vielen Staaten nicht so solide ist, und wenn wir ehrlich sind, fast überall, nicht nur in Griechenland“, steuerte Dispo nicht ohne ein gequältes Lächeln über sein eigenes Land bei, womit er darauf anspielte, dass gerade der Schlendrian in den öffentlichen Kassen die Preise trieb. Fiskalpolitik blieb in der Europäischen Union Sache der einzelnen Staaten. Nur die Geldpolitik war Gemeinschaftssache.
„Kinder, wir könnten auch über unsolide Währungspolitik sprechen.“ Ellen redete gerne so mütterlich, wenn es um Währungspolitik ging, denn in der BIZ bekam sie den unteren Teil der Abbildung hautnah mit: Wie lief die Geld- und Kreditversorgung in den Staaten, wie das Wechselkursregime? Das war Aufgabe der Geldpolitik und musste im Wettbewerb der Staaten in ihrer jeweiligen Kaufkraft bewertet werden. Gerade sie mussten aufpassen, wenn mal wieder mit Gerüchten Wechselkurse getrieben wurden, wenn in Leistungsbilanzen etwas hin- oder hergebucht wurde oder wenn kurz mal der freie Kapitalverkehr durch Kontrollen erschwert wurde.
„Die Chinesen halten sich jedenfalls kaum daran, ihre Währung international freizugeben und sie gemäß ihrer Wirtschaftskraft aufwerten zu lassen.“ Nun war es Dave, der an seinen MBA-Absolventen dachte, mit dem er genau darüber diskutierte. Wenn der Yuan nicht frei getauscht werden konnte, half eigentlich alles nichts. Genauso waren die Chinesen zum größten Gläubiger der USA geworden, indem sie ihre eingenommenen Dollar immer wieder in amerikanische Anleihen anlegten oder sich an Unternehmen beteiligten. China hatte genug Kapital, um die halbe Welt aufzukaufen.
Anna schaute die anderen an: „Ihr erinnert euch an den Streit?“
„Ja!“, tönte es aus drei Kehlen.
„Zinsen und Schulden können genausowenig getrennt betrachtet werden wie Wachstum und Wechselkurse. Das erste Problem haben wir in Europa, das zweite in China und den USA.
„Es wird schon eine Lösung geben!“ Dave gab den Gelassenen, ohne wirklich eine Antwort zu kennen.
„Wir würden jedenfalls eine Lösung finden, wenn man uns nur machen ließe. Ein paar Tage Piräus oder andere schöne Plätze dieser Erde und wir hätten's“, meinte Ellen und stupste Dave an.
„Da haben vor allem die Amerikaner etwas dagegen.“ Dispo hob fast entschuldigend die Hände.
„Was hast du gegen die Amis? Sind dir etwa die gelben kommunistischen Kapitalisten lieber?“, sprudelte es etwas hastig aus Ellen heraus.
„Wir brauchen alle, meine Liebe.“
„Kann ich das mal kurz abfotografieren?“ Dave hatte eine Idee, als er das ganze Gebilde betrachtete, und zückte sein iPhone, ehe er sich dann Annafried zuwandte.
„Nächstes Jahr bist du dran, Friedhof.“
„Da können wir uns ja in Athen treffen, Dispo.“
„Es wäre mir eine Freude, kleine Dänenkrone.“
„Besser Dänenkrone als falsche Drachme, oder?“
„Bei uns zahlt man in Euro, das solltest du bei der Rechnung berücksichtigen.“
„Ja, und zwar ziemlich teuer. Ihr lebt über eure Verhältnisse.“
„Kommt auf die Perspektive an, Anna.“
Er ließ sich leicht reizen, das wussten alle anderen drei der Bande, ein südländisches Heißblut, aber ein herzensguter Kerl. Dave und Ellen standen unschlüssig daneben, als die beiden am Ende des Tages wieder streiten wollten.
„Weißt du noch, was dein Onkel über die Rechnungen sagte, als er uns im Jachtclub eingeladen hatte, Dispo?“
„Nein.“ In der Tat erinnerte sich Dispo nicht an Kleinigkeiten wie Rechnungen, wenn er in Griechenland war. Ganz anders im Übrigen, wenn er in Deutschland war. Da war er korrekter als jeder deutsche Beamte.
„Rechnungen sind dazu da, manipuliert zu werden. Aus unserem privaten Treffen wurde doch noch ein offiziell abrechenbarer Abend mit sogenannten ‘Währungsexperten‘. So seid ihr Griechen, Dispo.“
„Nicht alle, kleine Dänenkrone.“
„Besser ehrlich draußen, als verlogen drin.“ Annafrieds Augen verengten sich zu Schlitzen. Sie wollte ihm schon heute klarmachen, dass er mit ihr erst gar nicht zu diskutieren bräuchte, wenn es um die Daten des Staatshaushaltes gehen würde.
„Anna, du kommst jetzt mit mir!“ Davids Aufforderung ließ keinen Zweifel zu, dass Annafried zu folgen hatte. Er wollte der Sache ein Ende setzen.
„Ich bin auch müde, Leute!“ Ellen spielte die Ermattete, da sie endlich zu ihrem Mr. Li zurück wollte. Der Abend war gar nicht nach ihrem Gusto verlaufen. Das zweite Mal hatte die Viererbande etwas Streit bekommen, auch wenn sie vieles wegmoderiert hatte, so wie sie das auf internationalen Währungskonferenzen gelernt hatte. Anders als dort gab sie der Runde eine ziemlich undiplomatische Abschiedsbotschaft. „Ich hoffe, wir streiten uns jetzt nicht jedes Jahr über irgend so einen Scheiß. Dann können wir die Treffen bald sein lassen.“
„Hattest du das Wort Scheiße nicht verboten?“ Dispo schaffte es mit der Replik zu einem Lacher in der Runde, ehe sich alle freundlich verabschiedeten. Der Grieche blieb noch einen Moment beim Gastwirt. Ellen bog links in Richtung Hilton, Dave begleitete Anna nach rechts in Richtung Frankfurter Hof.
Rachegefühl
Nichts tat sich in der Feuchte ihres Schoßes. Ein Gefühl, das Diana sehr befriedigte und ihr ein Lächeln entlockte, wenn sie mit sich fertig war. Erst spät am Nachmittag dieses 7. Januar 2010 stand sie mit einem Ruck auf, drückte die Zigarette aus und nahm auf dem Weg zur Dusche den letzten Schluck Bourbon. Drüben in Europa war lange schon der nächste Tag angebrochen, die Viererbande lag längst schlafend in den Betten.
Vierzehn bleierne Tage hatte sie mehr oder weniger ununterbrochen in diesem Korbsessel auf der Terrasse verbracht. Nur von wenigen Stunden unruhigem Schlaf unterbrochen, starrte Diana aufs offene Meer. Gegessen hatte sie fast nichts, geraucht viel, getrunken auch – seit vielen Jahren das erste Mal wieder unanständige Mengen. Ihr Körper wurde von Tag zu Tag ausgemergelter, das rotblonde halblange Haar verfilzte zunehmend vom stark wehenden Wind. Das weiße Hauskleid hatte seine saubersten Tage lange hinter sich. Im Grunde stank sie wie ein Schwein, doch es gefiel ihr nunmehr, sich gehen zu lassen. Seit Jahren hatte sie stets auf ihr Aussehen achten müssen, ihr Körper war ihr einziges Kapital. Bis jetzt.
Lediglich zweimal war sie zum Hafen hinuntergegangen, um Bestellungen abzuholen, die ihr ein Hawaiianer mit dem Speed Boot brachte. Natürlich musste sie sich auch bewegen, als es diese beiden unangenehmen Besuche gab. Das FBI kam ohne Anmeldung nach ‚Big Deal‘, um Diana zum Tod von Mitch Pieter Lehman und seinen Mordversuchen an Carla Bell und Carl Bensien zu befragen. Sie hatte es nicht gewusst, aber irgendwie doch geahnt. Vor fünf Tagen waren die FBI-Typen dann noch ein zweites Mal gekommen, ließen über ihr verwahrlostes Aussehen aber keine Bemerkung fallen.
Diana war es noch nicht einmal peinlich gewesen. Offensichtlich interessierten sie sich nicht dafür und wussten nichts, außer dass der international gesuchte Wladimir Godunow mit den Vorfällen zu tun hatte. Nach ihrer ‚kleinen‘ Camilla fragte überhaupt niemand. Und sie redete sich damit heraus, dass Mitch Lehman, „wie Sie ja wohl wissen“, immer sein eigenes Ding gemacht hätte.
Nur noch wenige Tage verblieben, bis die Banker aus ihren Weihnachtsferien in die City, an die Wall Street, nach Manhattan und den anderen Plätzen der globalen Kapitalmarktwelt zurückkehren würden. Gut zwei Wochen hatte mehr oder weniger Ruhe geherrscht, in denen nicht viel mehr geschehen war, als dass einer der ganz großen Trader gekillt worden war. Einer, der als Investmentbanker über Wasser laufen konnte, wie man über ihn geschrieben hatte; einer, der Nutten zur Weihnachtsfeier einlud; einer, der gleichermaßen gierig und geil war; einer, der nur mit dem Privatjet durch die Welt flog, der eine Insel und viele Villen auf der ganzen Welt besaß, von denen nicht mal er alle kannte. Und einer, der Milliarden für seine Bank verdient und Hunderte Millionen Dollar für sich bekommen hatte, sich jedoch im Bunde mit Isabella Davis, seiner ‚Rakete‘, so verzockt hatte, dass er die Carolina Bank fast ruiniert hatte. Einer, über den man beim besten Willen nicht viel Gutes sagen konnte. Kein Geringerer als ‚General‘ Mitch Pieter Lehman war vor vierzehn Tagen, am heiligen Abend, erschossen worden.
Auf dem Weg zur Dusche fiel der schmutzige Einteiler von Diana ab. Sie nahm die Außendusche auf der Terrasse am sichelförmigen Jacuzzi, starrte auf das weite, fast in alle Himmelsrichtungen offene, glatte Meer. Minutenlang lief das Wasser an ihrem Körper herab. Sie wusch ihr altes Leben von sich ab, das noch nach den Männern roch, die sie gehabt hatte, einem starken Raucher gleich, der noch Monate nach dem Entzug aus den Poren stinkt. Dreimal wusch sie ihren rotblonden Schopf. Besonders zwischen ihren Beinen ließ sich Diana viel Zeit mit dem Einseifen, um ihren matten Körper wieder richtig zu durchbluten.
Als sie die Knötchen aus dem Haar heraus gebürstet hatte, hüpfte sie in das warme sprudelnde Wasser. Es blieben ihr weitere dreißig Minuten, um alles noch einmal durchzugehen. So lange benötigte die drehbare Terrasse, um eine Runde um das Obergeschoss zu vollenden. Nur auf der Nordseite war der freie Blick aufs Meer für einen kurzen Moment verstellt. Nachdem die Terrasse mit einem leichten Rückfedern zum Stillstand gekommen und Dianas Kopf im schwappenden Wasser etwas mitgekippt war, entstieg sie dem Bad, das ihr wie ein Jungbrunnen vorkam.
„Ich will Rache!“ Zum ersten Mal seit vierzehn Tagen kamen – mit Ausnahme der kurzen Wortwechsel mit den Bullen und dem Lieferanten – wieder Worte über ihre Lippen.
Vierzehn Tage zuvor fiel nur ein einziger Schuss. Mitch Pieter Lehman starb gegen 19.30 Uhr an Heiligabend 2009. Die Kugel drang knapp zwei Zentimeter oberhalb des rechten Auges in seine Stirn, verließ den Kopf am Ansatz der Wirbelsäule wieder und schlug hinter ihm ins Arvenholz. Die Wucht des Schusses haute den weltweit gesuchten Ex-Kapitalmarktchef der Carolina Bank um. Mit weit aufgerissenen Augen und einem kleinen Loch im Schädel lag er auf dem Boden des Douvalier-Bensienschen Maiensäß. Aus dem Kopf ergoss sich ein wenig Blut auf das helle Holz und verfloss in den Maserungen des ehemaligen Stallbodens. In der alten Hütte oberhalb von Zermatt in den Schweizer Bergen endete das Leben des ewigen Spielers mit seiner grenzenlosen Gier nach dem ultimativen Deal.
8.30 Uhr war eigentlich nicht die Zeit, zu der Diana normalerweise wach war, schon gar nicht am 24. Dezember. Wer wie sie meistens nachts arbeitete, hatte auch in der Freizeit einen anderen Rhythmus. Doch sie hatte diese Nacht sehr unruhig geschlafen, weil sie Angst vor dem hatte, was Tausende von Kilometern weiter östlich geschehen könnte – natürlich nicht wegen Mitch. Die ganze Nacht hatte sich Diana im Bett hin und her gewälzt, war mehrfach aufgrund der durch den heftigen Wind verursachten Geräusche aufgeschreckt. So ganz verwaist war Big Deal doch unheimlich, die Lehman’sche Privatinsel im Pazifik vor Hawaiis Big Island mit dem weißen, einem Leuchtturm gleichenden Haus auf der Spitze des freien Felsens am Rande der Insel, die nun ihr gehörte.
Bei ihren früheren Besuchen war hier immer big Party gewesen. Männer mit meist ausgebeultem Schritt, die sich eines der vielen von Mitch organisierten jungen Mädchen schnappten, als griffen sie am Buffet ‚all you can eat‘ zu. Nur Camilla oder sie packte nie ein Bekannter an. Früher hatte Mitch sie manchmal einem guten Freund spendiert, aber das war längst vorbei.
Nur noch ihm selbst gehörte sie. Erst war ihr das gar nicht aufgefallen, denn als Dienstleisterin tat sie einfach ihren Job. Doch mit dem Heiratsantrag fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Mitch hatte sie nicht mehr zum Fremdvögeln verliehen. Und Camilla wurde sowieso nicht vergeben. Nur an Godunow hatte er sie mehr oder weniger verkaufen müssen.
Mrs. Mitch Lehman beschlich seit Tagen ein ungutes Gefühl hinsichtlich der Sache in Zermatt. Lange Gespräche konnten sie ja nicht führen – ein mit internationalem Haftbefehl gesuchter Betrüger und Mörder hatte seine Nachteile in punkto Gesprächskultur. Auch Camilla konnte sie leider nicht anrufen. Alles sollte auf seine Art und Weise geschehen. Was er genau tun wollte, wusste sie nicht. Dass sie ihn nicht abhalten konnte, wusste sie umso besser. Und eigentlich waren ihr bis auf Camilla auch alle ziemlich egal. Egal, legal, illegal? Was machte das in dieser Zeit noch für einen Unterschied?
Um 8.30 Uhr, elf Zeitzonen zurück, saß sie deshalb schon lange auf der Terrasse vor dem Schlafzimmer und nippte am Kaffee, immer mit Blick auf die Uhr, Mitchs Zeichen erwartend. Nur ‚DC‘ wollte er ihr per SMS schreiben – von einem billigen Schweizer Prepaid-Handy auf ihr verschlüsseltes iPhone. Immer wieder schaute Diana auf das Display, doch ‚Deal Closed‘wurde einfach nicht gesimst. Dabei blickte sie in ihr eigenes Spiegelbild, denn solange der Bildschirm schwarz blieb, ähnelte er einem kleinen Schminkspiegel.
Die Sonne des Pazifiks und die Ruhe der Insel hatten ihr gut getan. Arbeiten musste sie nun nicht mehr, schließlich war sie Ehefrau und nicht mehr Edelhure, auch wenn ihr das eigentlich auch egal war. Vorsicht in der Kommunikation war seit Monaten geboten, auch wenn sie im November insgeheim in Moskau in Anwesenheit von Wladimir Godunow und Camilla Miller als Trauzeugen kirchlich geheiratet hatten, wobei Diana auf das jungfräuliche weiße Kleid nicht verzichtete. Wenn sie schon spielte, dann richtig. Mitch hatte das Kleid zu einem Kommentar über ihren Beruf verleitet. „From High End to Holy End“ konnte ihr jedoch nur ein gequältes Lächeln abringen und ließ keinen Zweifel darüber, was sie für einen Ehemann bekommen hatte. In der Hochzeitsnacht hatte sie ihm bewiesen, dass sie nichts von ihrer Professionalität eingebüßt hatte, auch wenn sie jetzt mit ihm verheiratet war. Diana kannte das Spiel und spielte es, und zwar besser als Mitch es je vermutet hätte.
Viele Jahre war Diana Lundgren Mitch Lehman als dessen persönliche Prostituierte zu Diensten gewesen. Sie kannte ihn intimer als jede andere. Doch als er ihr den Antrag machte, war sie völlig überrascht. Es passte überhaupt nicht in ihren Lebensplan. Nicht die junge blonde Camilla wollte er heiraten, sondern sie, die gut vierzigjährige Schwedin mit dem zweifelsohne noch ziemlich gut gebauten Körper, dem man den täglichen Sport ansah. Diana hatte immer auf ihr Kapital geachtet – mit Ausnahme der letzten vierzehn Tage.
Seit November war Diana Lundgren die zweite Mrs. Mitch Lehman, trug einen schlichten Ehering aus Weißgold und wartete auf Mitchs Privatinsel Big Deal darauf, dass der große Trader seinen letzten Deal zu Ende brachte. Etwas komisch hatten die Behörden auf Hawaii schon dreingeschaut, als sie ihnen Mitte Dezember bei der Anreise die Schenkungsurkunde für das Anwesen unter die Nase gehalten hatte. Doch das FBI war froh, weil es damit einen Fixpunkt hatte, von dem aus man Mitch suchen wollte. Selbstverständlich hatte Diana versucht, Mitch zu überzeugen, seinen letzten grossen Deal einfach zu lassen. Sie hätte die Dinge anders gelöst, wusste aber nur zu gut, dass man einen Big Trader wie Mitch nicht von einem Big Deal abhalten konnte, wenn er einmal richtig Blut geleckt hatte. Diana Lehman wusste, dass sie einen Söldner geheiratet hatte – einen Kapitalmarktsöldner zwar –, aber das machte es auch nicht anders. Sie war eine Soldatenbraut, die zu Hause zu warten hatte, bis er vom Felde heimkam oder gefallen war.
Dieser ‚General‘, wie ihn seine Kapitalmarktsöldner genannt hatten, lag in seiner eigenen kleinen Blutlache im Maiensäß oberhalb von Zermatt, elf Zeitzonen voraus. Es dauerte Stunden, bis die Kantonspolizei den toten Lehman abtransportiert, alle Spuren am Tatort aufgenommen und alle Anwesenden vernommen hatte. Erst gegen 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit kehrte bei den Douvalier-Bensiens wieder Ruhe ein: Madame bat „trotz allem“ zu Tisch. Carla hielt den ganzen Abend die Hand von Carl. Sam und Steve, die Jungs sowie Mademoiselle Rey lockerten alle wieder auf. Nur den beiden Sicherheitsleuten war jeglicher Appetit vergangen.
Später, gegen ein Uhr am Morgen, zog Carla Bell, die stellvertretende Chefredakteurin des CityView, den leicht verklemmt wirkenden Dr. Carl Emil Etienne Bensien, Chief Executive Officer der Carolina Bank, hinter sich her in Richtung ihres Zimmers im ersten Stock, das praktischerweise ein Doppelbett hatte. Carla und Carl verbrachten ihre erste Nacht miteinander, nachdem sie dem Tod ganz knapp entkommen waren. Carla wollte am nächsten Morgen neben Carl aufwachen. Dass Madame Douvalier-Bensien ihr beim Abschied zugezwinkert hatte, hätte sie fast laut loslachen lassen.
Zum Lachen war Camilla derweil gar nicht mehr zumute – der Plan war schiefgegangen. Als sie das hektische Treiben vor dem Polizeigebäude bemerkt und später den Pistenbully mit dem Sarg vom Maiensäß herunterkommen sah, war ihr klar, dass Mitch seinen letzten Deal vermaselt hatte. Doch erst gegen ein Uhr hatte sie Gewissheit. Auf der Polizeistation tat Camilla so, als suchte sie eine bestimmte Bar für einsame Herzen in der Heiligen Nacht und hatte „der Tote heißt Mitch Lehman“ aufgeschnappt. Nicht dass sie irgendetwas für Mitch empfand, schließlich hatte er sie verkauft und obendrein Diana geheiratet, aber nun wusste die Polizei bereits vom Mordversuch. Für sie wurde es höchste Zeit, Zermatt zu verlassen und Diana darüber zu informieren.
Während Wladimir Godunow – nachdem er bis auf Carla alle neun Weihnachtsgäste im Maiensäß für Mitch an den Stühlen gefesselt und für den geplanten Tod vorbereitet hatte – sich aus dem Staub machte, blieb Camilla auf ihrem Posten. Sie sollte Mitch nach den beiden Morden als Japanerin verkleidet aus dem verschneiten Zermatt herausschaffen. Japaner waren in Zermatt am unauffälligsten, da es hier fast mehr davon gab als in Tokio, selbst im Winter.
Zwei Stunden später war sie nun ohne Mitch unten im Tal angekommen. Sie hatte sich in eine blonde Skilehrerin verwandelt, saß in einem Range Rover mit Zürcher Kennzeichen und fuhr in Richtung Simplonpass. Wladimir und sie wollten sich in Domodossola treffen und über das Tessin nach Turin flüchten, um von dort aus mit einem Linienflugzeug Europa zu verlassen. Die Strecke war länger als andere, aber eigentlich konnte niemand auf die Idee kommen, dass jemand durch das verwinkelte und zu dieser Zeit verschneite Centovalli kurven würde.
Kurz vor dem Simplonpass zog sie den Lederhandschuh an, schnappte sich eines der beiden alten Handys mit schnöder Tastatur vom Beifahrersitz und tippte: LIEBE SCHWESTER, DANKE FUER DEN SCHOENEN STAENDER. LEIDER IST ER ABER VOELLIG KAPUTT GEGANGEN, ALS WIR BEIM WEIHNACHTSESSEN SASSEN. ICH MELDE MICH NACH DEM FEST BEI DIR, DEINE C.
Fast hätte Camilla dabei die Abfahrt in Richtung Simplon verpasst. Schnittig nahm sie die Kurve, öffnete das Fenster und warf das Handy in hohem Bogen in den aufgetürmten Schnee neben der Straße. 3.15 Uhr zeigte die Uhr unterhalb des Tachos am Morgen des 25. Dezember 2009. Camilla lag sehr schlecht in der Zeit, weil sich in Zermatt alles verzögert hatte. Godunow hatte ihr eingebläut, auf gar keinen Fall die Geschwindigkeitsbegrenzung zu überschreiten – das flöge in der Schweiz garantiert auf. „Scheiß Mitch“, dachte Camilla, war sich dabei aber nicht im Klaren darüber, welches von den vielen Schlamasseln sie genau meinte, die sie Mitch in den letzten Jahren zu verdanken hatte. Nur gut, dass sie fünf Millionen Dollar per Vorkasse für den ‚Blow Job‘ erhalten hatte, wie sie das Tötungskommando nannte. Bensien, Bell & Co. sollten von Mitch schließlich weggeblasen werden. Sie und Godunow hatten nichts damit zu tun, mussten lediglich für die Logistik sorgen.
Elf Zeitzonen zurück las Mrs. Diana Lehman die Nachricht auf dem Display ihres Handys. STAENDER war Camillas und ihr Codename für Mitch – seit der ersten gemeinsamen Nacht, in der seine Manneskraft nicht kaputtzukriegen gewesen war. Sie hatte Camilla mit ins Geschäft gebracht, als sie merkte, dass sie mit Mitch auf Dauer nicht mehr alleine fertig werden würde, aber auch, weil sie Camilla dominieren konnte. VÖLLIG KAPUTT ließ keinen Zweifel aufkommen: Mitch war tot!
Diana konnte gar nichts dagegen machen. Nach Empfang der Nachricht stieg sofort ein Gefühl in ihr auf, dass sie nun frei war, dass dies aber nicht das Ende sein konnte, sein durfte! Der Plan reifte wie von selbst in diesen faulen vierzehn Tagen, in denen sie ihren Körper kaum bewegt und sich dermaßen hatte gehen lassen. Auch die anderen Mitchs sollten zerstört werden. Das war ihr einziger Gedanke. Ihr Geist war wach, ihr Fleisch schwach.
Bis zum späten Nachmittag des 7. Januar 2010. Nach der Runde um das Obergeschoss entstieg sie dem Jacuzzi, trocknete sich kurz ab und ging, nur mit einem Handtuch um ihre schlanken Hüften, hinunter in die Küche und bereite sich ein Abendessen vor. Dann zog sie ein neues, gut riechendes Hauskleid an und aß langsam, aber so viel, als wollte sie die vierzehn Tage, in denen sie fast nichts zu sich genommen hatte, nachholen: Brot, das zwar etwas hart geworden war, sowie Salami, Schinken und Käse, deren Haltbarkeitsdaten noch nicht abgelaufen waren. Nur vom Alkohol ließ Diana die Finger und trank stattdessen Saft und Wasser.
Gut gesättigt machte sie sich auf und ging in Mitchs Büro im obersten Stockwerk des Leuchtturmes. Auf dem Weg dahin musste sie die Wendeltreppe durch das Schlafzimmer nehmen. Der kleine Schreibtisch, auf dem früher Mitchs Bloomberg-Terminal leuchtete, war verwaist. Wie oft war Mitch mittendrin aufgesprungen, wenn der Terminal mit neuen Flash-Meldungen blinkte, hatte die Meldungen studiert und dann telefonisch schnell ein paar Anweisungen durchgegeben. Als wenn es keine Unterbrechung gegeben hätte, hatte er sie dann weitergevögelt. Wie oft hatte sie ihn dafür gehasst!
Nachdem sie im obersten Geschoss den Laptop hochgefahren hatte, fand sie schnell die gesuchte Privatnummer in ihrer Adressenverwaltung. Mit Blick auf die Armbanduhr, eine mit Brillanten besetzte goldene Cartier, das Hochzeitsgeschenk von Mitch, schnappte sich Diana ihr verschlüsseltes iPhone: 22 Uhr Ortszeit auf den hawaiianischen Inseln. Zehn Stunden weiter westlich war es mithin acht Uhr am Freitagmorgen, eine gute Zeit zum Telefonieren. Diana tippte die Vorwahlen für England und London und dann eine siebenstellige Telefonnummer. Da sie trotz Verschlüsselung davon ausgehen musste, dass ihr Handy abgehört werden könnte, musste sie sehr vorsichtig sein. Keine zweimal klingelte es am anderen Ende ehe jemand abnahm.
„Cindy Fitzpatrick.“ Ein Lächeln ging über Dianas Gesicht.
„Diana hier“, legte sie los, ließ ihren neuen Nachnamen aber vorsichtshalber weg.
„Uh, das nenne ich eine echte Überraschung“, bemerkte Cindy nach einer kurzen Pause. Ihr Stimme klang überrascht.
„Das Leben ist voller Überraschungen, Cindy.“ Diana antwortete schnell, nicht dass Cindy gleich auflegen würde. „Ich muss dich sprechen.“
„Woher hast du eigentlich meine Privatnummer? Wieso rufst du mich zu Hause an?“
„Auf Nummern verstehe ich mich. Und eine Primadonna geht doch immer erst wieder am Montag zur Arbeit, nicht wahr?“
„Was willst du denn besprechen?“
„Das würde ich dir gerne persönlich mitteilen.“
„Kein Interesse, Diana. Das mit Lehman ist vorbei. Und die Primadonna bin ich schon lange nicht mehr.“
„Genau, meine Liebe. Wir haben beide von ihm profitiert, beide ihm gedient, diesem Dreckschwein.“ Letzteres hatte sich Diana extra für die möglichen Abhördienste ausgedacht.
„Dein Tagessatz war deutlich besser als mein Gehalt.“
„Vergiss deinen Bonus nicht. 250.000, stimmt's?“ In Cindys überraschtes Schweigen hinein, dass diese Hure ihren letzten Lehman-Bonus kannte, sprach Diana weiter. „Ich habe zwei Wochen darüber nachgedacht, was ich mit meinem Leben anfangen will.“
„Und dabei bist du auf mich gekommen?“
„Genau.“ Cindy hatte angebissen. Diana freute sich im Privatbüro des Mannes, der sie beide so oft zusammengebracht hatte.
„Wie soll das gehen?“ Am Telefon im Londoner Vorort Barnes spielte eine sichtlich interessierte Chefsekretärin an ihrer Perlenkette. „Ich bin eine gute Katholikin.“
Diana verdrehte die Augen, so wenig überzeugend klang der Vorwurf. „Amen!“
„Ich verstehe dich nicht, Diana.“
„Amen. So sei es, heißt das doch in eurem Club. Zier dich nicht, du brauchst Geld und ich habe eine Idee. Lass uns treffen, das ist keine Sünde.“ Stolz ballte Diana ihre Faust ob der wunderbaren Brücke, die sie ihr gebaut hatte. Noch mehr aber, weil sie Cindy unbedingt für ihren Plan benötigte.
„Ooookay. Wann und wo?“
„Wie wäre es zum Tee bei Fortnum & Mason am Montagnachmittag?“
„Fünf Uhr?“
„Wann sonst, meine Liebe, wir haben doch Stil, oder?“
Prohibition
Fremd kam ihr das kalte verlassene Büro am Freitagmorgen vor. Trotz warmen Rollkragenpulli, Jeans und Over-Knee-Stiefeln, die ihre langen Beine betonten, fröstelte es Carla. Noch lag die Ruhe vor dem Sturm über den leeren Schreibtischen. Erst am Montag würde alles wieder so sein wie immer. Die Investmentbanker schienen das Jahr 2008 schon fast völlig vergessen zu haben, zumindest die Händler in den Legebatterien, den großen Handelssälen der globalen Kapitalmarktwelt. Die Montagsausgabe war im Wesentlichen mit Ausblickstorys vorproduziert worden. Die erste Woche im Jahr war für Journalisten eine Saure-Gurken-Zeit. Erst am Nachmittag würden ein paar Redakteure Aktualisierungen vornehmen, sodass vor fünfzehn Uhr niemand in der Redaktion des CityView auftauchen würde.
Carla Bell war das nur recht. Nach über drei Monaten, in denen sie sich seit dem 28. September 2009, als Don Kramer ermordet worden war, zu ihrer eigenen Sicherheit verstecken musste, kam ihr die Vorstellung, dass nun alles wieder normal laufen sollte, sie täglich an ihrem Schreibtisch als stellvertretende Chefredakteurin Artikel über Banken, Börsen und sonstige verrückte Geschichten schreiben würde, sehr befremdlich vor. Die drei Monate in Zermatt, die Angst und der Tod von Mitch Lehman hatten sie zynischer werden lassen. Das ganze Anschreiben gegen die Zocker hatte doch kaum etwas bewirkt. Nach Schrott-Immobilien schienen nun Währungen oder Rohstoffe die neuen Spielzeuge der Jungs mit den ‚big balls‘ zu werden.
Schon gegen neun Uhr war sie in die Old Bridge Road gefahren, mit der Tube aus Islington kommend, wo sie gestern ihr kleines Appartement wieder reaktiviert hatte. Zwar hatte Samantha die Bude putzen, lüften und mit Blumen versehen lassen und ihren Kühlschrank gefüllt, aber der Bell’sche Körperduft war nach drei Monaten Abwesenheit völlig verschwunden. Als Carl dann gestern Morgen in Richtung New York abgeflogen war, hatte sie sich schweren Herzens zu ihrer eigenen Bude aufgemacht. Einerseits, weil Carl nun das erste Mal weg war, seit Heiligabend; andererseits, weil Carla das letzte Mal in ihrer Wohnung war, als Mitch sozusagen noch hinter ihr her war. Sein Tod beendete zwar die Hatz, nicht aber das Ende der Gier.
Unschlüssig schlenderte sie durch die Redaktion, schaute an jedem Schreibtisch vorbei – nur nicht an ihrem eigenen. Carla spürte, dass ihr die Rückkehr ins Leben schwerfiel, auch wenn sie seit September auf diesen Tag gewartet hatte, wie ein Gefangener auf seine Entlassung.
Simon hatte ihre Unsicherheit sofort gespürt und ihr die richtige Resozialisation verordnet. Vorgestern hatten sie und Carl mit Simon und dessen Frau Cecilia diniert. Im „Savoy Grill“ mussten beide dem bulligen Chefredakteur Trent haarklein berichten, was in der Heiligen Nacht passiert war. Nicht dass Carla oder Carl das gerne ausbreiteten, aber Simon hatte nicht nur ein journalistisches, sondern auch ein freundschaftliches Recht auf ‚first hand information‘.
Den Nachruf hatte Simon zwar schon in eine Ausgabe zwischen den Jahren hineingequetscht, denn mehr war ihm Mitch Lehman nicht wert. Aber wie es seiner ‚Kleinen‘ ergangen war, wollte er doch genauer wissen. Und da waren ihm die Zwischentöne schon bald aufgefallen. Ein „Wofür schreiben wir das alles?“ hatte er von seiner bissigen Carla bislang noch nie gehört. Eigentlich sah Carla noch besser aus als vor drei Monaten: schlank, schön gebräunt, das rotblonde Haar zwar immer noch lang, aber doch etwas kürzer, eleganter. „Fraulicher“, fiel es Simon während des Essens plötzlich ein, was er automatisch mit Carl in Verbindung brachte, auch wenn es mit Ende zwanzig ja ohnehin langsam mal Zeit wurde.
„Ich habe den View of the Year zwar fertig, aber wenn du bis Freitagmittag einen neuen View hast, den ich redigieren kann, dann nehmen wir deinen, Kleine.“
„Sag nicht Kleine, sonst sage ich Simi zu dir.“
„Was ist das denn?“
„Schweizer Kosename für Simon.“
„Uh!“
„Die Idee ist gut, gibt mir Zeit.“
„Du hast seit 2007 alle Views of the Year geschrieben, wenn auch nicht alle alleine.“
„Erinnere mich bitte nicht daran!“ Nach ihrem zwischenzeitlichen Rausschmiss Ende 2007 hatte Simon ihren noch nicht fertigen Entwurf einfach übernommen, erweitert, bearbeitet und dann im Blatt veröffentlicht, selbstverständlich mit beiden Namen versehen. Als sie den Artikel im View, „Achtung, Systemkrise?“, gesehen hatte, hatte sie Simon zugleich verflucht und geliebt. Ihre platonische Liebe war zwischenzeitlich verloren gegangen. Erst Ende 2008 hatten sie sich wiedergefunden. Und da Carla Kapital mitbringen konnte, war sie seit Anfang 2009 eigentlich nicht mehr seine Kleine, sondern seine Teilhaberin und Stellvertreterin – ihr Traumjob, wenn der Albtraum Mitch Lehman nicht gewesen wäre.
„Mach dich an die Arbeit, Nummer Zwei.“
„So ist es schon besser, Nummer Eins. Im Übrigen hätte ich an deiner Stelle schon damals das Fragezeichen weggelassen“, bemerkte sie mit ihrem speziellen Carla-Bell-Lächeln.
„War doch von dir?!“
„Aber noch nicht zu Ende gedacht. Nur ein Arbeitstitel.“
Eine geschlagene Stunde lang lief Carla in der Redaktion hin und her – genauso hatte sie es auch gestern Abend zu Hause in ihrer Wohnung getan. Sie machte sich Kaffee, prustete durch die Lippen vor sich hin, blätterte in den Eingangskörbchen und versuchte zurückzukommen. Carla setzte Duftnoten, aber sie hatte Resozialisierungsschwierigkeiten. Sie versuchte, sich zu konzentrieren, las unkoordiniert mal hier, mal dort und ordnete ihre Sachen, auch wenn der Schreibtisch schön aufgeräumt war. Tagesaktuelle Dinge und Planungen standen ohnehin erst für den Montag an. Carla fühlte sich nicht schlecht, war, wie sie feststellte, ganz gut informiert, da Lesen eines der wenigen Dinge gewesen war, die sie im Maiensäß, der Berghütte, in der sie sich versteckt hatte, ohne Probleme machen konnte.
Erst nach elf Uhr schaltete sie ihren PC an, musste jedoch eine ganze Weile über ihr Passwort nachdenken, ehe sie DAD tippte. Eigentlich nutzte sie immer den Vornamen ihres jeweiligen Freundes, aber im letzten September gab es niemanden. Nach Mitch hatte sie erst einmal die Nase voll von Männern gehabt. Vorsichtig tippte sie ihr neues Passwort ein und bestätigte es vorschriftsgemäß noch einmal: CARL. Ein Lächeln breitete sich über ihr Gesicht aus, nicht wegen Carl selbst, sondern weil dies ihre erste Arbeitshandlung im neuen Jahr 2010 war.
Weiterhin lächelnd, kaute sie auf einem Bleistift herum und drehte sich auf ihrem Stuhl um die eigene Achse in ihrem kleinen, aber eigenen Büro, das gegenüber des etwas größeren Kabuffs der Nummer Eins lag. In der Mitte zwischen den beiden Büros würde ab Montag wieder Annabelle thronen, die eigentliche Nummer eins, wenn sie es recht bedachte, denn sie dirigierte beide: Simon und Carla.
Carla brauchte immer erst einen Titel für ihre Kommentare, zumindest einen Arbeitstitel, an dem sie ihre Argumente regelrecht aufhängen konnte. Die Zeit dafür verbrachte sie immer wie ein kleines Kind: kauend, drehend, summend. In der Redaktion ließ man sie gewähren, weil Carla Bell immer einen guten Titel fand.
Als sie eine erneute Runde mit dem Drehstuhl vollführen wollte, hatte sie nicht genügend Schwung genommen und blieb auf halbem Weg stecken, und zwar mit Blick auf das ihr von Carl geschenkte Bild an der Wand, das New York in den Jahren 1930/31 zeigte. Carl hatte es ihr mit dem Hinweis gegeben, dass das die Zeit knapp vor der großen Depression gewesen war. Es hatte zwar den Anschein, als käme die Welt Anfang des 21. Jahrhunderts um eine erneute große Depression herum, aber ganz klar war das alles noch nicht. Auf dem Bild tranken Bauarbeiter des Empire State Building in einer Pause in luftiger Höhe.
Als Carla sich kurz fragte, ob das Alkohol war, fiel ihr ein, dass in den USA bis 1932 Prohibition geherrscht hatte, das Verbot von Alkohol und Drogen. Falls die Männer also Alkohol in ihren Thermosflaschen hatten, wäre es nicht nur lebensgefährlich, sondern auch verboten gewesen. Mit einem kleinen Schwung und einem „Bingo“ auf den Lippen drehte sich die stellvertretende Chefredakteurin zurück an ihren PC und tippte “Prohibition“.
Schreibfreude kehrte ganz plötzlich in ihren Körper zurück. Sie rieb sich die Hände und legte los. Am Arbeitstitel Prohibition würde sie ihre Argumente für verbotenes Banking aufhängen. Dass es wie bei der Prohibition zwar Prohibitionsgesetze geben müsste – verboten werden müssten beispielsweise massiver Eigenhandel oder unregulierte Hedgefonds –, aber dass vor allem das Verhalten beobachtet werden müsste. Schließlich wurde während der Prohibition in den USA mehr gesoffen als zu legalen Zeiten.
Das passte glänzend zur Lage des aktuellen Investmentbanking. Manche Kreise machten schon wieder, was sie wollten: spekulierten was das Zeug hielt auf Rohstoffe, Währungen und anderes. Gerade Währungen wurden zum neuen Spielzeug der Spekulanten. In Europa schien es, als sortierten sie die schlechten Euro-Länder geradezu, um sie dann nacheinander zu knacken. Und die Amerikaner hatten sich massiv im Ausland verschuldet, vor allem bei den Chinesen, sodass alles aus den Fugen zu geraten drohte. „Yuan Euro Dollardo“, formulierte Carla in Anspielung an ‚Ein Eldorado‘für Spekulanten, die null Interesse an den dahinter liegenden realen Wirtschaften hatten. So wie sie sich in den Jahren zuvor nicht darum geschert hatten, was mit der realen Immobilienwirtschaft passierte, als sie ihre Subprime-Spekulationsbündel schnürten.
Zwei ruhige Stunden später war sie damit fertig. Wieder einmal stellte sie fest, wie unlogisch es ist, dass manche Schriftsteller zuerst den letzten Satz ihres Buches aufschreiben. Sie ließ ihren Argumenten lieber freien Lauf und fing sie am Ende ein, wenn sie sich eine Meinung gebildet hatte. Erst dann entschied Carla normalerweise, ob sie es bei dem Arbeitstitel beließ.
Bewaffnet mit einem Kaffee, wollte sie gerade ihr Werk noch einmal langsam durchlesen, als ihr Handy klingelte, das neben ihr auf dem Schreibtisch lag. Carla zuckte zusammen, denn diese Leitung hatte sie erst gestern wieder in Betrieb genommen. Drei Monate war sie nicht erreichbar gewesen. Vorsichtig nahm sie das Gerät zur Hand. Die Nummer kannte sie nicht, aber warum sollte sie jetzt nicht wieder an ihr Handy gehen? Sie war ja zurück, am Montag würden sogar die ersten Artikel von ihr erscheinen.
„Carla Bell“, sie sprach leise, abwartend.
„Hallo, Mrs. Bell. Hier spricht Peter Hastings.“
„Wer?“
„Sorry, Pfarrer Hastings aus St. Francis.”
„Wie? Ach so, der Pfarrer aus dem Holland Park, oder?“
„Ja, richtig.“
„Woher haben Sie meine Nummer?“ Carla erinnerte sich zwar an den jungen Pfarrer, war über den Anruf jedoch irritiert. Denn das Treffen mit ihm war damals das i-Tüpfelchen gewesen, weshalb sie sich von Mitch getrennt hatte.
„Sie hatten mich angerufen. Erinnern Sie sich? Als wir abgemacht hatten, uns zu treffen. Wegen Horacio Melander.“ Seine Stimme klang freundlich, eigentlich kein Grund, schroff zu sein, nur dass Carla grundsätzlich etwas gegen Pfarrer hatte.
„Ja, stimmt. Und?“
„Ich hatte mir Ihre Nummer aufgeschrieben, für alle Fälle.“
„Und welchen Fall haben wir jetzt, Pfarrer Hastings?“ Sie strich sich mit der freien Hand durchs Haar, um sich etwas Bewegung zu verschaffen.
„Es geht um Mitch Lehman.“ Die Stimme am anderen Ende der Leitung wurde bestimmter.
„Nein, nicht schon wieder!“ Carla schlug mit der Faust auf den Tisch.
„Ich habe einen letzten Wunsch zu erfüllen.“
„Auch das hatte ich schon einmal von Ihnen gehört.“ Pfarrer Hastings hatte ihr Unterlagen übergeben, aus denen klar hervorging, dass ein Pfarrer namens Horacio Melander der Vater und eine Bardame aus Los Angeles die Mutter von Mitch war. Was für ein Elternhaus! Da sie die erste Person war, die sich nach Melanders Tod aus reiner Neugier, wie sie sich zugestehen musste, bei Pfarrer Hastings erkundigt hatte, waren ihr diese Unterlagen übergeben worden. So hatte der alte Pfarrer es verfügt. Als Carla sie am Abend an Mitch weitergegeben hatte, rastete dieser aus und Carla verließ das gemeinsame Hotelzimmer.
„Können Sie nicht verstehen, dass ich mit Mitch Lehman nichts, aber auch rein gar nichts mehr zu tun haben will?“ Am Tag nach der Flucht aus dem Hotelzimmer hatte Carla diesen schweren Unfall, der sie Monate ans Krankenbett fesselte. Dafür konnte Mitch zwar nichts, aber dies alles war Teil einer bösen Erinnerung.
„Doch das kann ich.“ Hastings Stimme wurde freundlicher.
„Na dann?“
„Wie gesagt, ich habe noch eine Pflicht zu erfüllen.“
„Ich nehme aber keine Unterlagen mehr an!“ Sie hörte Hastings herzlich lachen.
„Müssen Sie auch nicht, ich habe keine mehr. Horacio hat mir eine beglaubigte Vollmacht ausgestellt, dass ich für den Fall der Fälle Mitch eine ordentliche christliche Beerdigung zuteilwerden lasse.“ Dies überraschte Carla, denn eigentlich hatte niemand von der ganzen Gruppe im Maiensäß oberhalb von Zermatt daran gedacht, was mit der Leiche passieren würde.
„Das ist sicher würdig und recht, aber was habe ich damit zu tun?“
„Lehman hatte keine Freunde, seine Exfrau will nicht kommen, die Kinder auch nicht. Es sieht so aus, als käme kaum jemand, wenn wir, genauer gesagt, ich ihn kommende Woche beisetzen werde.“
„Sie haben nicht wirklich an mich gedacht, oder?“ Carlas Stimme war zu verblüfft, um laut zu werden.
„Doch!“
„Nein!“
„Es ist meine Pflicht, Horacios Wunsch zu erfüllen und alle anzurufen, die er unserem Wissen nach kannte. Ich werde auch noch eine Todesanzeige in der Financial Times schalten. Am Montag, Mrs. Bell.“ Doch Carla hatte nach ihrem „Nein“ schon längst aufgelegt und weinte vor sich hin. Alles war wieder da, alles, was sie verdrängen wollte aus den letzten zwei, drei Jahren.
„Was ist mit Ihnen?“ Blitzartig sprang Carla auf und drehte ihren Kopf.
„Wer sind Sie denn?“ Beim Heulen ertappt. Das passte Carla gar nicht.
„Der Neue. Sie müssen Carla sein, oder?“
Ein Anfang Zwanzigjähriger lehnte lässig in ihrem Türrahmen.
„Wie der Neue?“ Sie stand jetzt unmittelbar vor dem jungen Mann, der etwas grösser war als sie, ungefähr ein Meter achtzig.
„Wer hat Sie eingestellt?“ Carla wischte sich mit dem Ärmel ihres Pullovers die Tränen aus dem Gesicht.
„Simon. Wer sonst?“ Der neue Jungredakteur stand ziemlich verdattert vor der Frau, von der er schon so viel gehört hatte und die sich nun wie eine heulende Furie verhielt.
„Ich gebe Ihnen gleich, ‚wer sonst‘!“ Carla drückte den Mann aus dem Rahmen und schmiss ihre Türe zu. Mit einem einzigen Tastendruck hatte sie Simon an der Strippe.
„Trent.“
„Simon, wieso stellst du jemanden ein, ohne mich zu fragen?“, brüllte sie ins Telefon.
„Du meinst Vincent Blyde?“
„Ist mir egal, wie Mr. Vincent Sowieso heißt.“
„Was ist los Carla?“ Auch wenn Simon im Zurückbrüllen äußerst geübt war, blieb er dieses Mal ruhig.
„Was los ist? Ich will wissen, wen wir einstellen. Und nicht von einem Naseweis überrascht werden.“ Carla schrie nicht mehr ganz so laut. Selbstredend wollte sie Simon nicht erzählen, dass und warum sie geheult hatte.
„Carla, bitte beruhige dich! Wir mussten weiterarbeiten, auch die letzten Monate über. Carla, die Welt ist nicht stehen geblieben.“
„Du hättest mich anrufen können.“
„Damit sie dich finden, nur wegen eines jungen Redakteurs? Traust du meinem Gespür nicht mehr? Komm runter, Kleine.“ Simons Stimme blieb ruhig, auch wenn er Carla deutlich zu verstehen gab, dass ihm das, was sie hier aufführte, entschieden zu weit ging. Sie würde noch Monate brauchen, bis sie wieder die Alte war.
„Und nenn mich nicht Kleine.“ Sie sprach das sehr leise.
„Dann benimm dich auch nicht so. Komm zurück ins Leben. Vincent ist ein guter Junge, er hilft heute Nachmittag bei der Aktualisierung.“
„Ich stehe mitten im Leben, Simon.“
„Carla, du brauchst Zeit. Die kannst du haben, aber mache niemanden an, der in der Zwischenzeit auch weitermachen musste.“ Bestimmt eine ganze Minute lang schwieg Carla. Sie sollte sich ja auch Zeit nehmen. Simon hatte wohl recht, zugeben wollte sie das allerdings nicht.
„Mein View ist in einer halben Stunde fertig. Ich maile ihn dir. Um vierzehn Uhr kannst du in deine Mails schauen.“
„Okay!“
Ohne abzuwarten legte Carla auf, machte sich direkt ans Lesen ihres Views und befand eine halbe Stunde und ein paar kleine Korrekturen später, dass „Prohibition“ ein sehr guter Titel wäre. Sie bereitete die Mail an Simon vor. Ehe sie die SEND-Taste drückte, fügte Carla noch ein Post Scriptum an: „Ich hätte das Fragezeichen vor zwei Jahren weggelassen.“
Noch bevor die Redakteure für die Aktualisierungsarbeiten kommen würden, wollte Carla weg sein. Für den ersten Tag reichte ihr das Programm, genauso wie die Begegnung mit Mr. Vincent Sowieso, der sich im hinteren Teil des Redaktionsflurs über die Tickermeldungen vertieft hatte, wie Carla beim Wegstellen ihrer Kaffeetasse sehen konnte. Einen Moment zögerte sie, ging dann aber auf die Türe des Nachrichtenraums zu und lehnte sich an den Rahmen, wie es der Junge vor einer guten Stunde auch gemacht hatte.
„Vincent!“, sagte sie mit verschränkten Armen vor ihren kleinen festen Brüsten – eine Haltung, die sie sich seit Jahren angewöhnt hatte, damit ihr die Männer nicht andauernd auf die Titten gucken konnten. „Wenn du irgendjemandem erzählst, dass ich geheult habe, filettiere ich dir deine Eier!“ Sie lächelte ihn dabei an. Der Kleine würde diese maskuline Sprache sicher nicht von einer Frau erwarten.
„Okay!“ Vincent, der sitzen blieb, verschränkte ebenfalls seine Arme und lächelte feist und respektlos zurück. Wortlos drehte sich Carla um und verließ fast fluchtartig die Redaktion. Als Erstes rief sie Carl an, auch wenn sie wusste, dass er ihr nicht helfen konnte.
Lehmans Erbe
Carl fingerte gerade den Ausdruck eines Mailentwurfs „CEO to ALL“ aus dem Drucker, an dem er die letzte Stunde gearbeitet hatte. Währenddessen blickte er aus dem großen Panoramafenster auf die Morgensonne des kalten Januartages in Manhattan. Hier hatte Mitch das erste Mal versucht, ihn zu ermorden. Und wenn Tino nicht gewesen wäre, dann wäre er im letzten Oktober mausetot gewesen. Auch in Zermatt hatte er sich und Carla nicht vor dem Tod retten können. Es war Samantha, unter tatkräftiger Mithilfe seiner Mutter, der er nicht nur sein eigenes Leben verdankte.
Ein drittes Mal würde es Gott sei Dank nicht geben, denn Lehman war definitiv tot. Irgendwie beruhigte ihn das sehr. In den letzten Tagen hatte er alle Risikooptionen abgewogen und war zu dem Schluss gekommen, dass er trotzdem wachsam bleiben wollte. Da er weder Sam noch seine Mutter einstellen konnte, würde er dem Agenten Antonio alias ‚Tino“ Corleone ein Angebot machen, das dieser nicht ausschlagen konnte.
Noch war an diesem Freitag kaum jemand wieder bei der Arbeit, sein Vorzimmer verwaist und er selbst ein paar Tage früher als geplant nach New York zurückgekehrt. Die Sicherheitsleute am Eingang waren völlig überrascht, als der Chief Executive Officer so früh vor ihnen stand, seinen Ausweis zeigte, noch ein gutes neues Jahr wünschte und im Aufzug verschwand. Mit Hemd und Pullover, einer senfgelben Cordhose und braunen Wildlederschuhen sah er ohnehin nicht aus wie der CEO der Bank. Doch das Gesicht, braungebrannt, war das alte, und die Männer erkannten ihren Boss.
Erst am Montag würde sich die Kapitalmarktwelt wieder mit alter Geschwindigkeit drehen und alle hier im Anzug auftauchen. Am Montag sollte auch diese Mail vorliegen, die vom CEO an alle Mitarbeiter gehen sollte. Selbst dies hatte er sorgfältig abgewogen und sich dafür entschieden, denn anders wäre es gar nicht gegangen. Er persönlich musste Lehman mit einem Nachruf endgültig begraben.
Mit einem kräftigen Abstoß seines Fußes drehte Carl sich zurück an seinen Schreibtisch. „Der Blick zurück hilft nicht, wir müssen nach vorne schauen“, sagte er sich selbst, um sich Mut zu machen. Während der Drehung blieb sein Blick kurz am Matterhorn hängen – das Bild seines älteren Sohnes Emil, eine Kreidezeichnung. Es erinnerte ihn an Zermatt, wo ihm zum zweiten Mal die Chance gegeben worden war, seinen Beitrag weiter leisten zu können. Anders als Don, dessen Bild mit Trauerflor neben dem PC-Bildschirm einen prominenten Platz bekommen hatte.
„In deinem Sinne, Don“, toastete Carl Don mit seinem Wasser zu und legte seine langen filigranen Hände auf die Tastatur, um einige Korrekturen vorzunehmen.
Nach einer weiteren halben Stunde hatte Carl den Entwurf fertig. Mit einem Ausdruck schlenderte er hinüber in die helle Sitzecke unter dem Matterhorn und warf dabei einen Blick auf den Humidor mit den Zigarren. Auch wenn es noch Morgen war, griff Carl zu. Rauchen war zwar in öffentlichen Gebäuden nicht erlaubt, aber wenn er alleine war, tat er es hin und wieder trotzdem. Mit einer „Short Churchill“, seine Favoritin für zwischendurch, ließ Carl sich in den „Le Corbusier“, seinen Lieblingssessel, fallen.
Mit einem kleinen Gasbrenner zündete er sich die Zigarre an und blies auf die glühende Spitze bis diese hellrot aufleuchtete. Dann nahm er einen Schluck Wasser und das DIN-A4-Blatt mit dem Entwurf zur Hand. Noch ein tiefer Zug und Carl begutachtete seinen Text.
Liebe Caroliner!
Vor zwei Wochen, am 24. Dezember des letzten Jahres, ist Mitch Pieter Lehman, der ehemalige Chef des Kapitalmarktbereichs der Carolina Bank, verstorben. Er ist beim Versuch, mich – und auch andere – zu ermorden, getötet worden. Wie Sie alle wissen, hat Mitch unseren früheren CEO Don Kramer ermordet. Gibt es einen Grund für mich, zumal in meiner Funktion als CEO, an Mitch Lehman zu erinnern? Ich meine ja! Auch wenn die Umstände schrecklich sind, ist jeder Tote ein Toter zu viel.
Niemand in der Carolina Bank hat das gewollt, lieber hätten wir ihn vor Gericht gesehen, wie es sich in einem Rechtsstaat gehört. Was Mitch Lehman gemacht hat, war nicht rechtens, es war sogar betrügerisch. Er hat die Bank an den Rand des Ruins gebracht. Aber, wir haben ihn auch gewähren lassen. Wir haben ihm nicht früher Einhalt geboten. Das gehört zur bitteren Wahrheit der letzten zwei Jahre dazu, dass Mitch zu lange machen konnte, was er wollte, und nicht das, was die Carolina Bank brauchte.
Mitch Lehman war über viele Jahre einer von uns, ein Caroliner. Einer unserer Besten, ein Medienstar. Mitch glaubte, lange vielleicht aus ehrbarer Absicht, es besser zu können als andere. Er hat jahrelang das Kapitalmarktsegment geleitet und für die Bank viel Geld verdient. Wir alle wissen heute, dass diese Gewinne zu risikoreich und teilweise sogar betrügerisch waren. Die Nachwehen des Holiri-Komplotts werden wir noch lange spüren. Diese Wertpapiere werden noch lange als wertlos auf unserer Bilanz lasten.
Die Carolina Bank und manch andere Investmentbanken sind noch einmal davongekommen, weil wir gegen Manager wie Mitch Lehman hart vorgegangen sind. Hätten wir das nicht getan, wären alle Caroliner heute heimatlos. Viele Banken sind kaputtgegangen, wir haben gerade noch überlebt. Jeder Einzelne von Ihnen muss sich darüber bewusst sein, dass wir immer wieder so handeln würden. Es war und ist alternativlos.
Ich möchte Sie alle bitten, Mitch als Mensch nicht zu verdammen. Aber ich möchte Sie auch bitten, ihn als Manager nicht zum Vorbild zu nehmen. Niemand ist größer als die Organisation. Wir werden keine Stars mehr zulassen, keine Parallelorganisationen akzeptieren. Das ist meine Lehre aus der menschlichen Tragödie, damit so etwas nicht wieder passiert. Jeder Tote ist einer zu viel. Mich Lehman möge in Frieden ruhen.
Ihr Carl Bensien
Carl las den Text mehrfach. Er wollte die richtigen Worte treffen. Immer wieder dachte er nach, meist, wenn er an seiner Zigarre sog. Nach einer halben Stunde ging er zurück an seinen Schreibtisch, legte den Text vor sich hin und machte noch ein paar letzte Änderungen. „Denise wäre wohl geeignet den Text gegenzulesen“, dachte er und mailte ihr den fertigen Text. Jeder Pressesprecher würde ihm abraten, diese Mail zu schreiben. Doch in diesem Fall musste es eine Chefentscheidung geben. Denise würde ihn verstehen und hatte genügend Abstand dazu. Sein Gedanke, dass Denise eine sehr gute Pressechefin der Carolina Bank wäre, wurde durch das Klingeln der Direktleitung unterbrochen.
„Weißt du, wer mich angerufen hat?“ Ohne Gruß und Schmatz prustete Carla gleich los, als sie Carl an der Strippe hatte, der gerade die Mail an Denise verschickte.
„Woher soll ich das wissen? Guten Morgen aus New York, mein Schatz!“
„Der Pfarrer.“
„Welcher Pfarrer? Und noch einmal, guuuten Morgen, meine Geliebte!“ Wenn er sich schon wieder auf eine Frau einließ, dann sollte es mit Haut und Haaren sein.
„Sorry, Carl. Ich bin verwirrt. Guten Morgen!“
„Was ist denn los?“
„Ich habe heute Morgen einen Anruf bekommen, von diesem Pfarrer aus St. Francis.“
„Kenne ich nicht.“
„Der mir damals diese Familienunterlagen von Mitch gegeben hatte.“
„Wo ist das Problem?“
„Er hat mir gesagt, dass es nächste Woche einen Gedenkgottesdienst für Mitch geben wird.“
„Oh, ich habe gerade einen Nachruf geschrieben.“
„Wieso das denn?“
„Ich muss. Für mich ist das ein Befreiungsakt.“
„Du bist nicht ganz bei Trost, mein Lieber!“ Carla rutschte das ganz unvermittelt heraus.
„Man muss Dinge abschließen.“
„Ich nicht.“
„Mhm.“
„Wirst du hingehen? Wann findet er statt?“
„Weiß ich nicht, Carl.“
„Lass es mich wissen.“
„Ich habe dem Pfarrer nicht mehr zugehört.“
„Lass uns heute Abend deiner Zeit noch mal reden. Okay? Und beruhige dich, bitte Carla.“
„Schon in Ordnung.“ Carla war bereits an der U-Bahnstation angekommen. Sie wollte erst einmal nach Hause fahren. Wenigstens ihre Wohnung in Islington hatte schon wieder ihren Duft angenommen.
Nachdem er sich eine kurze Notiz „Denise Chief Communications Officer?“ gemacht hatte, suchte Carl Tinos Nummer in seinem Handyspeicher. Dort stand sie noch immer, seit dieser ihm im letzten Oktober das Leben gerettet hatte. Aber ‚Don‘ Corleone, wie Carl den FBI-Agenten nannte, ging nicht ans Telefon. So hinterließ Carl ihm eine Nachricht mit der Bitte um Rückruf. Bis zum Mittag blieb ihm noch Zeit, ein paar Dinge aufzuarbeiten, die im Tagesgeschäft sonst meist untergingen. Eine von Carls schlechten Managereigenschaften war, dass er oftmals allzu sehr ins Detail ging und ihm daher die Zeit für das große Ganze fehlte.
Weder als Chief Risk Officer noch als Kapitalmarktchef war das sonderlich aufgefallen. Doch seit Carl vor drei Monaten zum CEO ernannt worden war, entglitten ihm manches Mal die Dinge. Denise hatte ihn ziemlich direkt darauf angesprochen, und Carl hatte Besserung für 2010 gelobt. So nahm er den Beschwerden-Stapel wegen der Zwangsversteigerungen mit der Absicht in die Hand, sich nur einen Überblick zu verschaffen. Denn diese waren schließlich eine der Nachwehen der verdammten Subprime-Krise am amerikanischen Immobilienmarkt, die 2006 das ganze Drama ausgelöst hatte. Da man nun einmal alles wieder auf die Bücher zurückgenommen hatte, saß auch die Carolina Bank auf einer Menge von Schrottimmobilien, deren Bewohner ihre Hypotheken nicht mehr zahlen konnten. Die Juristen des Hauses rieten zu Zwangsversteigerungen im großen Stil, was – im ebenso großen Stil – Zwangsräumungen zur Folge hatte.
Warum nun ausgerechnet diese zwanzig Fälle auf seinem Tisch gelandet waren, gehörte jedoch zu jenen Details, die er nicht mehr hinterfragen wollte. Schnell, aber konzentriert arbeitete Carl die Deckblätter durch, auf denen die einzelnen Fälle beschrieben und die jeweilige Lösung ihm zur Kenntnis vorgelegt wurden. Allesamt Neu-Pleitiers, die vormals sehr gute Kunden der Bank gewesen waren. Angestellte mit Hypothekendarlehen, die wegen der Krise entlassen worden waren und nicht mehr zahlen konnten. Fälle, bei denen hohe Politiker sich für Kreditnehmer einsetzten und so weiter. Kurzum, Angelegenheiten, die der Carolina Bank richtig Ärger machen konnten und deshalb Carl zur Kenntnis gegeben worden waren.
Drei Minuten nahm sich der CEO für jeden Fall – viel zu wenig, um ins Detail zu gehen. Wollte er die vorgeschlagene Lösung seiner Fachabteilungen in Zweifel ziehen, bräuchte er pro Fall eine Stunde. Carl hatte sich für alle zwanzig Fälle jedoch ein Limit von einer Stunde gesetzt. Nach einer Dreiviertelstunde hatte er genau nach Plan bereits sechzehn Fälle bearbeitet. Der Stapel links war inzwischen ziemlich klein, während der rechte immer größer wurde.
Nur einen Fall hatte er gerade beiseite gelegt. Konnte man einer Familie mit sechs Kindern in Montana wirklich nicht mehr helfen? Diese Simsons hatten ein Haus für 200.000 Dollar mit 250.000 beliehen bekommen, worüber Carl noch immer entsetzt den Kopf schütteln konnte. Mr. Simsons verdiente zwar 5.000 Dollar netto, aber bei sechs Kindern blieb nichts für die Hypothek übrig. Mr. Simson wollte sich als Waffenhändler selbstständig machen und von zu Hause aus arbeiten, doch gerade dieses sollte zwangsversteigert werden. Zwar war Carl der freie Waffenhandel zuwider, aber in den USA war das nun einmal üblich und das könnte doch in Montana funktionieren.
Jedenfalls hatte das der zuständige Kongressabgeordnete an die Carolina Bank geschrieben, der nicht nur Patenonkel eines der Simson-Kinder, sondern auch Mitglied im Banking & Finance Committee des US-Repräsentantenhauses war. Die Simsons standen vor dem Teufelskreis, aus dem niemand mehr herauskäme und der niemandem diente. Denn wer wollte schon ein Haus in Montana kaufen? „PRUEFUNG UND WIEDERVORLAGE“, schrieb Carl an den Rand und rutschte ein bisschen mit dem Stift ab, als sein Handy klingelte.
„Hallo, Tino, danke für deinen Rückruf.“ An der letzten Weihnachtsfeier hatte er seinem Retter zu später Stunde das Du angeboten. Eine Sache, mit der Carl normalerweise vorsichtig umging. Aber der junge Beamte hatte ihm nun einmal das Leben gerettet, wofür er ihm aus Dankbarkeit auch eine Uhr zu Weihnachten geschenkt hatte – eine Swiss Military Watch 20 000 Feet mit einem speziellem Zifferblatt.
„Ich bin heilfroh, dass du überhaupt zurückrufen kannst.“
„Wir haben Glück gehabt, Tino, aber das darf man nicht weiter strapazieren.“
Carl lehnte sich in seinem Sessel zurück, blickte abwechselnd auf das Matterhorn und Don Krames Foto auf seinem Glasschreibtisch. Carla und er hatten Glück gehabt. Don Kramer nicht – in diesem Büro hatte es ihn erwischt. Auch ihn hätte es hier fast erwischt. Beinahe täglich schaute er auf das Loch, das die Kugel in das Mahagoniholz geschlagen hatte. Als der Raum renoviert worden war, hatte er darauf bestanden, dass das Loch zu bleiben hätte. „Zur Erinnerung!“, hatte er dem verblüfften Innenarchitekten erklärt.
„Das stimmt wohl.“
„Tino, ich will gleich zur Sache kommen. Hättest du Interesse, für mich zu arbeiten, als persönlicher Sicherheitskoordinator?“
„Persönlich? Ich verstehe nicht, das macht doch die Bank!“
„Richtig, aber ich will noch einen weiteren Schutz für mich und meine Familie. Jemanden, der das koordiniert, verstehst du?“
„Schon, aber warum ich?“
„Weil ich dir vertraue.“
„Das Angebot ehrt mich!“ Carl hörte jedoch so etwas wie Zweifel in Tinos Stimme, die anders als sonst klang.
„Tino, überlege es dir. Ich fliege am kommenden Mittwoch nach London.“
„Zu Mrs. Bell?“ Tino hatte über die Sicherheitsleute, die an Weihnachten in Zermatt dabei gewesen waren, etwas mitbekommen.
„Nicht zu neugierig!“
„Ich denke, es geht um die Familie.“
„Gewonnen. Sie ist Teil des Auftrags.“ Carl nickte mit dem Kopf.
„Verstehe, ich melde mich am Montag, Herr Dr. Bensien.“
„Bis dann, Agent Corleone.“
Gleich nach dem Auflegen des Hörers schnappte sich Carl die nächste Mappe mit Sonderfällen. Er arbeitete noch zwei Anfragen von Kongressabgeordneten ab und beschäftigte sich mit Pete Kerry, einem ehemaligen Mitarbeiter, der zum unteren Ende der Leistungsträger gehört hatte. In all diesen Fällen war aus Carls Sicht nichts zu machen. Er akzeptierte die vorgeschlagenen Lösungen. Blieb Maurice Gardner, ein Kunde im High Wealth Management, der eine halbe Million Dollar verloren hatte und nun sein Geld wiederhaben wollte. Von der Bank, die „ihn beschissen hätte“. Nur dass Carl keinen Beschiss finden konnte. Der Mann wusste, was er gekauft hatte. Das konnte man auch dem Brief entnehmen, der an ihn, Carl Bensien, gerichtet war. Den Gardner-Brief legte er achtlos zur Seite. Carl machte sein Zeichen, akzeptierte den Vorschlag, dass dies ein normaler Portfolio-Verlust für diesen Kunden war.
„Nichts zu machen für Mr. Gardner“, murmelte Carl und packte seine Sachen zusammen.
Er wollte sich noch ein neues Appartement anschauen. Für gut drei Jahre, bis zu seinem 60., Ende 2012, hatte er sich in die Pflicht nehmen lassen. Dann wäre selbst Carla schon 32. Frustriert über diese Erkenntnis, zog er die Türe hinter sich zu. Carl musste sich beeilen, denn nach der Besichtigung war er mit Maud Kramer zum Mittagessen draußen in New Haven verabredet. Ohne ihre Einwilligung würde er kein „Donald F. Kramer Memorial Symposium“ an dessen ersten Todestag veranstalten. Und er wollte auch noch Dons Grab besuchen und ein wenig Zwiesprache mit seinem alten Freund halten.
Auf dem Weg rief er noch einmal Carla an. Zu Hause in Islington ging sie nicht ans Telefon, erst nach fünfmaligem Klingeln dann an ihr Handy.
„Ich dachte, du meldest dich noch mal.“
„Vergessen, sorry.“
„Okay.“
„Carl, muss ich mich nun an- und abmelden?“ Carla war es nicht gewöhnt, dass sie sich an- oder abmelden sollte, überhaupt, dass sich jemand um sie sorgte, mit Ausnahme ihrer Eltern und Simon natürlich.
„Nein, das musst du nicht.“ Carl war verdutzt. So kannte er Carla gar nicht.
„Das habe ich nicht so gemeint, es tut mir leid, es ist alles zu viel im Moment.“
„Ich komme am Mittwochmorgen. Sehen wir uns?“
„Sicher, Carl, ich bin sehr gerne mit dir zusammen.“ Zu ihrer Überraschung war der etwas steif wirkende Schweizer nämlich ein ziemlich guter Liebhaber. Erst seit zwei Wochen waren sie ein Paar. Aber da sie sich schon viel länger kannten, gingen sie sehr vertraut miteinander um.
„Ich auch mit dir. Melde dich, wenn du mich brauchst.“
„Mache ich. Ich melde mich morgen. Bis dann, mein Lover.“
Dass sie dabei gluckste, erregte Carl ein wenig. So etwas wie Carla hatte er noch nicht erleben dürfen. Seit zwei Wochen hüpfte sein Herz wie das eines jungen Kerls. Konzentrieren konnte er sich jetzt jedenfalls kaum mehr richtig.
11. bis 15. Januar 2010
Es steht in der FT
Diana landete am Montagmorgen. Nach einem Zwischenstopp in Los Angeles war sie über Nacht First Class nach London geflogen. Mitch hatte ihr – außer der Insel – direkt 30 Millionen Dollar überschrieben. So, als hätte er sie für den Rest des Lebens für ihr Zusammensein mit ihm im Voraus bezahlt. Anders konnte der Typ ja gar nicht denken. Doch dass er ihr gleich so viel Geld überschreiben würde, für das sie ihm keine Rechenschaft ablegen müsste, kam überraschend. Er hatte das Geld von irgendeinem geheimen Konto aus Asien für sie transferiert und sicher auf ein Nummernkonto auf Jersey deponiert.
Bei ihrem Honorar hätte sie sich ihm für 30 Millionen zweitausend 2.000Tage zur Verfügung stellen müssen – über fünf Jahre lang. Den Spaß, sich das einmal auszurechnen, hatte sie sich nicht nehmen lassen. Geworden sind daraus nur wenige Wochen, nicht mehr als fünf, die ihre ‚Zwangsehe‘ gedauert hatte. Nun war Diana Lehman Witwe und würde sich für den Rest ihres Lebens nie wieder ihre Beine auseinanderreißen lassen und tun müssen, was Männer von ihr wollten. Sie hatte nichts gegen Männer, nur gegen zahlende Männer. Und ganz ehrlich waren ihr Frauen im Moment lieber.
Sie könnte sich ein ruhiges Leben machen, aber stattdessen wollte sie Rache nehmen. Immer wieder hatte sie sich in den vierzehn bleiernen Tagen Gedanken darüber gemacht und war zu dem Entschluss gekommen, die ganze Kaste lahmzulegen Und zwar mit dem kalkulierten Risiko einer Edelhure, die ihr Geschäft bestens verstand und sich aus Geld eigentlich nichts machte – viel weniger jedenfalls als Camilla.
Oftmals erinnerte sie sich an das, was einer ihrer allerersten Freier, ein studierter Wirtschaftsmensch, zu ihr gesagt hatte, als er ihr nach getaner Arbeit das Geld auf den Nachttisch legte. „Geld dominiert den Tauschakt. Ansonsten müsste ich dir für deinen Dienst ja etwas zu essen geben oder so. Geld macht die Wirtschaft einfacher. Man tauscht gegen Geld. Du tauscht halt Sex gegen Geld. Der Akt mit dir war den Tausch mehr als wert.“ Das hatte Diana nie vergessen. Sie war zur menschlichen Tauschware verkommen.
Allerdings würde sie Camilla gut überreden müssen mitzumachen, denn diese würde sicher keine Rache nehmen wollen. Ihr waren die Banker gleichgültig, solange sie nur gut zahlten. Camilla wollte immer nur mehr Kohle. Deshalb hatte sie sich auch an Godunow verschachern lassen und in Zermatt mitgemacht. Doch so wollte Diana die bad banker nicht davonkommen lassen. Und dafür brauchte sie zunächst einmal auch die gute alte Cindy Fitzpatrick. Aber ohne dass diese dumme katholische irische Kuh etwas davon merken sollte. Diana musste also weiter die gutgekleidete Edelhure spielen, die Cindy kannte und die sie am Nachmittag bei Fortnum & Mason treffen würde.
Ihr Zeitplan stand fest, als sie sich nach der Ankunft in die Arrival Lounge von Britisch Airways am Flughafen Heathrow zum Frischmachen zurückzog. Raus aus Jeans und Pullover, rein in den Edelfummel. Aus Mrs. Mitch Lehman wurde wieder Diana Lundgren. Nach dem Duschen und Umziehen ließ sie sich in einen der bequemen großen weichen Sessel fallen. Man stellte ihr einen Kaffee und dazu ein warmes Croissant hin. Sie griff nach der Financial Times. Die FT hatte sie schon immer lieber als andere Blätter gelesen.
Über den dampfenden Kaffee hinweg sah sie die Todesanzeige. Die Tasse wäre ihr fast aus der Hand gefallen. Diana musste tief Luft holen und brauchte eine ganze Weile, bis sie sich gefangen hatte. Sie blickte um sich und stellte fest, dass sie um acht Uhr fast alleine in der Lounge mit den großen Fenstern in Richtung der Gates und der Flieger war. Am ersten Arbeitstag flog kaum jemand. Heute war der Tag der internen Jahresauftaktsitzungen. Aber wer zum Teufel war Pfarrer Peter Hastings?
Das würde ein erster Auftrag für Cindy sein. Diana griff zum Handy und wählte deren Büronummer, denn heute Morgen musste die wieder an ihrem Arbeitsplatz in der Carolina Bank sein. Als inoffizielle Witwe wollte Diana wissen, wer und was hinter der Sache mit ‚ihrem Mann‘ steckte.
„Cindy Fitzpatrick, guten Morgen.“
„Guten Morgen, meine Liebe.“
„Diana.“ Cindy klang, als wäre sie ertappt worden.
„Ich weiß, dass wir uns erst am Nachmittag sehen, aber …“
„Du hast es auch gesehen?“
„Es steht ja in der FT.“ Diana hielt die Seite mit der Anzeige hoch, um sich selbst noch einmal zu vergewissern. „Kannst du mir sagen, nur interessehalber, wer dieser Pfarrer ist und was das mit dem Trauergottesdienst soll?“
„Nicht wirklich. Ich weiß nur, dass er vor knapp zwei Jahren hier mal angerufen hat und Mitch sprechen wollte.“
„Mitch?“
„Er wollte ihm sagen, dass ein anderer Pfarrer gestorben war. Aber mehr weiß ich auch nicht.“
„Kannst du es herausfinden?“
„Ich will sehen, was ich tun kann.“
„Danke, bis heute Nachmittag.“
„Da ist noch etwas.“ Bei Cindys Hinweis zuckte Diana zusammen.
„Was denn?“
„Wenn es dich interessiert. Carl Bensien hat einen Nachruf auf Mitch geschrieben.“
„Kaum zu glauben.“
„Der Text ist auch unglaublich. Kam per Mail heute Morgen um sieben Uhr, als alle langsam wieder eintrudelten.“
„Wieso?“
„Ich maile ihn dir mal. Immer noch diana.lundgren@hotmail.com?“ Die Hotmail-Adresse fand Cindy immer schon sehr passend für Diana. So konnte sie sich diese gut merken.
„Ja, bitte. Wir sehen uns dann um fünf zum Tee.“
Sie packte gerade ihre Sachen zusammen, als ihr Blackberry piepste und eine neue Mail ankündigte. Nachdem sie diese gelesen hatte, packte sie in Gedanken auch Carl Bensien, diesen feinen Pinkel aus der Schweiz, auf ihre SexiLeaks-Liste.
Die Händler kamen an diesem ersten Arbeitstag noch ein wenig früher als normal an Montagen. Sehr früh war der mehrere Fußballfelder große Handelssaal der Carolina Bank schon halb gefüllt. Auch wenn die riesigen Fenster viel Licht in den Saal hereinließen, war er noch ziemlich schummrig, da es draußen erst dämmerte. Zwar hatten die meisten Händler täglich in den Ferien ihre Blackberrys gecheckt, doch gab es nach gut zwei Wochen Pause Unmengen von neuen Nachrichten, die vor dem Start ins neue Handelsjahr geprüft sein wollten.
Da die Bosse der einzelnen Bereiche um acht Uhr ihre erste Sitzung im neuen Jahr hatten, wollten sie zudem vorher von ihren Abteilungen wissen, wie der Stand der Dinge war. Das wusste Carl, und deshalb hatte er verfügt, dass die Mail an alle um sieben Uhr Londoner Ortszeit vom zentralen Mailverteiler verschickt werden sollte.
„In Memoriam“, so lautete die Betreffzeile der Mail zum Tode von Mitch Lehman, sollten die Händler nicht zu Hause, sondern erst an ihrem Arbeitsplatz erhalten. Da London der Hauptsitz des Kapitalmarktchefs der Carolina Bank war und die meisten Händler noch Mitch gedient hatten, musste die Mail perfekt getimed in London aufschlagen.
Denise hatte Carl in seiner Vorgehensweise bestärkt. So war es die erste neue Nachricht des Jahres, die die Händler lasen, und das Tagesthema war gesetzt.
Ich möchte Sie alle bitten, Mitch als Mensch nicht zu verdammen. Aber ich möchte Sie auch bitten, ihn als Manager nicht zum Vorbild zu nehmen. Niemand ist größer als die Organisation. Wir werden keine Stars mehr zulassen, keine Parallel-Organisationen akzeptieren. Das ist meine Lehre aus der menschlichen Tragödie, damit so etwas nicht wieder passiert. Jeder Tote ist ein Toter zu viel. Mitch Lehman möge in Frieden ruhen.
Ihr Carl Bensien
Dieser letzte Absatz hatte es in sich, denn einem Händler zu sagen, sich einen Mann wie Mitch Lehman nicht zum Vorbild zu nehmen, war starker Tobak. Zwar hatten sie sich alle im letzten Jahr auf Carl Bensien als dem Nachfolger von Mitch Lehman eingelassen, doch geliebt wurde er in diesen großen Kraftwerkshallen der Kapitalmärkte nicht. Lehman war einer von ihnen gewesen. Bensien war immer einer von denen da oben, auch wenn Carl gemerkt hatte, dass man sich mit seiner Art durchaus Respekt verschaffen konnte.
Noch schwerer dürfte es Allan Smith haben, der neue Kapitalmarktchef, der de facto heute seinen Dienst aufnahm und der eine Stunde später die Bereichsleiter zur Morgenrunde einvernahm. Mr. Number Cruncher Allan Smith, bislang Chief Financial Officer der Investmentbank. Ein drahtiger, asketisch wirkender Oberbuchhalter mit stechenden kleinen grünen Augen, Brille und Fastglatze, gab gleich im ersten Meeting die neue Richtung vor. Nicht Renditeziele sollten die bestimmende Größe sein, sondern Risikoziele. Auf solch eine absurde Idee konnte nur ein Finanzmann kommen, ein Händler würde nie so handeln. Die Zeiten änderten sich. Um den eckigen Besprechungstisch herum sah David Wagner alle Kollegen leicht den Kopf schütteln.
„Eine Sache noch“, beendete Smith um Punkt neun Uhr das auf exakt eine Stunde angesetzte Meeting. „Lehmans Trauergottesdienst am Freitag ist eine Privatangelegenheit, meine Herren. Ich hoffe, wir haben uns verstanden.“ Smith wartete erst gar keine Reaktion ab und begab sich zur Türe. Als Erstes hinterließ er eine Nachricht für Carl, mit der Bitte, sich zu melden, sobald er in New York ins Büro käme.
“Diospolos to join IMF power center.” Diese Story stand in der Montagsausgabe der Financial Times, und damit – wie fast immer – früher als in allen anderen Zeitungen. Dazu ein hübsches Porträt des neuen Mannes in der Washingtoner Zentrale des Internationalen Währungsfonds. Das konnte die FT nicht mal eben schnell gemacht haben. Sie musste spätestens am Freitag oder Samstag einen Tipp bekommen haben, dass Dr. Konstantin Diospolos Chief of Staff des IWF-Chefs werden würde.
Dispo selbst jedenfalls hatte ein hübsches Lächeln aufgesetzt, als er am Montagmorgen in den Eurotower ging. Noch eine Woche Frankfurt, dann ein paar Tage Urlaub und kurz nach Antritt des neuen Jobs würde er nach Davos fliegen. Beim World Economic Forum könnte er alle treffen, für die er sonst ein paar 100.000 Flugmeilen bräuchte. Der Artikel war sehr gut für ihn, hatte einen positiven ‚Spin‘. Auch wenn man sich in Washington am Sitz des IWF ziemlich wunderte, wie dieses ‚Leak‘, dieses Löchlein zustande gekommen und die Nachricht schon vorab herausgetröpfelt war.
Noch bevor das griechische Finanzministerium am Mittag die Berufung des bisherigen EZB-Direktors kommentieren konnte, stand alles in der Hauszeitung des globalen Kapitalmarktes. Während die FT, das in London an Number One Southwark Bridge ansässige Finanzblatt, wirklich global war und solche News gerne aufnahm, blieb das Wall Street Journal, das andere große Finanz-Weltblatt, in seiner Ausrichtung eher die Lokalzeitung der Wall Street in New York. Europäer griffen lieber zur FT, Amerikaner zum WSJ und die Asiaten schnappten sich morgens die Finanzzeitung, mit der sie aufgewachsen waren. Wenn jemand ein Harvard-MBA gemacht hatte, las er meistens das Journal, war er an einer europäischen Business Schoolausgebildet worden, dann studierte er morgens eher die FT. Und jemand, der wie Dispo erst an der Sorbonne und dann an der Wharton Business School studiert hatte, stöberte meist in beiden Blättern. Nicht zu vergessen die Summer School in Piräus mit der Viererbande …
Bei Sir Peter Cane löste der Artikel Hektik aus, zwar nicht direkt, aber nach dem Anruf von oben. Und Hektik war etwas, das der beleibte englische Aristokrat gerade am Montagmorgen noch mehr hasste als den Euro, diese Kunstwährung des Kontinents, der Großbritannien aus seiner Sicht – Gott und vor allem Margaret Thatcher sei Dank – fern geblieben war. Auch wenn die Iron Lady bei der endgültigen Entscheidung nicht mehr an der Macht war, hatte sie die Skepsis auf der Insel dermaßen geschürt, dass kein Premierminister daran vorbei kam. Die Old Lady, wie man die Bank of England liebevoll in der City nannte, sollte der Iron Lady – aus Sicht von Sir Peter – eigentlich ein Denkmal setzen. Aber als Kommunikationsdirektor der englischen Notenbank konnte er das natürlich nicht laut sagen.
„Nein. Es tut mir außerordentlich leid, meine Liebe, aber ich kenne den Mann nicht.“ So früh rief das Büro des Governor der Bank of England selten an.
„Ja. Ja, ich kann mich umhören. Eine Expertise, die über die ›FT‹ hinausgeht?“ Sir Peter wusste, warum er diese impertinente Person im Chefbüro nicht mochte. Nicht nur, weil sie – „of course“ würde er bei ihrem Verhalten sagen – die falschen Schulen besucht hatte, sondern auch, weil sie an Grundregeln der City rüttelte. Wie sollte denn etwas besser sein als eine FT-Expertise? Da arbeiteten doch zumeist Redakteure, die auf den richtigen Schulen gewesen waren. ‚Oxbridgeboys‘, so wie er. Entweder in Oxford oder in Cambridge ausgebildet, und nicht, wie diese junge Dame an irgendeiner neumodischen Business School in Manchester oder anderswo.
Sir Peter blickte von seinem Schreibtisch auf das Foto an der Wand, das ihn mit der Queen zeigte, als sie ihn vor Jahren geadelt hatte. Für seine Verdienste rund um das Pfund Sterling nach der großen Krise, die dieser miese Spekulant George Soros ausgelöst hatte.
„Nun, meine Liebe, ich werde sehen, was ich tun kann.“ Sir Peter legte auf, ohne eine Antwort abzuwarten, sonst bekäme er von diesem jungen Ding noch eine Deadline, wann er seine Expertise abzuliefern hätte. Cane lehnte sich zurück, steckte die drei mittleren Finger der rechten Hand zur Beruhigung in das kleine Täschchen seiner Weste. Ein Dreiteiler war für ihn das Mindeste, was sich an Kleidung geziemte, dunkelblau natürlich und mit schwarzen, blankgewichsten Schuhen.
Für einen klitzekleinen Augenblick genoss er den Blick auf die alte Holzvertäfelung seines mittelgroßen Büros. Auf dem Kamin standen die Händeschüttel-Fotos – weit weg von Ihrer Majestät mit dem Schwert, als sie ihn zum Ritter schlug. Cane mit Alan Greenspan, Cane mit Jean-Claude Trichet, der junge Cane mit dem großen Karl Otto Pöhl, mit Michel Camdessus, Jacques Delors, Jacques de Larosière und all den anderen großen Namen der Geldpolitik. Als Horst Köhler, der frühere Chef des IWF, mit dem es auch ein Cane-Foto gab, deutscher Bundespräsident geworden war, hatte es Sir Peter in einen etwas größeren Rahmen fassen lassen und besonders positioniert. Selbstverständlich immer noch in gebührendem Abstand zur Königin.
Cane besann sich, schnaufte laut über den entsetzlichen Stress und drückte auf seinem Telefon die Speichertaste für die BIZ in Basel, die neben dem IWF so etwas wie das übergeordnete Gewissen für alle Notenbanken war. Er mochte die BIZ, weil die Engländer mit ihrer eigenen Notenbank und ihrem eigenen Geld dort noch immer als etwas Besonderes galten, fast so wie auch die Schweizer mit ihrem eigenen Geld. Die meisten anderen Europäer hatten zwar Sitz und Stimme, aber kein eigenes Geld mehr, sondern diesen Euro.
„Ellen, Darling, guten Morgen, wie geht es dir?“ Sir Peter hatte ‚Charming Peter‘ hervorgekramt, denn Dr. Ellen Klausen war nicht irgendeine, sondern die eigentliche Macht im Generalsekretariat der Bank der Notenbanken. Sie wusste, was in den verschiedenen Ausschüssen alles verhandelt wurde. Vor allem in den wichtigen Ausschüssen der Bankenaufsicht, dem Ausschuss der Notenbankgouverneure sowie dem Financial Stability Board, der allerdings bei der BIZ nur ein Sekretariat unterhielt. Er wusste zwar nicht recht, warum sie fast alles wusste, aber dass es so war, das wusste Sir Peter Cane genauestens.
“Bestens, Sir Peter, good morning! Wie geht es dir, mein Lieber?“ Auch wenn es Peter nie über ihre Bettkante schaffen würde – und das schafften in der Welt der Notenbanker einige bei ihr –, pflegte und fütterte sie den Engländer, wann immer er nach Basel kam, meist mit „Basler Leckerli“. Eigentlich mästete sie ihn geradezu und machte sich einen Spaß daraus, zu sehen, wie seine Anzüge erst knapper wurden und dann eine Runde neuer Zwirn in der Jermyn Street oder Savile Row geordert werden musste.
Sir Peter hatte große Vorteile für Ellen. Nicht nur, dass er ohne Zweifel ein ganz alter Haudegen der Geldpolitik war und extrem viel wusste, von dem auch sie profitieren konnte. Er konnte sie auch immer in den besten Londoner Hotels, die ihr Dienstbudget weit überstiegen, unterbringen, wenn sie zu Besuch bei der Old Lady war. Und das gefiel ihr sehr.
„Auch bestens, Ellen. Ein wenig irritiert über die Nachrichten heute Morgen. Ich dachte mir, Ellen, wo kann man sich besser informieren, als bei meiner ‚Princess of Currencies‘?“ Hätte er sie sehen können, hätte er gewusst, wie sehr seine Schmeichelei mit ihrem Äußeren heute Morgen kontrastierte: Ellen trug einen einen praktischen schwarzen Hosenanzug und dazu einen ziemlich engen Rollkragenpullover, dessen Rot zu ihrem Lippenstift passte. Und selbstverständlich hohe Schuhe, allein schon, um sie größer erscheinen zu lassen. Ellen sah heute keinesfalls wie eine Prinzessin aus.
„Oh, Peter, du Charmeur! Was kann ich für dich tun? Du meinst sicher den Griechen, oder?“
„Genau. Auch wenn wir, Gott sei Dank, keinen Euro haben, so sind wir doch besorgt. Sehr sogar, meine Liebe, wenn nun auch noch ein Grieche zum IWF geht. Wo kommen wir da hin, Ellen?“
„Keine Sorge, Peter, ich kann dir helfen. Konstantin und ich kennen uns seit fünfzehn Jahren. Gerade am letzten Donnerstag habe ich ihn getroffen. Was in der FT steht, weißt du ja auch. Was kann ich dir mehr sagen?“
„Du kennst ihn? Wunderbar, Ellen, wie ist er?“ Ausnahmsweise beruhten Ellens intime Kenntnisse über einen der ‚rising stars‘ der internationalen Währungsszene mal nicht auf Bettgeflüster. Doch eigentlich kannte sie geldpolitisch niemanden besser als Dispo.
„Also gut, Peter, dann habe ich was gut bei dir.“ Ein bisschen an den nächsten London-Trip zu erinnern konnte nicht schaden. „Konstantin ist sicher einer der wirklich international orientierten Griechen, die ich kenne, ein Fachmann erster Klasse. Er spricht Englisch, Französisch und Deutsch, als wären es seine Muttersprachen. Seine Mutter ist Deutsche, sein Vater war in den Sechzigern und Siebzigern ein paar Jahre in Deutschland im Exil, studierte zeitweise sogar dort, wenn ich mich nicht täusche, an der TU in Berlin. Deshalb auch das exzellente Deutsch. Konstantin ist deutscher als die meisten Deutschen – sehr pflichtbewusst, sehr pünktlich, sehr genau, sehr ehrlich und so weiter.“ Ellen konnte hören, wie Peter mitschrieb.
„Wie meinst du das?“
„Nun, er ist sicher der beste Mann für den Job, aber er empfindet sich selbst als zu Deutsch, zu ungeschickt und nicht wirklich diplomatisch. Er könnte auch Bundesbanker sein.“
„Oh, Gott bewahre!“ Sir Peter musste lachen. „Ein deutscher Grieche, der nicht deutsch sein will, aber undiplomatisch ist?“
„So ungefähr, Peter. Was das bedeutet, musst du dir selbst überlegen. Das weißt du nicht vom mir.“
„Ich habe doch mit dir nur über das nächste Treffen der Notenbank-Gouverneure in Basel gesprochen, oder?“ Außerdem war es für Ellen gut, wenn das, was sie weitergab, hin und wieder auch später in der Öffentlichkeit erschien, sodass ihre Freunde wussten, dass sie richtig lag.
„Sicher, meine Liebe. Ich habe übrigens ein tolles Arrangement mit dem Dorchester, wenn du das nächste Mal kommst. Wochenende sogar for free. Gerne auch mit Partner.“ Sir Peter wollte lieber gleich die Rechnung begleichen.
„Das wäre doch nicht nötig, Peter.“
„Lass mich wissen, wann du kommen magst, meine Liebe. Und danke.“
Wie schnell Sir Peter an diesem Morgen wieder bessere Laune bekam, wunderte dessen Sekretärin nicht, denn dies geschah immer, wenn er mit Ellen Klausen sprach. Und immer bekam sie danach einen ‚Red carpet‘-Spezialauftrag, das heißt, sie durfte sich Gedanken darüber machen, was man alles für Mrs. Klausen tun könnte, müsste, sollte …
Gleich nachdem Ellen aufgelegt hatte, suchte sie einen passenden Termin in ihrem Kalender. Wang Li würde sich sicher freuen. Außerdem hatte sie auf diesen Reisen Gelegenheit, an die besten Informationen heranzukommen. Aus ihrem Büro im dicklichen Turm ganz in der Nähe des Basler Hauptbahnhofs schaute Ellen aus dem Fenster und dachte nach dem Telefonat an ‚Nummer Dreizehn‘. Über Dispo hatte Ellen ihren Freunden schon vor einigen Wochen berichtet, als sie ‚Over the Pillow‘ von Nummer Dreizehn erfahren hatte, dass man im IWF Dispo und zwei andere Kandidaten auf der Short List hatte.
Ein Großteil ihrer Macht bestand aus Wissen. Und dieses Wissen hatte damit zu tun, dass sie die ‚Meisterstücke‘ einer ganzen Reihe von heutigen Entscheidungsträgern aus einer Zeit kannte, als sie noch keine allzu großen Unterschriftsberechtigungen in ihren Notenbanken und Finanzministerien hatten. Zum Abschied schenkte Ellen, auf ihren Vorschlag hin, aber im offiziellen Auftrag des Generalsekretariats, den besten Trainees oder Stages immer einen Mont-Blanc-Füller. Mit diesen sogenannten Meisterstücken unterschrieben sie zu Ellens Freude noch Jahre danach, wenn sie in ihren Häusern in Spitzenpositionen waren. „In memory of your stage at BIZ“ ließ sie eingravieren und günstiger weise gleich aus dem BIZ-Werbebudget finanzieren.
Alle Füller hatten aber noch eine weitere, unsichtbare, geheime Gravur auf der Unterseite des goldenen Klipps:‘OTP‘ für Over the Pillow und eine fortlaufende Seriennummer. Diesem kleinen Kitzel konnte Ellen nicht widerstehen. Es war ja auch zu ihrem eigenen Spaß: Over the Pillow, von Kopfkissen zu Kopfkissen, erfuhr Ellen Klausen mehr, als sie jemals zu ahnen gewagt hatte.
Und es war immer gut, wenn sich mal wieder einer der früheren Nummern in Basel sehen ließ, wie vor kurzem Nummer Dreizehn. Erstens brachte das ein wenig Abwechslung in ihr Sexleben, und zweitens entlockte sie den Herren meist interessante Informationen.
Nummer Dreizehn aus Frankreich war sehr gesprächig gewesen. Und dies hatte nicht nur mit der leeren Flasche „Dom Pérignon“ zu tun gehabt. Die Franzosen spielten eine der wichtigsten Rollen im IWF, und dies nicht nur, weil der aktuelle Chef, wie meistens, ein Franzose war. Ganz vorsichtig hatte sie der französischen Nummer Dreizehn sogar Dispo nahe gelegt, denn den konnte sie am besten einschätzen. Außerdem war ein Grieche eine gute Option in der Machtzentrale internationaler Währungspolitik. Den Tipp, dass Dr. Konstantin Diospolos zum IWF gehen würde, hatte sie ihren Freunden schon vor Wochen gegeben, womit diese mal wieder einen Informationsvorsprung hatten.
Wenn Wang Li im Sommer nach Hause gehen würde, würde er von Ellen sein Meisterstück erhalten, und zwar mit der Geheimnummer Einundzwanzig, denn so viele hatte sie in den zwölf Jahren bei der BIZ bereits ‚ausgebildet‘. Die meisten ihrer bisherigen OTPs saßen heute in ihren jeweiligen Ländern im Zentralbankrat, waren Finanzstaatssekretäre oder bekleideten sonstige wichtige Positionen in internationalen Gremien und befassten sich mit Banken, Finanzen oder deren Regulierungen. Nur zwei waren im Laufe der Jahre in die Privatwirtschaft abgewandert.
Erstaunt nahm Ellen immer wieder zur Kenntnis, wie gesprächig Männer im Bett wurden, gab man ihnen das, was sie wollten. Ein Hauch hier, ein Stöhnen dort, ein leichtes Kneifen hier – nur keine Kratzer wegen der Ehefrauen –, ein kurzer Biss dort, und schon wusste Ellen von Geheimnissen, die sie bei der BIZ eigentlich gar nicht hätte kennen dürfen. Ellen Klausen wusste nach manchen Abenden mehr als ihre Chefs, und genau das machte auch ihre Macht aus. Genauso wusste sie aber auch, dass sie auf dem Vulkan ritt. Vor einem etwaigen Ausbruch hatte sie sich jedoch abgesichert und ihre Fluchtwege geplant.
Sorgsam führte sie Buch über ihre Nummern und schuf sich damit ihre eigene Lebensversicherung. Alles wurde akkurat abfotografiert, wenn die Männer ermattet eingeschlafen waren. Manches Mal musste sie allerdings mit etwas Schlafmittel nachhelfen. Fotos von den Meisterstücken, Fotos vom ganzen Mann, Fotos vom ganzen Mann mit ihr per Selbstauslöser. Alles war sauber dokumentiert und sicher verwahrt. Aber nicht wie in jedem billigen Agentenroman in Schweizer Schließfächern. Nein, Ellen verteilte ihre Lebensversicherung vielmehr an sicheren Plätzen auf der ganzen Welt.
Beim CityView hatte der Montagmorgen denkbar schlecht begonnen. Mal wieder hatte sich der bullige Chefredakteur, vertieft über die Zeitungen, sehr darüber geärgert, dass sich das Blatt keinen eigenen Redakteur in Frankfurt bei der EZB oder in Washington beim IWF leisten konnte, zumal das Thema „Währungen“ immer heißer wurde. Seit Simon zum ersten Mal vom Währungskrieg gelesen hatte, war sein journalistischer Instinkt angeregt.
Nun, da Carla zurück war, wollte er sie nach Frankfurt schicken, damit sie diesen Diospolos noch vor seiner Berufung treffen konnte. Dass er die Kleine nicht mehr einfach schicken konnte, sondern die Dinge mit ihr vereinbaren und absprechen musste, vergaß er allerdings für den Moment. Insgeheim hoffte er, dass seine Stellvertreterin heute Morgen mit besserer Laune in die Redaktion käme, zumal er ihren View of the Year ohne jede Änderung hatte abdrucken lassen.
Simon sorgte sich, ob ‚sein Mädchen‘ noch jene war, die sich vor drei Monaten hatte verstecken müssen, weil sie und Carl eine Morddrohung von Mitch erhalten hatte. Aber erst nachdem jener Don Kramer erschossen hatte, war Carla bereit gewesen, in Zermatt unterzutauchen. Erst nach Mitchs Tod an Weihnachten, der sie und Carl in Zermatt fast mitgerissen hätte, konnte sie zurückkehren. Gleich geblieben war der Umstand, dass Carla wie immer spät, zu spät kam. Doch ohne sie wollte er heute keinesfalls die Redaktionskonferenz beginnen. Also tat er erst einmal geschäftig, und zwar ohne jeden Anflug von Ärger.
Den gab es erst in der Redaktionskonferenz, nachdem Carla endlich eingetrudelt war. Simon hatte Vincent in der Vorwoche gebeten, einmal alle Prognosen für die Weltwirtschaft zusammenzustellen: Trotz massiver Einbrüche der Weltwirtschaft waren die Aktienmärkte 2009 für den Laien absurderweise fast überall deutlich gestiegen. Es gab keinen Konsens darüber, ob die Märkte auch 2010 weiter steigen würden. Die Entwicklung 2009 hatte natürlich zum einen auch mit der weltweit ultralaxen Geldpolitik zu tun. Geld gab es im Prinzip umsonst zu kaufen, man musste kaum Zinsen zahlen. Die große Frage war, wann die Notenbanken den kontrollierten Rückzug antreten und vielleicht wieder die Zinsen anziehen würden. Auch hier gab es keine einheitliche Prognose, wann und wie es zur Inflation kommen würde. Und zum anderen hatte die zurückliegende Entwicklung etwas damit zu tun, dass die Staaten massive Konjunkturprogramme gefahren hatten, die viel Geld kosteten. Wie weit man bereits in der Schuldenfalle festsaß, vor allem in Europa, und wie es weitergehen könnte – auch darüber gab es keine einheitlichen Aussagen. Hinzu kamen unterschiedliche Einschätzungen zum Ausmaß der Kreditklemmen, ziemlich auseinandergehende Überlegungen, wie die Banken reguliert werden sollten und wie sich die Weltwirtschaft erholen würde.
Vince hatte aus Simons Sicht einen richtig guten Job gemacht, als er das alles in der Konferenz vorstellte und am Ende mit einem Fazit schloss: „Es hat sich eigentlich nicht viel geändert, vor allem nicht am Verhalten. Ob die Konjunkturen anspringen, bleibt abzuwarten. Aus meiner Sicht ist nach der Krise vor der Krise.“ Vincent setzte sich bei den letzten Worten bereits wieder, weil er nicht zu sehr im Mittelpunkt stehen wollte.
Für Carlas Geschmack war der Kleine jedoch bereits zu weit gegangen, auch wenn sie ihm inhaltlich eigentlich hätte zustimmen müssen. Irgendetwas trieb sie dazu, fast jede seiner Aussagen zu bezweifeln. Nicht dass sie die Quelle störte, sondern die Sache an sich. Sie wollte den jungen Mann vor versammelter Mannschaft zerlegen.
Bis Simon ihm beigesprungen war. Das wiederum hatte Carla als Affront aufgefasst und hart zurückgeschossen. Ein Wort gab das andere, bis Trent am Ende von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machte: „Schluss, Carla! Du liegst falsch. Wir bringen das so. Vincent, du schreibst und ich redigiere.“ Er blickte dabei den Schlacks an. „Am Ende entscheide immer noch ich hier, Carla!“ Damit war das Fass übergelaufen.
Wutentbrannt war Carla aus Trents Büro gerannt, hatte stampfend Bellas Eingangsbereich gequert und ihre Bürotür hinter sich so heftig zugeschmissen, dass die ganze Einrichtung wackelte. Niemand wagte dann, sie zu stören, auch Simon nicht, der bereits um elf Uhr nach der Konferenz das Büro zu einem sehr frühen Mittagessen verließ. Er brauchte dringend frische Luft. Noch auf der Straße wählte Simon Steves Nummer. Dieser war, wie konnte es an einem Montagvormittag anders sein, nicht zu Hause, nur der Anrufbeantworter meldete sich: „Samantha Thompson und Steven Bell sind nicht zu Hause. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht, wir rufen umgehend zurück“, leierte eine Frauenstimme. „Steve, hier ist Simon. Ich muss mit dir über deine Tochter reden. Mit ihr stimmt etwas nicht.“ Er mochte keine Anrufbeantworter und fasste sich deshalb immer so kurz wie möglich.
Carla hingegen ließ sich Zeit. Erst gegen Mittag kam sie aus ihrer selbst gewählten Isolation, baute sich fast entschuldigend vor Bella auf. Doch die ‚Mutter der Redaktion‘, die in der Mitte des Eingangsbereichs wie an einem Kommandotisch residierte, machte überhaupt keine Anstalten zu ihr aufzublicken.Gerade so, als nähme Carla hier niemand mehr ernst.
„Was ist, Bella?“, fragte sie, um das Schweigen zu brechen.
„Carla, du bist …“ Annabelle Duncan verdrehte die Augen, hielt den Kopf aber weiter auf die FT gesenkt. „Du bist unerträglich. Schon am ersten Tag. Sieh zu, dass du dich endlich von deinem Dämon löst. Am Freitag findet der Trauergottesdienst statt.“
„Hat diese kleine Ratte doch gepetzt?“ Carla lief blutrot an.
„Hier petzt niemand, Frau Stellvertreterin. Es steht in der FT.“ Annabelle packte die FT-Seite, warf sie Carla in ihr Eingangskörbchen und stand auf. „Einen schönen Tag noch!“ Ohne weitere Worte schob die mollige Frau ihre zierliche Vizechefin etwas zur Seite und ging nach hinten. „Ich gehe dann mit Vince zu Mittag essen. Vielleicht kannst du das Telefon übernehmen?“
Als die beiden an ihr vorbei aus der Redaktion gingen, las Carla Bell die Anzeige bereits zum dritten Mal: „Mitch Pieter Lehman“, darunter „1964-2009. Er ruhe in Frieden. Der öffentliche Trauergottesdienst findet am Freitag, den 15. Januar 2010, um 15 Uhr in der St. Francis Church in Holland Park statt. Für alle Trauernden, Pfarrer Peter Hastings.“
Als Annabelle nach dem Mittag mit Vincent Blyde zurückkam, war Carla verschwunden und die Anzeige lag zerrissen auf ihrem Schreibtisch.
Rastlos durch die City
Obwohl Carl zu diesem Zeitpunkt in New York gerade erst ins Büro kam, lagen auf seinem Schreibtisch bereits einige Nachrichten: Er sollte Carla anrufen, Tino hatte sich auch bereits per Telefon gemeldet, seine Sekretärin Estrella hatte ihm die ersten Antworten auf seine »In Memorian«-Mail hingelegt, Denise brauchte Rücksprache für mindestens eine Million zu klärender Sachen und Peter Sanders, der Chef von Douvalier & Cie. Privatbankiers, der Bank des Douvalier-Bensien-Clans in Genf, war für neun Uhr angesagt. Für alles blieb ihm eine Stunde.
Allein das Telefonat mit Carla dauerte eine halbe Stunde und warf alles durcheinander. Sie war außer sich über das aus ihrer Sicht unverschämte Verhalten von Simon. Carl musste feststellen, dass seine neue Freundin den Mordanschlag zwar überlebt hatte, aber innerlich doch sehr stark getroffen schien. Fürs Erste konnte er Carla nur bitten, bis Mittwoch zu warten – bis er nach London kam. Auch das Gespräch mit Allan Smith dauerte viel länger als geplant und war ein Hilferuf der Extraklasse. Seine Anwesenheit in London wäre mehr als geboten, hämmerte ihm sein neuer Kapitalmarktchef ein. „Die Truppe will nicht so, wie wir wollen, Carl.“ Smith, ein enger Vertrauter Carls, schien mit dem neuen Job ein bisschen überfordert zu sein.
Wenigstens Denise ließ sich auf später vertrösten, sodass er sich in Ruhe mit Peter Sanders hinsetzen konnte. Der kleine Engländer bedeutete ihm, dass er spätestens zum Ende dieses Jahres endlich in Pension gehen und den Job an den Nagel hängen wollte, den er auf Carls Bitte inmitten der größten Krise der Bank übernommen hatte. Schon um zehn Uhr hatte Carl mehr Probleme, als ihm lieb sein konnte. Umso wichtiger war das kurze Telefonat mit Tino Corleone, dessen Zusage Carl freute. Er bat ihn, am Dienstagabend im Firmenjet der Carolina Bank mit nach London zu fliegen. Denn ohne Carlas Einverständnis hätte er in seiner Funktion als Sicherheitskoordinator der Familie keinen Sinn. Carla galt für ihn seit Weihnachten als Teil seiner Familie. Dass er den Rest des Tages Carla nicht mehr erreichen konnte, machte ihn nervös.
Zunächst war Carla nach Verlassen der Redaktion rast- und ziellos durch die City gelaufen. Je länger sie in der City umherirrte, desto klarer wurde ihr, dass sie nicht einfach da wieder weitermachen konnte, wo sie im September hatte aufhören müssen. Carla musste mit jemandem reden, der nichts mit dem CityView zu tun hatte. Und ein Verwandter durfte es schon gar nicht sein. Das waren alles Leute, die sie und ihre Situation kannten. Sie musste nachdenken, und zwar in Ruhe. Genau diese hatte sie seit Mitchs Tod nicht mehr gehabt. Ganz automatisch schaltete sie Handy und Blackberry aus und verließ zu Fuß die City.
Carla ging hinunter zur Themse. Je länger sie nachdachte, desto mehr fiel ihr auf, dass sie keine Freunde mehr hatte, die nicht irgendwie mit Banken, dem CityView oder dergleichen zu tun hatten. Früher war sie des Öfteren noch nach Hause zu ihrem Vater gefahren und hatte dort auch alte Schulfreunde getroffen. Seit ihrer Zeit mit Mitch, aber auch nach ihrem Unfall und der Jagd auf Lehman hatte sie alle vernachlässigt. Banken, Börsen und Boni. Das war ihr Leben. In der Schweizer Isolation hatte sie nur auf ihre Rückkehr gewartet. Und nun ging es ihr wie dem Häftling, der sich nicht an die Freiheit gewöhnen konnte. Dass Carl auch noch Banker war, machte ihr nicht gerade Mut. Sie ließ die Schultern hängen, grub die Hände in die Manteltaschen und stapfte durch die Stadt.
Irgendwann am späten Nachmittag stand sie vor Harrods. Seit Monaten war sie nicht mehr hier gewesen. Sie kam gerne ins große Kaufhaus, um Menschen zu beobachten, vor allem in den Foodhalls. Gegessen hatte Carla auch noch nichts. Einem teuren, späten Mittagessen stand folglich nichts im Wege. Carla nahm die Ecke mit der Rotisserie, ließ sich ein schönes blutiges Stück Roastbeef abschneiden, dazu ein paar Röstkartoffeln und nach kurzer Überlegung ein Glas Rotwein. Gestärkt fühlte sie sich gleich besser und nippte genüsslich am Wein. Als sie dann einen Pfarrer durch die Foodhalls schlendern sah, fasste sie einen Entschluss, den sie selbst bislang nicht für möglich gehalten hatte: Sie schnappte ihr Handy und rief Pfarrer Peter Hastings an, denn der hatte schließlich alle alten Wunden mit dem Anruf letzten Donnerstag aufgerissen. Seine Nummer fand sich noch im aktuellen Speicher, nur dass Carla kein Glück hatte. Fast erleichtert drückte sie ‚off‘ – eine Nachricht wollte sie nicht hinterlassen. Automatisch schaltete sie das Handy wieder ab. Carla wollte nicht erreichbar sein. Sie machte sich auf den Weg nach St. Francis Church in Holland Park. Das war zwar ein längerer Fußmarsch, aber Carla brauchte ohnehin Luft und Zeit.
Diana brauchte bis zum Nachmittag, um sich in ihrer Wohnung wieder einzuleben. Alle alten Sachen hatte sie in Säcke verpackt, nur drei ‚Dienst-Garnituren‘ für den Fall aufbewahrt, dass sie sich noch einmal richtig verkleiden müsste. Dass ihr selbst dazu nur das Wort Verkleidung einfiel, belustigte Diana fast. Wie befreit tauchte sie kurz nach 17 Uhr bei Fortnum & Mason auf. Sie wollte Cindy etwas schmoren lassen. Hohe Stiefel, dazu einen Pelz, darunter eine mindestens einen Knopf zu weit geöffnete Bluse. Die Spitzen des BHs waren überdeutlich zu erkennen. Diana sah aus, wie Cindy sie kannte.
Rothaarig und mit einer Lesebrille im Haar, saß diese in einem beigen Kostüm bereits aufrecht am Tisch. Diana konnte sehen, wie sie immer wieder nervös an sich nestelte. Diana nahm sie von hinten, sodass Cindy sie erst bemerken konnte, als sie ihr „Entschuldigung, ich komme ein bisschen zu spät“ zurief. Mehr als leicht erschrocken, drehte sich die ehemalige Chefsekretärin von Mitch Lehman um. Man konnte ihr ansehen, dass sie über Dianas Erscheinen erleichtert war, wohl aber nur, weil sie nicht anderweitig erwischt worden war.
„Diana, ich komme nur, um mir anzuhören, was du zu erzählen hast.“
„Sicher.“ Sie begrüßten sich respektvoll per Handschlag, Cindy wäre es ein Gräuel gewesen, Diana zu küssen. Diana war klar, dass Cindy nicht länger als nötig mit ihr zusammensitzen wollte. Es war besser, gleich zur Sache zu kommen: „Sag, Liebes, hast du etwas über den Pfarrer herausfinden können.“
Cindy schob ihr einen Umschlag über den Tisch, den sie unter ihrer Serviette versteckt hatte. Diana steckte ihn ohne einen weiteren Blick in ihre Handtasche und zog ebenfalls einen Umschlag heraus, den sie Cindy übergab.
„Du brauchst auch nicht reinzuschauen. Es sind 500 Pfund drin.“ Diana hatte ihren Köder geworfen, denn Cindy zuckte unweigerlich zusammen. Doch Diana hatte das kurze verschmitzte Anheben ihres Mundwinkels bemerkt. Cindy steckte den Umschlag in ihre Handtasche, während sie sich räusperte.
„Worum geht es, Diana? Mir ist es …“ Weiter kam sie nicht.
„Unangenehm?“ Diana zog die Braue hoch. „Cindy, wir sind erwachsene Mädchen, oder?“
„Aber ich will nichts mit deinem Business zu tun haben.“
„Brauchst du auch nicht. Ich aber muss mich neu aufstellen. Meine Geldquelle ist leider genauso tot wie deine.“ Diana tat so, als rückte sie im Stuhl etwas hin und her, und bewegte leicht ihre Knie, als wollte sie die Beine breit machen. Cindy war das nicht entgangen. Sie trank zur Ablenkung einen Schluck von ihrem Tee, den sie sich bereits bestellt hatte.
„Ziemlich unhöflich“, dachte Diana, aber vor einer Nutte glaubte sie bestimmt, sich nicht besonders benehmen zu müssen. Währenddessen bediente eine Kellnerin auch sie mit Tee und Cremeschnitten. So blieb ihnen für einen Moment nichts anderes übrig, als sich gegenseitig anzuschauen.
„Was willst du?“
„Kontakte. Ich zahle dir tausend Pfund pro Kontakt.“ Sie hatte sich lange überlegt, wie viel sie Cindy bieten sollte, damit ihr nicht auffiel, dass sie massenhaft Geld hatte und eigentlich gar keine neuen Quellen benötigte. Und mit tausend Pfund pro Kontakt lag es in ihrer Hand. Gier funktionierte besonders dann, wenn man nicht mehr so viel Geld hatte.
„Ich habe keine mehr, bin für keinen der großen Jungs mehr tätig. Leider.“
„Ich weiß, aber das ist dein Problem. Ich brauche so viele Topshots wie möglich – aus Banken, Notenbanken, Kanzleien, Politik und so weiter. Am liebsten hätte ich die Kontaktdatenbank von Mitch.“ In der stand alles, was man über die Kontakte wissen sollte und auch, was man besser nicht wissen sollte, bis hin zu sämtlichen Vorlieben der Männer. Diese Datenbank auf WikiLeaks – und viele Leute hätten eine Menge zu erklären.
„Da komme ich nicht ran, Diana. Wie soll das gehen?“
„Du hast keine Kopie?“
„Nein, wirklich nicht, es ging alles so schnell damals.“ Diana konnte es kaum glauben.
„Tausend Pfund pro Kontakt. Geprüft selbstverständlich. Überlege es dir. Versuche es. Es ist jedenfalls keine Sünde, mir eine Datenbank zu organisieren, oder? Es ist beinahe ein ganz normales Angebot.“
„Nein, das ist es nicht, aber das wissen wir. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wann wollen wir uns treffen?“ Die Erleichterung darüber, dass sie selbst keine Schmuddeldinge machen sollte, war ihr anzusehen.
„Ich rufe dich an.“ Diana stand auf, legte fünfzig Pfund für die Rechnung auf den Tisch und verschwand mit einem Lächeln.
Cindy hatte angebissen. Sie blieb noch einen Moment sitzen, trank ihren Tee aus und aß ihre Cremeschnitte auf. „Diana war doch wie immer“, dachte sie, um die kleine Spionagearbeit vor sich selbst besser legitimieren zu können. Es waren ja ohnehin keine echten Bankdaten – nicht alles war illegal.
Gegen 18.30 Uhr dreißig erreichte Carla endlich St. Francis Church. Sie hatte zwischenzeitlich doch die U-Bahn genommen. Von der Station in Holland Park galt es immer noch einen weiten Weg zurückzulegen und ihre Beine wurden trotz der Pause bei Harrods immer müder. Erschöpft stand sie schließlich vor der schweren Pforte, die das Areal abschloss. Sie wartete nicht lange, sondern betätigte schwungvoll das eiserne Zugsystem, das auf der anderen Seite eine Glocke ertönen ließ. Doch im Innenhof tat sich nichts, sodass Carla entmutigt schon wieder gehen wollte. Die Trippelschritte waren kaum zu hören. Ein alter Mann, der im Dunkel des Januarabends etwas Furchtsames hatte, öffnete die Pforte.
„Guten Abend!“ Carla musste zunächst schlucken. „Ich suche Pfarrer Hastings.“
„Der liest gerade die Abendmesse für unsere Brüder.“ Carla stand unschlüssig vor dem alten Mönch. „Ist aber gleich zu Ende, junge Frau. Setzen Sie sich doch hinten rein. Kann nie schaden.“ Er zeigte auf eine rechts vom Eingang gelegene Türe.
„Ich weiß nicht. Trotzdem danke!“
„Sie sehen verfroren aus. Die Kirche ist warm.“ Der alte Mann wandte sich mit einem Kopfnicken von ihr ab. „Ich stehe hier tatsächlich in einem Kircheninnenhof und frage nach einem Pfarrer“, dachte Carla. Erst jetzt fiel ihr auf, wie fehl am Platze sie sich fühlte, sie, die Kirchen und Pfarrer seit dem Tod ihrer Mutter ablehnte. Unschlüssig und überrascht wollte Carla gerade umkehren, als die Orgel ein Lied anstimmte, das längst verschüttete Erinnerungen wachrief. „Lobet den Herren!“ Mit ihrer Mutter hatte sie das zum letzten Mal gesungen. Mindestens achtzehn oder neunzehn Jahre musste es her sein. Wie angewurzelt stand die selbsternannte Atheistin da und lauschte den Klängen, die ihre Beine spontan in Bewegung setzten.
Eine Minute später saß sie in der letzten Reihe. Die Stimme des Pfarrers gehörte Hastings, den sie im Ornat erst gar nicht erkannt hatte. Kurze Zeit später entließ der junge Pfarrer seine Ordensbrüder mit einem „Gehet hin in Frieden!“ aus der Abendmesse.
Carla blickte die Mönche an. Sie blieb sitzen und tat das, was sie schon seit Mittag tat: nicht zu wissen, was sie tun sollte. Aber wenigstens warm war es in der Kirche. Da hatte der alte Mönch recht. Wenig später kam Hastings in der schwarzen Kleidung eines Pfarrers aus der Sakristei.
„Ich habe Sie hereinkommen sehen, Mrs. Bell.“ Carla schwieg, Hastings setzte sich neben sie.
„Ich weiß eigentlich nicht, was ich hier soll.“
„Das wissen viele nicht, die hierherkommen.“
„Ich war seit Jahrzehnten nicht mehr in der Kirche, außer an Weihnachten letztes Jahr.“
„Ich hatte von der Sache gelesen und lange überlegt, ob ich Sie anrufen sollte.“
„Warum haben Sie es dann getan?“ Zum ersten Mal blickte Carla den Pfarrer direkt an. „Ein junger schöner Mann, zu schade für das Zölibat“, ging ihr durch den Kopf.
„Ich hatte es versprochen.“
„Hören Sie, ich bin nur gekommen, um Ihnen zu sagen, dass ich am Freitag nicht kommen werde.“
„Ist auch okay. Ich sagte ja, dass ich Sie verstehen könnte.“ Seion blondes haar leuchtete regelrecht gegen die schwarze kleindung der Kutte.
„Ihr Anruf hat mich aus der Bahn geworfen.“
„Kann ich etwas für Sie tun?“
„Ich weiß es nicht. Nein, ich glaube nicht.“
„Sie sind einfach so gekommen, um mir zu sagen, dass sie nicht zum Trauergottesdienst kommen wollen?“ Hastings lächelte bei der Frage leicht.
„Ja.“ Carla schwieg wieder.
„Nein.“ Sie lächelte zurück.
„Ich brauche Hilfe.“
„Dann sind Sie hier richtig. Doch ob ich Ihnen helfen kann, weiß ich nicht. Ich kann jedoch zuhören.“
„Haben Sie ein wenig Zeit?“
„Alle Zeit der Welt. Bis zur Frühmesse.“ Nun lachte er breit. Und Carla mit.
„Solange wird es nicht dauern.“ Dann begann sie zu reden und hörte erst eine Stunde später wieder auf. Hastings unterbrach sie kein einziges Mal. Als Carla fertig war, nahm er ihre Hand und sprach ein Gebet. Mit „Herr, gib ihr Kraft, ihren Frieden zu finden“ endete er und zog sie dann an der Hand aus der Kirchenbank zum Ausgang.
„Was tun Sie?“
„Ich bringe Sie jetzt nach Hause. Wenn Sie sich wieder etwas von der Seele reden wollen, kommen Sie nochmals zu mir.“ Verblüfft ging Carla an der Hand des Pfarrers hinaus.
„Sie haben doch gar nichts gesagt!“
„Sie haben mir auch keine Frage gestellt, Mrs. Bell. Sie müssen mich schon etwas fragen, wenn Sie eine Antwort haben möchten.“ Schweigend gingen die beiden in Richtung Holland Park Road. Hastings pfiff nach einem Taxi, das mit einer heftigen Bremsung ein paar Meter hinter Carla und dem Pfarrer stoppte.
„Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben.“ Sie vollzog eine komische Drehbewegung, die Hastings deutlich machte, dass sie alleine nach Hause wollte. Bevor Carla die Wagentür zuzog, winkte sie noch einmal.
„Nach Islington“, wies sie den Taxifahrer an. Carla war müde. Sie fühlte sich leer, aber auch erleichtert darüber, dass sie Hastings ihre Seele offenbart hatte.
Vor ihrer Haustüre wartete Annabelle, die sich – auch wenn sie mächtig sauer auf Carla war – Sorgen um die Kleine gemacht hatte.
„Wo bist du gewesen, Carla? Die ganze Welt sucht dich! Vor allem Carl – und Simon und deine Eltern.“
„Oh Gott!“ Plötzlich musste sie sogar ein wenig lachen. „Ich bin etwas rastlos durch die City gelaufen. Das mit heute Morgen tut mir leid.“
Annabelle verstand die Welt nicht mehr. Sie schob die Lachende mit der einen Hand die Treppe zu ihrer kleinen Wohnung hoch und verschickte mit der anderen Hand eine Sammel-sms an Carl, Simon und Steve: „Ich habe sie gefunden, alles in Ordnung, ich bleibe erst einmal bei ihr.“
Die Grillparty
Laut keuchend, als hätte er erfolgreich einen Marathon hinter sich gebracht, lag Wladimir auf dem Boden. Für ihn war am Montagabend die Welt mehr als nur in Ordnung. Als er seine Geliebte gesucht hatte, fand er sie vor dem knisternden Kaminfeuer unter einem Fell. Und auch wenn sie bereits den ganzen Nachmittag gevögelt hatten, konnte Wladimir nicht genug von der jungen Engländerin mit aktuell schwarzen Haaren bekommen. Ihm gefiel die Farbe gar nicht, mit der Camilla schon gestern eigenhändig ihre Haare gefärbt hatte – Russen standen mehr auf blond oder rot. Als er mit einem „Da bist du ja!“ seinen Bademantel öffnete und auf sie zuging, hatte Camilla bereits das Fell zurückgeklappt.
Camilla ritt ihn sicher eine Stunde lang – wie im Galopp von einem Höhepunkt zum nächsten. Godunow spürte ihre prallen Brüste auf seinem Brustkorb, als seine Reiterin keuchend und schwitzend auf ihm lag. Er war völlig ausgelaugt und ermattet. Zufrieden schloss er noch einmal die Augen, als sie sich auf die Seite rollte, damit beide sich etwas Luft verschaffen konnten. Camilla Miller war jeden Cent der sieben Millionen Dollar wert, die Mitch ihr gezahlt hatte, ehe er sie ihm gleichsam als Sachleistung für seine Dienste drei Jahre lang kostenfrei überlassen musste. Godunow wollte sie, und Mitch, der in der Klemme gesteckt hatte, musste sein bestes Pferd abtreten und auch noch dafür zahlen.
Schon jetzt machte Godunow sich Sorgen darüber, wie er sie wohl nach ihrem Arrangement bei sich halten konnte. Mit ihren sieben Millionen aus der Edelnutten-Überlassung und aus dem Blow Job in Zermatt hatte sie bereits ein nettes Sümmchen beisammen, obwohl sie ziemlich viel Geld verprasste. Selbst einem russischen Verschwender wie ihm konnte so manches Mal die Luft wegbleiben, wenn sie vom Shoppen zurückkam. Aber das zahlte meist er.
Godunow behandelte sie nach seinem Dafürhalten gut. Wollte sie mal nicht, machte er ausnahmsweise keinen Gebrauch von seinem Recht auf sie. Ein Tag wie heute entschädigte den Ex-Oberst der russischen Armee voll und ganz. Natürlich musste er seit Zermatt vorsichtiger sein, da er per Haftbefehl gesucht wurde. Aber er hatte ja nicht ahnen können, dass Mitch Lehman so doof gewesen war, Carl und Carla sowie die gesamte Weihnachtsgesellschaft nicht mit der Kalaschnikow umzumähen und sich stattdessen selbst erschießen zu lassen. Lehman war eben nur ein Trader und kein Killer. Doch in Moskau konnte man dank gewisser Kontakte gut und gerne auch mit internationalem Haftbefehl leben. Zumal dann, wenn man sich auf einer feinen Datscha außerhalb von Moskau befand.
„Wladimir! Wladimir! Wladiiiimir!“ Es dauerte, bis Wladimir die nach ihm rufende Frauenstimme in seinen Traum einzubauen versucht und dann doch die Augen aufgemacht hatte. Das Elend erkannte er sofort. Er wollte aufspringen, zog aber augenblicklich die Plastikgurte, die um seine Gelenke gelegt worden waren, noch fester zu.
Wladimir Godunow lag an Armen und Beinen gefesselt auf jenem Fell, unter dem er noch vor einer Stunde seine Camilla gefunden hatte. Und diese, immer noch splitterfasernackt, hielt ihm, wie eine Domina die Peitsche, einen brennenden Holzscheit vors Gesicht. In der anderen Hand hatte sie eine Flasche.
„Du kannst schreien, so viel du willst, hier hört dich niemand. Die beiden Wachen haben einen kleinen Todescocktail von mir bekommen. Wir sind ganz allein, Wladimir, und das nächste Haus ist einen Kilometer weit entfernt. So sagtest du doch letztlich, nicht wahr?“
Godunow gab keine Antwort. Er blickte ihr furchtlos in die Augen, während er mit seinen Armen und Beinen an den Fesseln zog. Wer in Tschetschenien gewesen war, fing in einer solchen Situation nicht gleich zu schreien an, auch wenn alles ausweglos schien.
„Die Plastikschlingen sind so dick, dass sie bestimmt erst nach fünf Minuten im Feuer durchschmelzen werden. Du hast keine Chance! Die Halterungen für die Schlingen habe ich schon beim letzten Besuch angebracht.“ Godunow sah, dass diese in den Wänden und am Kamin durch kleine Stahlösen verankert waren. Er lag wie ein erlegter Tiger, alle Viere von sich gestreckt, auf dem Fell.
„Mach schnell!“ Das war das Einzige, was er sagte, als Camilla mit den Zähnen die Flasche öffnete. Der Spiritusgeruch stand sofort im Raum. Camilla goss die Hälfte der Flasche auf Godunows nackten Körper. Er war zwar nach wie vor ruhig, begann aber nun zu stöhnen und zu schnauben. Doch es half nichts. Fast die ganze andere Hälfte der Flasche schüttete Camilla auf das Bärenfell. Es roch feucht vor dem warmen Kamin. Mit dem verbliebenen Rest in der Flasche zog sie auf dem Boden ein kleines Rinnsal bis zum Sessel, der drei Meter neben dem Kamin stand.
„Mir ist kalt!“ Sie setzte sich in den englischen Ledersessel.
„Aber nun wird es ja ein bisschen wärmer!“ In der Rechten das brennende Scheit, in der Linken die leere Flasche. Die nackte Frau gab, wie sich Wladimir eingestehen musste, ein pervers schönes Bild ab. Noch vor ein paar Minuten hatte sie ihn fast zu Tode geritten, hatte ihm ihre Fingernägel immer wieder in den Nacken gekrallt und die Muskeln traktiert.
„Warum?“ Godunow sah sie an, ganz entspannt, wie Camilla durchaus überrascht zur Kenntnis nahm.
„Irgendwann kommt es nun einmal der letzte Akt, Wladimir. Wie für Mitch, so auch für dich, Gospodin.“
Das Holz des Scheits zerbarst, als es auf den Boden fiel. Drei Sekunden dauerte es, bis das Feuer den Körper erreichte. Godunow schrie vor Schmerz. Im Nu standen Fell und Körper komplett in Flammen. Keine Minute später war Godunow still und stank nach verbranntem Fleisch. Der ganze Raum brannte inzwischen. Die Tapeten loderten und das trockene Holz der Decke knisterte. Die Grillparty hatte begonnen. Camilla schaute noch einen Moment fasziniert zu, dann wurde ihr der Rauch zu dicht.
Im Nebenraum lagen ihre Sachen. Binnen einer Minute hatte Camilla Skiwäsche und Skikleidung angezogen. Sie hielt sich die kleine Sauerstoffmaske mit der angehängten Flasche vor den Mund und warf noch einen letzten Blick in das stinkende Kaminzimmer auf Godunow.
„Well done, Wladimir!“ Zufrieden verließ Camilla das Haus und zog Maskenmütze, Stiefel, Handschuhe und Schal an. Mit der Skibrille ins Gesicht gezogen, startete sie das Snowmobil. Der Blick zurück war beruhigend. Es würde noch ein paar Minuten dauern, bis die Flammen aus den Fenstern und dem Dach herausschlagen würden. Zeit genug zur Flucht. Alles war auf die Minute genau durchgeplant. Am Mittwoch wollte sie wieder in London sein.
Carl hatte bewusst darauf verzichtet, Carla nach der Suchaktion am Montagabend zurückzurufen. Er wusste von Annabelle, dass nichts passiert war. Erst am Dienstagmittag, als es in New York noch früh am Morgen war, meldete sie sich bei ihm. Ohne groß auf gestern einzugehen, hauchte Carla ihrem neuen Lover ein „ich freue mich auf dich“ zu. Er möge doch, wenn er ohnehin um sechs Uhr früh auf dem Cityairport landete, zuerst zu ihr kommen. Islington läge doch auf dem Weg. „Wir können ja zusammen duschen“, gluckste sie in den Hörer. Am anderen Ende der Leitung schüttelte Carl nur den Kopf, beließ es aber dabei, nicht am Telefon mit ihr zu diskutieren. Außerdem hatte er inzwischen schon mit Steven und Simon gesprochen.
Carla war bereits vor ein paar Stunden sehr früh ins Büro gekommen. Als wäre am Tag zuvor gar nichts vorgefallen, hatte sie sich den Artikelentwurf von Vincent über die Aussichten für die Kapitalmärkte und die Investmentbanken vorgenommen und ihn ganz behutsam redigiert. Mit einem „Gut gemacht, junger Mann! Vielleicht checkst du nur noch einmal ab, ob es bei den Bonusvolumen bleibt? Sind es wirklich schon wieder über hundert Milliarden Dollar? Kaum zu glauben!“ hatte sie den Text zurück ins Redaktionssystem gebracht, nicht ohne Simon eine „Erledigt“-Nachricht zu schicken. Dieser blickte beim Reinkommen ziemlich verstört, als er Carla bereits in ihrem Kabuff sah, denn normalerweise kam sie nie vor ihm. Der redigierte Text gab ihm den Rest. Plötzlich war fast alles, was Vincent recherchiert hatte, in Ordnung?
Ihr Vater Steve hatte sich gleich am Morgen bei Carla gemeldet. Blendend ginge es ihr, wieso die Frage? Nur weil sie gestern so verärgert gewesen sei? „Ich bitte dich, Dad. Lass die Kirche im Dorf!“ Ganz freundlich und leise hatte sie das ihrem Dad gesagt, der nun erst recht nicht verstand, was Simons Anruf und Carls Suchaktion gestern gesollt hatten. Steve hatte noch einmal mit Simon gesprochen, der auch nicht wusste, woran man mit Carla war. Sie war wie ausgewechselt, als sie am Abend nach Hause ging – nicht ohne ihrem Freund noch einen „guten Flug und ich freue mich auf Morgen Früh“ durchs Telefon gesäuselt zu haben.
Zu seiner großen Überraschung eröffnete Tino Carl kurz nach dem Abflug, als sie sich gerade zum Essen setzten, dass er bereits gekündigt hätte. Mit seinem Resturlaub war er am 25. Januar frei. Rechtzeitig für Davos, wie Carl gleich feststellte, was ihn außerordentlich beruhigte. Noch aus dem Flieger gab er Anweisung, dass Tino als Mitglied der Sicherheitscrew mit angemeldet werden sollte. Es gab zwar keinen sichereren Ort auf der Welt als Davos Ende Januar, wenn sich alle wichtigen CEOs und viele Staats- und Regierungschefs der Welt, einschließlich Notenbanker, UNO-, EU- und sonstige Spitzenleute in den verschneiten Graubündner Bergen treffen. Da Carla aber in Davos auf einem Panel sitzen würde und so bei und mit ihm übernachten könnte, war ihm Tinos Anwesenheit sehr recht. Möglicherweise ergab sich dort ja die Gelegenheit, ihr Tino zu ‚verkaufen‘.
Am Morgen nach der Landung schickte er Tino mit seinem Fahrer, der ihn vor Carlas Appartement abgesetzt hatte, weiter. Drei Stunden später holte ihn der Fahrer wieder ab. Ein sehr entspannter Carl liess sich in den Fond der S-Klasse fallen. Carl war irritiert, wie gut gelaunt Carla war, geradeso, als wäre in den letzten Tagen nichts gewesen.
Nur Sam konnte Carla nicht täuschen. Nicht so wie Simon, Steve und auch Carl, die ihrer gespielten Fröhlichkeit, Kooperationsbereitschaft oder Lust auf den Leim gegangen waren. Das wurde Carla augenblicklich klar, als sie am Telefon dieselbe Masche versuchte als Sam sie im Büro erreichte. Samantha Thompson, die Lebensgefährtin ihres Vaters und Polizeipsychologin, war nicht zu täuschen.
„Carla, mir kannst du nichts vormachen.“ Dieser eine Satz reichte aus, um Carla wieder aus jenem aufgesetzten Gleichgewicht zu bringen, mit dem sie bereits in die Redaktion gekommen war. Sie wollte ihre Unsicherheit mit guter Laune einfach vertuschen.
„Was soll ich denn deiner Meinung nach tun, Sam?“ Carla flehte mehr, als dass sie fragte.
„Geh in dich, lass die Dinge heraus. Sonst bist du auf dem besten Wege, schizophren zu werden. Du hast viel zu viel mitgemacht in den letzten drei Monaten und in den letzten drei Jahren!“ Mit diesem Rat beendeten sie ihr Gespräch.
Etwas Ähnliches hatte der Pfarrer auch gesagt. Es half nichts, sie musste in ihr Innerstes hinabsteigen. Warum, zum Teufel, hatte sie sich auf Mitch Lehman eingelassen? In drei Tagen würde er eingeäschert werden. Ihr blieben drei Tage. Also rief sie nochmals Hastings an.
Annafried Olson kehrte am Mittwoch sehr gut gelaunt nach Luxemburg zurück. Zwei Tage in Wiesbaden waren genug für den Abschluss der deutschen Zahlen. Zwar waren auch die Deutschen keine Musterknaben, wenn es um die Einhaltung der Stabilitätskriterien ging, doch wenigstens stimmten die Grenzüberschreitungen. Dass ausgerechnet Deutschland unter Kanzler Schröder und Frankreich mit Präsident Chirac die ersten Länder waren, die die hart errungenen Maastricht-Kriterien missachtet hatten, ärgerte Anna noch heute, denn damit hatte das ganze Drama begonnen: das Auseinanderklaffen von Staatshaushalten in den verschiedenen Euroländern und der Geldpolitik für den einen Euro.
Jede ökonomische Theorie sagte, dass das nicht funktionieren könnte. Damals hatte sie noch als Referentin in der Stabsstelle gesessen und wüste interne Memos verfasst, woraufhin sie – wie zur Strafe – in die deutsche Einheit versetzt wurde. Würde es nicht ein spezielles Programm zur Frauenförderung geben, säße sie sicher immer noch dort. Da an Annas fachlicher Qualifikation jedoch kein Zweifel bestand, ging bei der Suche nach einer neuen Chefin der Südländer-Gruppe kein Weg an ihr vorbei.
„Spanien“, „Italien“, „Griechenland“ und „Portugal“ stand in jeweils dicken maschinengeschriebenen Buchstaben auf den Computerausdrucken auf den vier Stapeln, die Annafried schon von Weitem erkennen konnte. Die vier dicken Stapel aus umweltfreundlichem grauem Papier säumten ihren neuen Besprechungstisch. Als Abteilungsleiterin hatte Anna nun Anspruch auf ein größeres Büro, in dem sie sogar kleine Gruppen zu Besprechungen laden konnte. Zunächst würdigte sie die Stapel keines weiteren Blickes. Sie kannte das Drama eigentlich ja schon, und bis Freitagnachmittag hatte sie Zeit, sich intensiv in die südländischen Daten zu vertiefen.
Heute Nachmittag zwei und morgen Früh zwei Länder. Sie schaltete den Computer an und hängte in der Zwischenzeit den roten Wintermantel in den Schrank. Dass sie sich in Wiesbaden tatsächlich einen roten Mantel gekauft hatte, konnte sie selbst kaum fassen. Für Romantik blieb ihr allerdings keine Zeit. Um zehn Uhr sollten ihre vier ‚Schweinchen‘ auftauchen, die PIGS. Auch wenn dabei das I – zumal in den Medien – für das schwächelnde Irland stand, hatte sich Anna erlaubt, Italien dafür einzusetzen. Die vier PIGS-Referenten wollten mit ihr die Zeitpläne für die Vorortbesuche abstimmen. Bis dahin hatte sie sich vorgenommen, alle Mails seit den Ferien durchzusehen und grob zu sortieren.
Doch noch ehe Anna richtig loslegen konnte, stand Madeleine vor ihr, regelrecht erwartungsvoll. Es dauerte eine ganze Weile, bis Annas von den vielen Zahlen absorbiertes Hirn registrierte, was Madeleine wollte. Als Abteilungsleiterin hatte sie eine eigene Sekretärin. Auch sie schien unschlüssig.
„Guten Morgen, Madeleine, ich muss zugeben, ich hatte Sie fast vergessen.“
„Guten Morgen, Madame Olson, ich, äh, und ich hätte sie fast nicht erkannt.“
Anna begann zu lachen und Madleine stimmte zögerlich mit ein. Ohne Brille, mit neuer Frisur und teurem Outfit konnte das neue Leben beginnen. Die Südländerdaten würde sie schon in den Griff bekommen.
„Lass gut sein, Madeleine. Die Typänderung ist vielleicht etwas radikal.“ „Sieht klasse aus, Madame Olson!“ Von der jungen hübschen Belgierin galt das Kompliment noch mehr.
„Ich will mich erst einmal sortieren, ehe die Jungs kommen.“
„Kaffee gefällig?“
Anna entfuhr nur ein überraschtes „Ja, gerne“.
„Ach und Sie möchten bitte einen Dispo zurückrufen. Hier ist die Nummer oder soll ich durchstellen?“ Sie hielt ihr einen Notizzettel hin.
„Nein, danke, das schaffe ich noch.“
„Nicht alles an diesem Tag schien neu“, überlegte Anna beim Anwählen der Nummer in Frankfurt.
„Hey, Dispo, schon Probleme mit den griechischen Zahlen?“ Sie fläzte sich in ihren Schreibtischstuhl, der ab Abteilungsleiterebene aus Leder war. Anna nahm die Füße auf den Tisch. Der breite Schlag ihres dunkelblauen Hosenanzugs wehte zwischen Tischkante und Stuhl und gab einen Teil ihrer neuen Schuhe frei, deren Spitzen fast länger als die Absätze waren.
„Friedhof, dein diplomatisches Geschick bleibt unübertroffen.“ Dispo saß in seinem Büro im Eurotower und betrachtete den Main – das einzige schöne Bild, das er von Frankfurt im Kopf behalten würde.
„Du kennst mich.“
„Stimmt!“
„Soll heißen?“
„Anna, niemand blickt bei Zahlen besser durch als du.“
„Danke.“ Annafried schwieg, denn Dispo lobte sie sonst nie so direkt.
„Ich will mich mir dir treffen. Informell, als Freunde.“
„Wieso?“ Sie nahm die Füße vom Tisch und aus Gewohnheit einen Stift zur Hand, als wollte sie sich etwas notieren.
„Ich will wissen, wo wir stehen. Du kennst die PIGS, Deutschland und so weiter. Wenn ich erst in Washington bin, kann ich kaum mehr informell mit dir zusammenkommen.“ Konstantin stand mit seinem drahtlosen Telefon am Fenster.
„Alles fließt, Anna, wir müssen aufpassen.“
„Das kann ich nicht!“
„Du kannst nicht aufpassen?“
„Nein, mich mit dir treffen. Das ist gegen die Regeln.“
„Du sollst mich treffen, deinen Freund Konstantin. Dafür gibt es keine Regel.“
„Nein, das ist Griechenland.“
„Anna, wenn der Euroraum zusammenbricht, ist Griechenland das geringste Problem. Der IWF muss vorbereitet sein. Was glaubst du denn, was ich da machen soll?“
„Dispo, das geht nicht. Ich habe auch keine Zeit. Basta!“ Anna legte auf, gerade noch rechtzeitig, ehe Madeleine mit dem Kaffee wieder im Raum stand.
Auch Cindy telefonierte an diesem Mittwochmorgen recht früh noch von zu Hause aus. Diana war doch sehr überrascht darüber, wie schnell die angeblich so gute Katholikin gearbeitet hatte. Sie hatte 250 Adressen auf einer CD. Mit so viel Material hatte Diana nicht gerechnet und eigentlich brauchte sie gar nicht so viele Adressen, aber wenn all diese ihrer Prüfung standhalten würden, dann wäre ihr das die 250.000 Pfund locker wert. Schließlich wollte sie die Schlimmsten der Schlimmen unter den bad bankern haben. Und Cindy hätte noch einmal einen Jahresbonus, wie sie ihn von Mitch bekommen hatte. Sie verabredeten sich für den Mittag, etwas abseits vom Trubel der City, damit sie niemand beobachten konnte.
Diana wartete bereits an der Kaimauer bei Butler’s Wharf auf der Ostseite der Tower Bridge, dort, wo sich seit Jahren eine Restaurantszene in den alten Lagerhäusern entwickelt hatte. Abends traf man hier viele Banker, tagsüber war das jedoch für einen schnellen Lunch zu weit weg. Cindy trug eine dunkle Sonnenbrille, die trotz der kräftigen Wintersonne um die Mittagszeit, die Blicke der Passanten auf die rothaarige Frau mit dunklem Schal und Mantel eher noch anzog, statt sie vor diesen zu schützen. In Jeans, mit Mütze, wattiertem Anorak und Umhängetasche sah Diana eher aus wie eine Touristin. „Ganz anders als sonst“, dachte Cindy, der Diana durch eine Kopfbewegung bedeutete, ihr mit etwas Abstand zu folgen.
Am Designmuseum setzte sich Diana auf eine Bank und wartete, bis sich die ehemalige Primadonna unter den Sekretärinnen des Handelssaals neben sie platzierte. Diese ließ bereits beim Setzen eine CD in Dianas Schoß fallen. Während Cindy scheinbar teilnahmslos auf die Themse starrte, schob Diana die CD ins Laufwerk ihres Laptops, den sie aus einer unauffälligen Tasche gekramt hatte. Mit ihren langen Nägeln klackerte sie auf der Tastatur herum und pfiff hin und wieder, bis sie das Gerät mit flottem Schwung wieder zuklappte.
„Was ist?“ Cindy brach das Schweigen der beiden Frauen, die nebeneinander sitzend auf den Fluss schauten. Diana sagte keinen Ton, verweilte noch einen Augenblick, stand auf und ging grußlos weg. Erst wollte Cindy ihr nachrufen, doch was sollte es bringen? Diana hatte sie über den Tisch gezogen. Hier in der Öffentlichkeit würde alles nur noch schlimmer werden. Diana war zwar eine Nutte, aber eigentlich eine ehrliche. Cindy hätte ihr so ein mieses Verhalten nicht zugetraut.
Unter ihrer Brille kullerten Tränen. Sie ärgerte sich. Ob sie sich über das Fehlen des Bonus, ihre Gier nach Geld oder über diese miese Nutte ärgerte, wusste sie jedoch selbst nicht. Wenigstens schien die Sonne warm und trocknete die Tränen fast umgehend. Zurück in der Carolina Bank, ging sie trotz wasserfestem Make-up erst einmal ins Bad, ehe sie an ihren Schreibtisch im ihr verhassten Marketing des Handelsbereichs zurück wollte.
Gestern Abend, nachdem sie Agnes Thomas aus der Bank hatte gehen sehen und der Handelssaal so gut wie ausgestorben war, war Cindy an Agnes’ Arbeitsplatz geschlichen, die nun für Allan Smith, den neuen Chef des Kapitalmarktbereichs arbeitete. Auf deren Rechner waren immer noch alle wichtigen Kontakte mit Handynummer, Geburtsdatum, privater Adresse und so weiter gespeichert. Sie wusste, wo sie suchen musste. Wahrscheinlich hatte Agnes die Datei noch nie gesehen, geschweige denn genutzt.
In der Datei waren auch die Vorlieben der Herren inventarisiert: welche Zigarren, welcher Wein, welcher Whiskey und welcher Frauentyp. Gerade Letzteres hatte Cindy in einer eigenen Codesprache verschlüsselt, sodass es außer ihr selbst niemandem auffiel. Wenn da stand, jemand habe „schwarzen Humor“, so hieß das, dass er auf schwarze Nutten stand. Und jemand, der „in Gesellschaft gern lachte“, war bei Cindy der Code für einen, der es gerne zu dritt oder viert machte.
Das Passwort sollte kein Problem für Cindy sein, da Agnes dafür zwei Varianten hatte, die sie immer abwechselnd gebrauchte, wenn die Aufforderung der IT-Abteilung kam. Gut, dass sie sich daran erinnert hatte – an die Zeit, als sie noch die Primadonna von Mitch Lehman und Agnes Thomas die Second Lady von Isabella Davis gewesen war: AGMAS oder NESTHO, entweder beide äußeren Silben oder beide inneren und dann den Monat plus das Jahr. So hatte sie immer ein neues Password. AGMASJ10.
Schon das erste Passwort hatte funktioniert. Fünf Minuten später hatte sie die Datei kopiert und zu Hause dann die 250 Top-Shots selektiert und die Codes für Diana in Normalsprache übersetzt. So furchtbar katholisch war das auch nicht, hatte sie sich am Abend eingestehen müssen, als sie fertig war – und aller Voraussicht nach um 250.000 Pfund reicher. Jedenfalls wollte Cindy 2.500 Pfund für ihre örtliche Gemeinde spenden. Dies hatte sie sich zur eigenen Beruhigung bereits gestern vorgenommen.
„Nur zu dumm, dass Diana sich nicht an ihren Teil der Abmachung gehalten hatte“, dachte sie seufzend an die Schweinerei auf dem Weg zurück an ihren ungeliebten Arbeitsplatz. Mitten auf ihrem Schreibtisch lag ein dicker wattierter Umschlag mit der Aufschrift „private and confidential“. Also doch eine ehrliche Nutte! Bereits beim Aufreißen des Umschlags wusste Cindy, was sie darin finden würde. Sie zählte zwar nicht nach, aber es war eine Menge Kohle. Obenauf lag ein kleines Zettelchen: „Danke, du Nutte!“
Lachend fielen sich Diana und Camilla am Nachmittag in die Arme. Seit über einem Monat hatten sich die beiden nicht mehr gesehen. Hier in Dianas Appartement schob Camilla ihr die Zunge tief hinein, wie immer, wenn sie die Alte richtig geil machen wollte. Richtig lesbisch waren beide nicht, aber sie waren es gewohnt, wie es gerade gefiel rumzumachen. Und momentan hatten beide die Nase voll von von Männern. Sie beiden bildeten ein schwarz-rotblondes Haarknäuel. Schlangengleich wanden sie ihre Körper umeinander, während sie sich gegenseitig streichelten. Bis zum Abend blieben sie im Bett, denn sie hatten sich ja auch viel zu erzählen.
Über Finnland auf dem Landweg und mit dem Flugzeug war Camilla als normale Touristin geflohen, nachdem sie ihre Grillparty mit Godunow veranstaltet hatte. Sowohl Wladimir Godunow als auch Mitch Lehman waren nun tot. Die beiden Frauen waren ihre Peiniger auf unterschiedliche Weise losgeworden. Lehmans Tod war nicht ihre Schuld gewesen, Godunows Tod würde wohl kaum aufgeklärt und in Moskau ohnehin lieber verschwiegen werden. Camilla fühlte sich sehr sicher. Außerdem schwieg sie lieber über die Details aus Zermatt und Moskau. Mitwisser waren nie gut, schon gar nicht Diana, die immer alles besser wusste. Aber das mit Godunow hatte so sein müssen. Sein Arm hätte genauso weit gereicht wie der des alten KGB. Godunow hätte sie bis ans Ende der Welt verfolgt, wenn sie einfach so abgehauen wäre.
Dass Mitch sein Spiel in Zermatt verloren hatte, machte ihr die Sache etwas leichter. Ansonsten hätte Camilla ihn auf dem Fluchtweg ermordet. Den Unfall mit Todesfolge während der Flucht auf der glatten Winterstraße hatte sie schon sauber und perfekt durchgeplant, ohne ihre große Schwester einzuweihen. Sie hatte die beiden Männer endgültig loswerden wollen.
Godunow war zwar schwieriger gewesen, denn dieser war noch viel mordlustiger, auch wenn Mitch in den letzten Jahren eine ziemliche Blutspur durch die Welt des Kapitalmarktes gezogen hatte: Isabella Davis, Don Kramer und Robert Pearson gingen alle auf sein Konto. Doch Camilla gelang es, Godunow nach Mitchs Tod mit viel Sex und kleinen Spielen ruhigzustellen, bis sie ihn endgültig, und ohne Spuren zu hinterlassen, erledigen konnte. Das Warten hatte sie bei den Special Forces gelernt. Nun war sie frei, endgültig! Dachte sie.
Doch schon beim Sex ging das Bevormunden irgendwie schon wieder los. Dass Diana sie so bevormundete, wollte sie sich nicht länger bieten lassen. Jetzt, wo fast alles erledigt schien, wollte sie auch ihren „fair value“, ihren üblichen Marktwert. Doch die Freiheit, die Diana meinte, war eine von ihr selbst definierte und auch für Camilla vorgegebene. Das merkte Letztere gleich in der ersten Nacht, die sie seit Monaten wieder zusammen verbrachten. Noch in der Nacht erzählte Diana von ihrem Racheplan. Das gefiel Camilla überhaupt nicht. Sie wollte nun leben, aber Diana setzte sie wieder unter Druck, denn sie hatte das große Geld. Ganz subtil sprach Diana dann von Camillas Eltern: ob sie schon mit ihnen gesprochen hätte, wann sie dorthin fahren wollten und so weiter. Camillas Mutter war eine einflussreiche Politikerin des Landes, die ohne Zweifel sofort zurücktreten müsste, wenn das wahre ihrer Tochter Leben auffliegen würde. Und ihr Vater war ein angesehener Arzt, der wohl ebenfalls in arge Bedrängnis kommen würde.
Camilla wurde immer klarer, dass Diana ihr Ding durchziehen wollte. Aus einer Sklavin Godunows war eine Sklavin Dianas geworden. Die Große wollte für die Kleine mitbestimmen, wie es mit ihrem gemeinsamen Leben weitergehen sollte. Was Camilla für Diana empfand war eine Art Hassliebe. Als Camilla vor Jahren am Boden war, hatte Diana sie unter ihre Fittiche genommen, wurde ihr Mutter, Schwester und Liebhaberin in einem. Doch die Zeit der Abnabelung musste kommen. Entweder Diana würde das verstehen oder sie musste Tatsachen schaffen, aber erst einmal war sie geschafft von ihrer Grillparty.
Ruhe in Frieden
Vorsichtig stieg Diana aus dem Bett. Camilla schlief noch tief und fest. Leise verließ sie das Schlafzimmer und nahm dabei noch ein paar auf dem Boden verteilte Sachen zum Anziehen mit. Am Donnerstagmorgen, so hatte sie im Internet gelesen, gab es in St. Francis Church um acht Uhr eine Frühmesse, die von diesem Pfarrer Hastings gehalten würde. Im Eingang hinterließ sie an der Pinnwand eine Nachricht für Camilla, dass sie gegen zehn Uhr zurück sein würde – nur für den Fall, dass diese bis dahin aufwachen sollte, was Diana allerdings bezweifelte.
Sie nahm in der letzten Kirchbank Platz, dick vermummt in einem gefütterten Ledermantel, ihre Haare unter einem dieser leichten Hermès-Tücher versteckt. So würde sie niemand erkennen. Der Morgen war kalt in London, zumal für jemanden, der gerade aus dem warmen Pazifik kam. Da sie nicht der eigentlichen Andacht lauschen wollte, hatte Diana sich Zeit gelassen und war erst gegen acht Uhr zwanzig in der Kirche erschienen.
Weiter vorne saßen nur wenige Gläubige: ein paar ältere grauhaarige Damen im Pulk sowie zwei Männer in der Mitte, vor denen noch eine Frau mit Mütze Platz genommen hatte, die sehr in sich versunken schien. Es dauerte noch zehn Minuten, bis der junge Pfarrer sie mit einem „Gehet hin in Frieden!“ aus der morgendlichen Messe entließ. Die alten Damen und die beiden Herren erhoben sich fast zeitgleich, als der Kantor seine Orgel zum Ausklang anstimmte, grüßten einander im Mittelgang und gingen verwundert an Diana vorbei, die sich fremd inmitten der morgendlichen Routine vorkam. Diana wollte warten, bis auch die Frau mit der Mütze die Kirche verlassen haben würde, und dann Hastings in der Sakristei aufsuchen. Doch diese machte keine Anstalten, sich zu bewegen. So versunken schien die Mützenfrau. Inzwischen waren die alten Leute aus der Kirche, die schwere Türe fiel krächzend wieder zu.
Als wäre es ein Signal gewesen, zog die Frau ihre Mütze vom Kopf. Ein halblanger rotblonder Schopf kam zum Vorschein. Selbst unter dem Mantel konnte man die lange schlanke Figur der Frau erkennen, die in Jeans und Pullover steckte und Schaftstiefel trug. Diana senkte den Kopf ein wenig, so als betete sie, in dem Moment, da die Frau aus ihrer Reihe trat. Die Gesichtszüge der Frau mit der Mütze waren im schummrigen Licht nicht genau zu erkennen, aber trotzdem zweifelte Diana nicht an dem, was sie sah: ihr Ebenbild, nur rund fünfzehn Jahre jünger. Größe, Figur, Kleidung, das Gesicht und vor allem die halblange rotblonde Frisur. So eine Frisur trug sie auch – seit Mitch sie vor der Hochzeit darum gebeten hatte.
„Hallo, Carla!“ Sie hatte Hastings gar nicht aus der Sakristei kommen sehen, doch beim Namen durchzuckte es Diana so, als hätte sie in eine Steckdose gegriffen.
„Hallo, Pfarrer Hastings!“ Carla sprach leise.
„Deshalb hat Mitch mich geheiratet“, schoss es Diana Lehman, geborene Lundgren, durch den Kopf. Sie hatte den Schlüssel für sein surreales Verhalten gefunden. Nicht sie, sondern die da wollte er haben. Sie senkte ihr Haupt noch ein wenig mehr, aber nicht um nicht erkannt zu werden, sondern weil sie sich jetzt erst recht sicher war, dass alles seine Bestimmung hatte. Sie hatte ihre Doppelgängerin gesehen. Die Todesanzeige von Mitch hatte sie hierher gelockt. Eine göttliche Fügung hatte sie auf Carla Bell treffen lassen. Jetzt wusste sie, was sie hier hingezogen hatte – ihr Ebenbild, Carla Bell.
„In der Kapelle!“, hörte Diana den Pfarrer sagen, ehe beide die Kirche durch die Sakristei verließen. Mitch lag aufgebahrt in der Kapelle neben der Kirche. Hastings führte Carla hinein, die Mitch Pieter Lehman sehr lange betrachtete. Der junge Pfarrer hatte sich mit einem „Sie rufen mich, wenn Sie mich brauchen“ wieder in die Sakristei zurückgezogen.
Überrascht stellte Carla fest, dass das kleine Loch zwei Zentimeter über dem rechten Auge irgendwie zugespachtelt worden sein musste. Jedenfalls war keine Wunde zu erkennen, Mitchs Haar war mit Gel nach hinten gekämmt. Geschminkt, wie er da vor ihr lag, sah er gar nicht so tot aus, was Carla wiederum ein bisschen Angst machte.
Dass Mitch tot war, konnte nicht in Zweifel gezogen werden, so reglos, wie er dalag … Das war völlig untypisch für Mitch! Nie konnte er auch nur eine Sekunde lang ruhig sein. Stets wippte er mit dem Bein, zuckte mit dem Fuß und klackerte mit seinen Fingernägeln auf dem Tisch. Mitch Lehman war immer in Bewegung gewesen, wie die Märkte es waren.
Trotzdem fasste Carla ihn vorsichtig bei den gefalteten Händen, die so kalt waren, wie sein Herz gewesen sein musste.
„Ich bin gekommen, um mit dir zu reden, Mitch.“ Carla ging einmal um den ganzen Sarg herum, die Hände tief in den Taschen ihres Mantels vergraben.
„Ich habe gemerkt, dass wir noch nicht alles miteinander besprochen haben.“ Carla stellte sich neben den Sarg und betrachtete das friedliche Gesicht, das endlich Ruhe ausstrahlte, die Mitch im Leben nie hatte.
„Du hast mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt, Mitch.“ Carla legte ihre Hand nochmals auf seine für ihn so untypisch gefalteten Hände, etwas forscher als beim ersten Mal. Sie hatte Mitch nie beten sehen. „Ich merke, dass ich das mit dir hier und heute zu Ende bringen muss. Ich bin nicht mehr die Alte, Mitch. Du hast mich verändert. Mir ist es erst aufgefallen, seit ich wieder hier in London, in der City, beim CityView bin. Das muss ich zugeben, und bereden kann ich das nur mit dir.“
Carla hatte seit dem Tod ihrer Mutter nicht gebetet, war nicht in die Kirche gegangen und hatte erst recht kein Vertrauen zu einem Pfarrer gefasst. Allein das war eine Änderung für sie. Trotz der Kühle in der Kapelle wurde Carla warm. Sie legte ihren Mantel ab und legte ihn ans Fußende des offenen Sarges. Als sie ihn so ansah, fragte Carla sich, wer ihn wohl derart gekleidet hatte: Mitch Lehman trug einen dunkelblauen Anzug, ein weißes Hemd und eine rote Krawatte.
„Du siehst gut aus, mein Lieber.“ Natürlich war Mitch im Nachhinein für sie vor allem ein vulgäres Schwein gewesen, das gierig und geil gewesen war. Doch am Anfang waren der gute Sex und der schöne Luxus dieser Erkenntnis im Wege gestanden. Mitch hatte eben auch positive Seiten, charmante Momente, sonst wäre sie nicht auf ihn hereingefallen.
„Das erste Mal war das beste Mal, Mitch.“ Im Schlafzimmer seines bombastischen Sommerhauses auf Long Island hatte er sie während seines jährlichen Sommerfestes am Fenster gevögelt. Weder vorher noch nachher hatte es bei Carla so geprickelt, auch wenn die große Glasscheibe ein fiktives Bild widerspiegelte, damit man nicht sah, was drinnen wirklich geschah. Für Carla war es damals, im Sommer 2007, so gewesen, als hätte Mitch sie unter den Augen seiner Frau genommen. Die hatte rein zufällig im Augenblick ihres Höhepunktes neben Carl gestanden, den sie damals allerdings noch kaum gekannt hatte. Das war erst später gekommen.
„Ich vergleiche dich manchmal mit Carl, Mitch. Ich habe euch fast zeitgleich kennengelernt.“ Sie hielt wieder seine Hände und blickte den Toten an, der in diesem Moment wohl herzlich gelacht und sich einen Vergleich mit diesem Dr. No Risk verboten hätte. Carla wusste, dass dieser Vergleich unfair war, vor allem für Carl. Aber beide Männer waren fast zur selben Zeit in ihr Leben getreten, das daraufhin Wendungen nahm, mit denen sie nie gerechnet hatte.
Carla hatte Banker seit dem Tod ihrer Mutter gehasst und musste später erkennen, dass es gute und schlechte Banker gab, dass aber keiner etwas mit Mutters Tod zu tun hatte. Sie hatte während ihrer Affäre mit Mitch immer wieder über die Risiken geschrieben, doch keiner hatte auf sie gehört. Carla hatte ihren Job verloren und bei der Carolina Bank gearbeitet, doch auch sie hatte das Drama um Isabella und Mitch nicht erkannt. Sie war fast ums Leben gekommen und hatte, als Lehman pleite gegangen war, ihre beste Zeit als Journalistin verpasst. Doch auch ohne sie war alles weitergelaufen und die Welt nicht untergegangen.
„Seit ich dich kennengelernt habe, Mitch, werde ich den Gedanken nicht los, dass es völlig egal ist, was ich mache, ob ich schreibe oder nicht schreibe, ob ich dich oder Carl vögel. Die Welt dreht sich einfach weiter. Es ist so, als wäre nichts geschehen. Kann man so einfach weitermachen? Ist Carl nur der Gute, soll ich mich an ihn hängen? Natürlich bist du genau der Falsche für so eine Diskussion, aber was wäre geschehen, wenn ich dich nicht auf Long Island genommen hätte?“
Carla zog ihre Hand zurück. Sie war es damals gewesen, die die Türe wieder zugeschmissen, ihm die Hose geöffnet und die Zunge in den Mund geschoben hatte. Erst dann hatte Mitch losgelegt. Carla war an allem schuld: an der Affäre, an ihrem Rausschmiss, am Unfall, daran, Mitch zu überführen, und letztlich auch an den Mordversuchen an Carl und ihr selbst.
„Mit dir war es einfach, ein Feindbild zu haben, Mitch. Du fehlst mir als Antrieb, weiterzumachen. Es kommt mir alles sinnlos vor.“ Dass Mitch auch dafür verantwortlich gewesen war, dass sie eine Prämie von der Carolina Bank bekommen hatte und nun Teilhaberin am CityView war, kam ihr erst in den Sinn, als sie sich mit der Hand, die zuvor seine Hände gehalten hatte, durchs rotblonde Haar fuhr.
Genauso wie Mitch Pieter Lehman sie auch in die Arme von Carl Bensien getrieben hatte, in denen sie sich zwar wohlfühlte, in die sie aber nicht durch eine eigene Entscheidung gefallen war, sondern weil sie ihn, Mitch Lehman, gejagt hatten und dabei fast von ihm getötet worden waren. Carl war sehr gut zu ihr, der Job beim CityView als stellvertretende Chefredakteurin war gut, doch beides verdankte sie am Ende auch Mitch.
„Alles ausgelöst durch die erste Nummer am Fenster, mein Lieber. Was davon gut und schlecht bleibt, muss ich nun herausfinden, und zwar ohne dich, Mr. Lehman. Ich kann dich nicht für mein Leben verantwortlich machen, auch nicht Carl und auch nicht Simon. Ich bin selbst für mein Leben verantwortlich, ich hätte ja auch manches Mal einfach nein sagen können.“ Carla senkte ihr Gesicht immer weiter, bis ihre Lippen nur noch Millimeter über seinen ruhten. Ihr Haar verfing sich an seinem Kinn, als wollte er sie festhalten und mit ins Grab ziehen. Mitch war schlecht rasiert. Carla erschrak bis ins Mark und zog ihren Kopf hastig zurück, denn fast hätte sie ihn geküsst.
„Ich wollte dir nur sagen, dass du immer ein Teil meines Lebens bleiben wirst, ob ich das nun will oder nicht, Mr. Lehman. Es war eine verhängnisvolle Affäre!“ Sie nahm ihren Mantel und verließ die Kapelle, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Erst Minuten, nachdem Carla die Kapelle verlassen hatte, entstieg Diana dem Platz des Pfarrers im Beichtstuhl. Sie wusste nun, was sie tun würde. Carla würde eine wesentliche Rolle in ihrem Racheplan spielen müssen. Schnell war Diana Carla und dem Pfarrer unbemerkt in die Kapelle gefolgt, die gleich neben der Türe vor dem dicken Vorhang einen winzigen Beichtstuhl hatte, in dem sie sich verstecken konnte. Ohne dass Carla es wollte, hatte sie der Witwe Lehman ihre verhängnisvolle Affäre mit Mitch gebeichtet.
Sir Peter traf sich zu dieser frühen Stunde mit Simon im „Athenaeum“ zum Frühstück. Der Club am Waterloo Place war einer der feinsten Clubs in London, und natürlich war es nicht leicht, dort Mitglied zu werden. Doch sowohl Peter als auch Simon waren seit Langem Clubmitglieder im Athenaeum.
Peter hatte mal wieder ein paar Dinge, die man nicht am Telefon besprechen sollte. Sie frühstückten im großen Gemeinschaftsraum mit seinen hohen Decken und großen Fenstern, den schweren Gardinen und dicken Teppichen, die jedes Geräusch schluckten, wenn man sich unterhielt. Zudem war es heute Morgen auch nicht voll. Wie zufällig ließ Sir Peter dann beim letzten Schluck Kaffee Diospolos’ Namen fallen.
„Der Neue wird viel zu tun haben beim IWF. Kennst du den eigentlich, Simon?“
„Nein, ich war nur ziemlich sauer, dass das mal wieder nur in der FT stand. Kennst du ihn denn?“
„Nein, wir wissen nur etwas über ihn. Aber wir werden ihn in Davos treffen.“ Simon fiel nach all den Jahren immer noch auf, dass Sir Peter gerne im Majestätsplural sprach, wenn es um die Bank von England ging.
„Wir müssten den auch mal treffen.“ Simon lehnte mit beiden Ellenbogen auf der weißen Damasttischdecke und spielte nun ebenfalls mit dem Pluralis Majestatis.
„Könnte ich ja vielleicht arrangieren, Simon.“ Peter faltete die Hände über seinem Bauch, so, wie beleibte Kardinäle es tun.
„Carla geht nach Davos, sie sitzt sowieso auf einem Panel ´Was kommt nach Lehman?` oder so ähnlich. Gerne, mach das, aber es wäre mir eigentlich ein bisschen spät.“
Das war das Startzeichen für Peter, der zufrieden feststellte, dass Simon seinen Block, den er bereits in die ausgebeulte Seitentasche verpackt hatte, noch einmal zückte. Das Frühstück dauerte noch eine halbe Stunde, obwohl sie eigentlich schon fertig gewesen waren, bis Simon alles über den neuen Chief of Staff beim IWF auf seinem Block vermerkt hatte. Nur dass Sir Peter nicht genau das wiedergab, was er von Ellen Klausen gehört hatte. Peter fabulierte lediglich darüber, wie schrecklich es doch sei, dass „ein Deutscher“ die Machtzentrale des IWF managen sollte.
„Eine schöne Story“, dachte Simon zum Schluss und machte sich auf ins Büro. Zwar war seine Nummer zwei wieder sehr spät ins Büro gekommen, aber die Story schrieben sie zusammen. Carla hatte alle Fakten und Simon wieder irgendwelche Informationen aufgeschnappt. Schon am Mittag waren sie fertig, obwohl sie zwischendrin immer noch Artikel der jüngeren Redakteure gegenlesen mussten. Die Storys von Vince nahm sich Carla immer gleich selbst vor. Kurz vor 13 Uhr stand „Der Deutsche“.
Natürlich hatte Simon auch mit Dr. Konstantin Diospolos telefoniert, während Carla zwischendurch redigierte, nur dass der dummerweise nicht die Tragweite der Story erkannt hatte. Doch Simon hielt sich bedeckt, als er mit ihm sprach – den geplanten Titel erwähnte er erst gar nicht. Gerade im IWF war ‚Der Deutsche‘ eine Art Schimpfwort, weil die Deutschen als Falken galten, als währungspolitische Hardliner ohne politisches Geschick. Genau das war aber in seiner neuen Funktion gefordert.
„Carla, was ist los? Du bist in dieser Woche schlimmer als jede Börse. Rauf, runter, rauf, runter, und zwar gewaltig.“ Sie saß in ihrer Ecke auf der abgewetzten Couch in Simons Büro, die Füße auf dem niedrigen Beistelltisch, den Kaffee vor sich. Simon nahm sie direkt ins Visier, blieb aber an seinem alten klobigen Schreibtisch sitzen.
„Das müsste man alles einmal renovieren“, dachte Carla, wusste aber, dass Simon das nie tun würde, solange hier nicht einmal eine IRA-Bombe in die Luft gehen würde. Er war in den Neunzigern dabei gewesen, als die Terroristen den riesigen NatWest-Tower in die Luft sprengen wollten. Jahre hatte es gedauert, bis das Gebäude, das nicht zusammengefallen war, aber ein bisschen wie der schiefe Turm von Pisa dagestanden hatte, wieder gerichtet und benutzt werden konnte.
„Ich habe Zwiesprache gehalten.“ Mit Schwung stand Carla auf. „Und morgen gehe ich übrigens früher, zu Lehmans …“ Sie drehte sich an der Türe noch einmal um, um lächelnd „… Trauergottesdienst. Man muss Abschied nehmen“ hinzuzufügen. Schweigend sah Simon ihr nach, nicht ohne einen genauen Blick auf ihren Arsch zu wagen, dessen Festigkeit ihn an seine verflossene Jugend erinnerte und ihn neidisch auf Carl Bensien werden ließ.
Auf Carls DIN-A4-Zettel mit dem Tageskalender stand am Freitag zur Mittagszeit ein Treffen mit Dave Wagner und Allan Smith. Den Termin hatte Carl extra nach hinten gelegt, weil er nach dem Planungsgespräch noch mit Dave unter vier Augen sprechen wollte. Auch wenn sie nach Piräus lange Jahre überhaupt keinen Kontakt hatten, so sah er es als seine Pflicht an, Dave noch einmal persönlich die Lage zu erläutern. Carl war letztes Jahr schnell klar geworden, dass Dave Wagner ein sehr guter FX-Spezialist war. Ein Foreign-Exchange-Topmanager für die Währungsgeschäfte der Carolina Bank, der sich allerdings Hoffnungen gemacht hatte, Carls Nachfolger als Kapitalmarktchef der Bank zu werden. Doch Carl hatte sich für Allan entschieden, der in den kommenden zwei, drei Jahren Ruhe in den Laden bringen sollte. „Die Hühner in den Legebatterien des Handelssaales musst du in Freilandhaltung überführen“, so lautete Carls Auftrag an Allan. „Wir brauchen ein Team mit mehr Eigenverantwortung und weniger Eigenhandelsgeschäft.“
Wagner spielte dennoch in Carls Planungen eine bedeutende Rolle. Wenn er spätestens in drei Jahren den CEO-Job an den Nagel hängen und Smith einer der Kandidaten für seine Nachfolge sein würde, stünde ein David Wagner bereit, um das Kapitalmarktgeschäft zu leiten. Und genau dafür sollte Dave nach Carls Willen Erfahrungen sammeln, die über die Grenzen des Handelssaals hinausgehen. Wagner sollte anfangen, politisch zu denken, und nicht nur in Kategorien von Margen von Cross Rates bei Währungsgeschäften, wenn Dollar, Yuan, Franken, Euro und so weiter sich nicht parallel bewegten. Dave musste raus aus dem Handelssaal, raus aus der Parallelwelt, in der die Händler lebten.
Smith hatte nichts in Carls altem Büro verändert. Die drei saßen im großen Besprechungsraum. Durch die offene Türe in Richtung des eigentlichen Büros hatte man Blick auf St. Paul’s, der Hauskirche der City, in der sie im Herbst 2008 Isabella Davis’ Trauergottesdienst abgehalten hatten. Nun, heute Nachmittag, wäre der Mann dran, der Isabella auf dem Gewissen hatte. Mitch Lehman, den hier immer noch zu viele Händler verehrten. Zwar war Wagner durch und durch Trader und in dieser Hinsicht Mitch Lehman nicht unähnlich, aber Carl hatte ihn in seiner Zeit genau beobachtet. Der bullige Engländer war risikobewusst, und genau das war entscheidend und würde es aus Carls Sicht auch in den nächsten Jahren bleiben.
Dave legte ihnen dann auch sehr zufriedenstellend dar, was er für 2010 plante, wie er vorgehen wollte und vor allem, welche Risiken er im globalen Devisenmarkt erkannte. Er hatte bereits dafür gesorgt, dass die Carolina Bank einen nicht unbeträchtlichen Teil ihrer Euro-Anleihen aus den europäischen Südstaaten verkauft hatte. Für ihn waren diese hochrentierlichen Papiere zu risikoreich, und genau das gefiel Carl. Denn sollte eines dieser Länder umschulden müssen, würde das auch für die Bank einen herben Verlust ausmachen, den man sich erst eineinhalb Jahre nach der Subprime-Krise nicht erlauben sollte und konnte.
Sauber strukturiert hatte Dave die Einflüsse auf Währungen auf einem Flipchart skizziert, und zwar mit einer ganz einfachen Zeichnung aus Geld- und Fiskalpolitik, aus Wachstumsannahmen und Verschuldungsquoten, aus Wechselkursregimen der großen Blöcke. Er hatte über Preissteigerungsraten, Zinsdifferenzen, Geldmengenwachstum, Wirtschaftswachstum, Kaufkraftparitäten, Produktivität und Verschuldung parliert, aber immer wieder Bezug auf die einfache Zeichnung der Viererbande genommen, die er letzte Woche mit dem iPhone abfotografiert hatte.
„Wie bist du auf die Zeichnung gekommen?“, fragte Carl, als Dave sich wieder setzte.
„Eine alte Geschichte, aus Piräus …“ Carl staunte nicht schlecht, als er Piräus hörte.
„Für Geschichten haben wir aber keine Zeit.“ Allan Smith verzog das Gesicht.
„… die man erzählen kann?“ Zu seiner Verwunderung wollte Carl wohl doch mehr darüber wissen.
„Allan, lass mich noch einen Moment mit Dave allein. Ich nehme mir die Zeit für die Zeichnung noch. Wir gehen dann gleich zum Essen.“ So wie Carl es sagte, gab es auch für Allan Smith keinen Zweifel darüber, dass er nun zu gehen hatte, Carl war der Boss.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Neuausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2013
- ISBN (eBook)
- 9783942822060
- DOI
- 10.3239/9783942822060
- Dateigröße
- 2.8 MB
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2013 (Juni)
- Schlagworte
- Bad Banker Finanz-Krimi Finanzkrise Wirtschaftskrise Finanzthriller Thriller Börsencrash Weltwirtschaftskrise Griechenland Eurokrise Holiri-komplott Der Schwur von Piräus Bad Bank