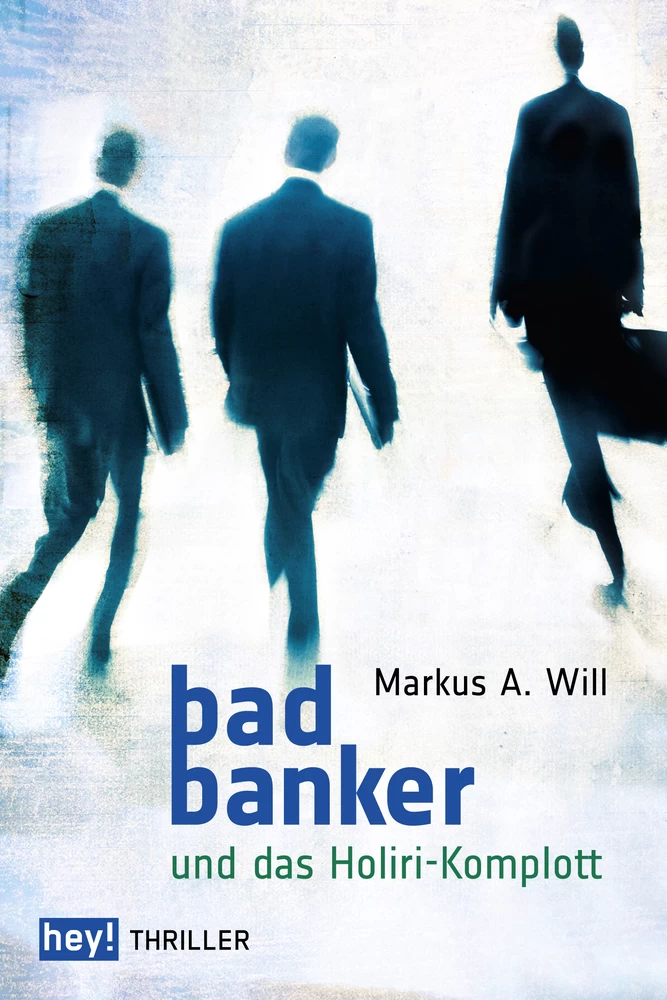Zusammenfassung
Mitch Lehman will alles, und der Erfolg gibt ihm Recht: Der Starbanker der Carolina Bank gehört zu den big playern seiner Zunft. Er scheffelt Rekordgewinne für die Investmentbank und es scheint, als könne ihn nichts und niemand aufhalten. Als 2008 die ganze Bankenwelt zu explodieren droht, findet der Tanz auf dem Vulkan ein abruptes Ende. An den Schauplätzen London, New York, Hawaii, Frankfurt und Zermatt erlebt der Leser ein rasantes Rennen um Macht, Sex, Geld und Einfluss, das in einem dramatischen Showdown an Weihnachten 2009 ein überraschendes Ende findet.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Prolog
»Don soll nicht umsonst ermordet worden sein«
Freitag, 2. Oktober 2009, St. Lawrence Cemetery in New Haven, Connecticut, gut eine Autostunde nördlich von New York City Knapp fünf Tage sind seit dem Attentat auf Donald F. Kramer, Chief Executive Officer der Carolina Bank, vergangen. An der Wall Street starren selbst die coolsten Trader gebannt auf die Bildschirme und verfolgen die Trauerfeier live auf CNN worldwide. Auch in der City, Londons Finanzmeile, hängen die Banker fassungslos vor den Fernsehapparaten.
Die endlos scheinende Wagenkolonne kommt nur im Schritttempo auf der Forrest Road voran. Männer in schwarzen Anzügen überprüfen am großen Kreisel in der Friedhofsmitte, unterstützt von der New Haven City Police, jeden einzelnen Wagen. Die zahlreichen Nobelkarossen müssen nach links abdrehen und werden zum westlichen Ende des Friedhofs dirigiert. An dieser Stelle darf aus Sicherheitsgründen nur noch der Leichenwagen mit Don Kramers sterblichen Überresten passieren, die Trauergäste müssen ihre Limousinen verlassen und die letzte Strecke zu Fuß gehen.
Die großen Blätter der Platanen entlang der breiten Allee, auf der die Trauernden dem mächtigen Sarg folgen, haben bereits eine gelbliche Färbung angenommen. Der Wind spielt mit den Blättern, und wenn es leise rauscht, klingt es wie ein Herbstrequiem. Die Sonne steht bereits tief, noch wärmen die Strahlen. Nahezu alle tragen dunkle Brillen, hinter denen verweinte Augen verborgen bleiben. Don Kramer war ein sehr beliebter Mann und ein ganz Großer der Wall Street.
Über zweihundert Personen sind erschienen, darunter sämtliche mächtigen Bosse der Wall Street, der gesamte Vorstand der Carolina Bank, Vertreter der Notenbank Federal Reserve Bank, des Finanzministeriums Treasury, der Börse New York Stock Exchange und der allmächtigen Aufsichtsbehörde Securities & Exchange Commission. Selbst das WhiteHouse hat einen hohen Beamten aus dem Stab des neuen Präsidenten geschickt, um den Wall-Street-Tycoon auf seiner letzten Reise zu begleiten; eine handschriftliche Kondolenznote des Präsidenten hat er der Witwe bereits überreicht.
Maud Kramer, verhüllt unter einem schwarzen Schleier, hat sich bei Carl Bensien eingehakt; krampfhaft hält sie eine rote Rose in der Hand und folgt festen Schrittes dem Sarg ihres Mannes in der Limousine vor ihnen. Maud versucht, Haltung zu bewahren. Nur Carl, einer von Dons besten Freunden, mit dem er oft im Yale Golf Club ein paar Löcher gespielt und dabei über diese verdammte Finanzkrise gesprochen hat, merkt, wie sehr die Witwe auf seinen Arm angewiesen ist.
Auch nach Lehmans Auftritt am Jahrestag der Pleite vor knapp drei Wochen hatte niemand wirklich geglaubt, dass aus der Drohung blutiger Ernst werden könne, auch wenn die Sicherheitsvorkehrungen seitdem massiv verstärkt worden waren. Der Mord an »DFK« im einundvierzigsten Stock des World Financial Centers, in seinem eigenen Büro im World Headquarter der Carolina Bank, hatte alle eines Besseren belehrt.
Meter um Meter schiebt sich die Menschenschlange voran. Als die Menge von der großen Allee zu Dons letzter Ruhestätte einbiegt, blickt Carl Bensien besorgt auf die vielen Menschen. Wenn es der Mörder geschafft hat, am helllichten Tag in die Investmentbank einzudringen und den CEO zu erschießen, wie wollte da der Security Service verhindern, dass auch an diesem Ort ein weiterer Mord geschieht? Selbst die dezent aufgestellten Kameras von CNN wirken bedrohlich auf den neuen Mann an der Spitze der Carolina Bank.
Hier könnte er sie alle treffen. Alle, die noch viel gieriger waren, als es Don Kramer jemals gewesen war; wie sehr Bensien diese Leute in seinem Innersten verabscheut. Für Maud Kramer war es jedoch keine Frage, dass der Verwaltungsrat ihm noch vor der Beerdigung die Leitung der Bank anvertrauen würde. »Du musst das machen, Carl«, hatte sie ihn angefleht: »Don soll nicht umsonst ermordet worden sein.« So ließ er sich in die Pflicht nehmen, obwohl er als ehemaliger Chief Risk Officer genau wusste, welches Risiko er eingeht und welchem Risiko die Carolina Bank wegen dieser beschissenen Holiris ausgesetzt ist. Ein Bensien drückt sich nicht, und Don hätte dasselbe für ihn getan.
Als Carl Bensien neben Maud Kramer im Kreise der Angehörigen, für die Stühle aufgestellt wurden, vor dem offenen Grab Platz nimmt, sieht er nur versteinerte Mienen, die auf den mit unzähligen roten Rosen geschmückten Sarg starren. Man hatte dafür gesorgt, dass CNN die Kameras nicht auf die trauernde Familie und die engsten Freunde richtet, sondern hauptsächlich das Grab, den Pfarrer und die große Menge zeigt. Ob diese Herren des Geldes dem Pfarrer lauschen, ist nicht zu erkennen; versteckt hinter ihren dunklen Brillen ist ihnen durchaus bewusst, dass es auch sie hätte erwischen können. Jeder hatte einen Lehman in den eigenen Reihen wirbeln lassen. Und alle haben die giftigen Wertpapiere verkauft, die plötzlich alle fast ohne Wert sind.
Als der Sarg ins Grab hinabgelassen wird, stehen die Banker und Händler in New York an der Wall Street still; für eine Minute stoppt der Handel. Viele falten die Hände, einige beten. CNN zeigt beide Orte gleichzeitig: Im linken Teil des Bildschirms wird die Trauerfeier von St. Lawrence Cemetery übertragen, auf dem rechten werden die Reaktionen der Händler in den verschiedenen Finanzinstituten der Wall Street eingefangen. Carla Bell, die aus Sicherheitsgründen an einem geheimen Ort ausharren muss, schießt bei diesen Fernsehbildern nur eines durch den Kopf: Hätten sie doch nur früher einmal für einen Moment innegehalten. Sie presst ihre Hände zusammen, Carla hat Angst, auch wenn Sam nicht von ihrer Seite weicht.
Wie viele Tote mag es schon gegeben haben und wie viele werden noch folgen, geht es Carl Bensien durch den Kopf; er zieht dabei den Scheitel seines grau-melierten Haars mit der Hand nach, während er die an der Witwe vorbeiprozessierende Kondolenzschlange nach vertrauten und vertrauenswürdigen Gesichtern absucht. Seit Beginn der Krise ist nichts mehr, wie es einmal war. Giftige Zertifikate und Derivate haben eine Bank nach der anderen zerstört, nur mit Billionen-Dollar-Spritzen seitens der Regierungen ist der Super-GAU bislang abzuwenden gewesen. Sie sind kaum überstanden, die dunklen Wochen, in denen selbst die abgebrühtesten Banker vor Angst zitterten, dass alles zusammenbrechen würde. Einige, wie Isabella Davis, haben den Druck nicht ausgehalten.
Als die Trauerfeier vorüber ist, gibt sich Bensien einen Ruck und nimmt die zerbrechliche Maud Kramer in die Arme: »Ich werde dafür sorgen, dass Lehman seiner gerechten Strafe nicht entgehen wird.« Dann bittet er Allan Smith, den Finanzvorstand der Carolina Bank und ebenfalls ein enger Freund der Kramers, die Witwe zum anschließenden Empfang zu begleiten. Er verabschiedet sich mit einem kurzen Nicken von den engsten Vertrauten und macht sich auf den Weg. Die Nachricht, die ihn kurz vor der Beerdigung erreichte, duldet keinen Aufschub.
Seinen Fahrer hat Bensien an das andere Ende der Sicherheitsabsperrung beordert, damit er nicht den ganzen Weg zurück und damit an allen Leuten vorbei muss. Bereits hundert Meter von der Trauergemeinde entfernt und seine Limousine im Blickfeld, da hört er hinter sich den Kies knirschen. Weit und breit ist kein Security-Mann zu sehen. Carl Bensien dreht sich um und traut kaum seinen Augen: Lenny Peters, einer der mächtigsten Männer der Wall Street, ist ihm gefolgt:
»Warum so eilig, Charly? Ich wollte noch etwas mit dir besprechen.«
»Leider keine Zeit, Lenny, ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Tut mir leid.«
»Dafür hast du doch jetzt deine Leute, du bist nicht mehr Dr. No Risk, Charly. Du bist jetzt der Boss, einer von uns, Carl. Ein Dr. Big Boy.« Der kleine Lenny Peters erreicht den hoch aufgeschossenen Carl Bensien und blinzelt ihn gegen die Sonne an.
»Einer von euch? Vielleicht. Doch nicht so wie ihr, Lenny.« Carl dreht sich um und geht die letzten Meter zur wartenden Limousine betont langsam. Als sein Fahrer in Richtung Friedhofstor steuert, sieht er Lenny Peters immer noch kopfschüttelnd und wie angewurzelt an der Stelle stehen. Schade, dass CNN das Bild nicht einfangen kann, denkt Carl und wählt von seinem verschlüsselten Telefon aus eine Nummer in der Schweiz.
»Ich liebe diesen Song«, seufzt Carla Bell, als Chris Rea With a Thousand Memories haucht. »Schade, dass es schon vorbei ist.«
»Mal sehen, Lady, ob ich das Lied auf einem anderen Sender finde. Stimmt ja an keinem Tag so wie heute.«
In das Gelächter schnarrt der Suchlauf auf die zahlreichen Verkehrsmeldungen. Der Blick der jungen Journalistin trifft die Augen des Fahrers im Rückspiegel. Fahrer und Taxi haben sicher zwanzig gemeinsame Dienstjahre auf dem Buckel; die Sitze sind abgewetzt, der Motor dröhnt mit leichten Schlägen, es riecht muffig. Nicht unsympathisch der Mann hinter dem Steuer, die randlose Brille ziert ein rundliches, unrasiertes Gesicht, die zotteligen Haare reichen ihm hinten bis über den Kragen.
Ihr Blick fällt auf die Swatch: Zwölf Uhr, um zwölf Uhr zweiunddreißig fährt ihr Zug, und es geht ausgesprochen langsam voran. Die Melodie von Big Ben erklingt, als sie über die Brücke am House of Parliament vorbeifahren. Sie kurbelt das Fenster runter und nach dem letzten »Dong« schnell wieder hoch. Es ist nasskalt, wie immer um diese Jahreszeit in London.
Das Taxi kämpft sich weiter Richtung Greenpark und Knightsbridge, der Fahrer hatte ihr überzeugend erklärt, diese Route sei zu dieser Tageszeit die beste. Von Southwark Bridge in der Nähe der »Financial Times« geht es auf der East Side der Themse bis zur Westminster Bridge und nun weiter an den Parks und dem Buckingham Palace vorbei in Richtung Paddington Station.
Carla hatte das Taxi auf den letztmöglichen Zeitpunkt bestellt, weil sie ziemlich spät aus dem Bett in ihrem kleinen Apartment in Islington gekrochen war. Am Abend zuvor hatte sie sich noch mit einigen Kollegen, die auch erst am 24. Dezember nach Hause fuhren, auf ein paar Drinks im Hampstead Heath getroffen.
Auf dem Weg zum Bahnhof musste sie noch kurz bei der Redaktion vorbei, um ihre Geschenktaschen einzuladen. Und dann kreuzte auch noch Simon auf, als sie wieder ins Taxi steigen wollte. Chefredakteur Simon Trent war auf dem Weg in die Stadt, um endlich das Weihnachtsgeschenk für seine Frau zu besorgen, wie er es immer erst am Morgen des Heiligen Abends tat. Es wurde ein längerer Schwatz, und Carla genoss jedes Wort aus dem Mund des Bosses über ihre große Story, den traditionellen View of the Year.
Am Montag, 8. Januar 2007, erscheint auf der Titelseite des »CityView« der View of the Year, ein Ausblick, den die City-Banker am ersten Arbeitstag des neuen Jahres vorfinden würden. Diese Ehre ist ihr zugefallen – einRitterschlag von Simon Trent. Erst ein Jahr dabei und schon mit dem View betraut. Darauf ist Carla Bell mächtig stolz; gleichzeitig blickt sie besorgt auf den Verkehr. Zwölf Uhr zwei, und der Zeiger bewegt sich unerbittlich weiter. Das Geplauder mit Simon hat zwar Spaß gemacht, aber die Minuten fehlen ihr nun auf dem Weg zur Paddington Station.
Natürlich wäre die Tube schneller gewesen, aber schließlich schleppt sie nicht nur ihren Koffer, sondern auch noch die Geschenke für ihren Vater und ein paar alte Freunde mit sich. Beim Gedanken an die überfüllte U-Bahn und den Mief in den Röhren verzieht sie angewidert ihr Gesicht. Auch wenn Heiligabend diesmal auf den Sonntag fällt, brodelt es in der Stadt. Alle Geschäfte haben geöffnet – Highnoon für Last-Minute-Shopping ist angesagt.
»Mein Zug geht in einer halben Stunde. Schaffen wir das?«, fragt sie ihren Fahrer.
»Lady, Sie wissen gar nicht, wie oft ich ›Schaffen wir das?‹ in den letzten Tagen gehört habe.«
Derweil fördert der Suchlauf ein Sammelsurium an Musik zutage – nur nicht Chris Reas heiser quengelnden Bariton.
Carla ist müde, die letzten Tage hatte sie nicht viel Schlaf bekommen. Journalisten, insbesondere die besten Federn der Finanzpresse, werden stets vor Weihnachten von den Unternehmen hofiert, und Carla hatte sich keine der angesagten Partys entgehen lassen. Trotz ihrer Sorge, den Zug zu verpassen, schließt sie die Augen und lässt sich in die Polster sinken. Augenblicklich taucht die Erinnerung an die Weihnachtsfeier der Carolina Bank vor drei Tagen auf. Dass der junge Banker sie tatsächlich für eine Nutte gehalten hatte, geht ihr nicht aus dem Kopf. »Schätzchen, ich habe auch einen Schuss frei«, hatte der Kerl sie angebaggert. »Vom großen Mitch geschenkt bekommen« hinzugefügt und »wie wärs, bist du gerade frei?« gefragt.
Als der Fahrer in den Rückspiegel schaut, ist die junge Frau in den leichten Taxischlaf gefallen, den er nur zu gut von seinen Gästen kennt. Sie dürfte etwa Mitte zwanzig sein, hat attraktive, etwas herbe Gesichtszüge und schulterlanges, rotblondes Haar. Ihre ramponierte Handtasche wie die Labels der Geschenktüten lassen darauf schließen, dass sie nicht besonders viel verdient. Wahrscheinlich eine Journalistin. »CityView«, wo er – bei laufendem Taxameter selbstverständlich – geschlagene achtzehn Minuten auf sie warten musste, klingt danach. Rund um Southwark Bridge hatte sich seit ein paar Jahren die Medienszene in den alten Fabrikhallen entlang der Themse festgesetzt und dem Quartier zu etwas mehr Glanz verholfen.
Die junge Frau ist ungeschminkt, mittelgroß, trägt Rollkragenpullover, Jeans und schlichte Damenschuhe mit kleinem Absatz. Mantel und Mütze hat sie neben sich drapiert und die Füße auf ihren Koffer in dem geräumigen Londoner Cab hochgelegt. Unter dem dünnen Rollkragenpullover zeichnen sich feste Brüste ab, die sich unter einem dezenten goldenen Amulett im Rhythmus ihres ruhigen Atmens heben und senken.
Schrill und unvermittelt reißt ein Handy Carla Bell aus ihrem Schlummer. Sie ist schlagartig wach und schaut direkt in die Augen des Taxifahrers im Rückspiegel. Der fühlt sich ertappt, konzentriert sich wieder auf die Straße und die stehende Kolonne vor ihnen. Schöne rehbraune Augen hat sie, denkt er. Langsam wird ihm mulmig zumute, ob er rechtzeitig am Bahnhof sein würde.
Beim vierten Klingeln fischt sie endlich das Handy aus ihrer Handtasche. Zwölf Uhr zwanzig zeigt das Display und DAD HOME als den Anrufer, der sie aus dem Schlaf gerissen hat.
»Hi Dad. Bin auf dem Weg«, gähnt sie leise in ihr Handy.
Sie verdreht die Augen, während sie zuhört. »Ich schaffe das schon, habe einen cleveren Taxifahrer erwischt.« Dabei schaut sie den Mann hinter dem Lenkrad beschwörend an.
»Keine Sorge, Dad, zum Early Christmas Drink im Prince of Wales bin ich auf jeden Fall zu Hause. Holst du mich am Bahnhof ab? Ich habe ziemlich viel Gepäck.«
Sie sieht ihn förmlich vor sich: Constable Steven Bell, dem niemand seine vierundfünfzig Jahre geben würde, ist einen ganzen Kopf größer als seine Tochter, die schlanke Figur hat sie von ihm. Sein grauer Schnauzer, den er wie ein Walross zu seinem etwas längeren grauweißen Haar trägt, gibt ihm etwas Gemütliches, was schon manchen Gauner arg getäuscht hatte.
»Ja, meine Story ist fertig. Simon ist zufrieden. Habe ihn eben noch in der Redaktion getroffen. Der geht glatt erst jetzt los, um ein Geschenk für seine Frau zu kaufen.«
Sie hört kurz zu, ehe sie wieder spricht: »Vielleicht muss ich Anfang des Jahres noch ein bisschen daran feilen, aber uns bleibt genügend Zeit. Alles easy, Dad.«
Der Dad am anderen Ende scheint nun länger zu antworten, beobachtet der Fahrer.
»Ich habe die Story ›Business is never usual‹ genannt. Denn eigentlich kann es 2007 nicht so weitergehen. Aber das erkläre ich dir zu Hause in Ruhe. Simon ist jedenfalls auch besorgt. Ich soll dich übrigens herzlich von ihm grüßen.«
Carla Bell weiß, wie froh ihr Vater darüber ist, dass Simon Trent eine Art väterlich-schützende Hand über sie hält, ohne sie zu schonen oder zu bevorzugen. Beide verstanden sich auf Anhieb, als Steven Bell im Frühjahr seine Tochter in der Redaktion besucht hatte.
»Dad, hast du eigentlich schon einmal mit echten Nutten zu tun gehabt?«, wechselt sie zur Überraschung des Fahrers plötzlich das Thema. Der stellt das Radio leiser, ohne dass sein Gast es bemerkt, weil er dabei leicht auf das Gaspedal tippt und der Motor aufheult.
»Ich meine natürlich beruflich. Du hast doch als Polizist schon viel gesehen.«
Was für eine Frage. Der Fahrer starrt angestrengt auf die Straße und versucht, ja nichts zu verpassen.
»Hast du nun oder hast du nicht? Mal ehrlich, Dad: Sehe ich aus wie eine Nutte?«. Carla Bell betrachtet sich dabei in der Trennscheibe, die ihr als Spiegel dient. Sie weiß um ihre Attraktivität und dass die Männer es ihr, wenn sie es darauf anlegt, leicht machen. Nutte! So recht will ihr das immer noch nicht in den Kopf, auch wenn sie schnell durchschaut hatte, wie das passieren konnte.
Anscheinend hat es den Vater am anderen Ende völlig irritiert, denn die junge Frau hält das Handy ein Stück vom Ohr weg. Selbst vorne kann der Fahrer den Vater hören: »Natürlich nicht! Was um Himmels willen treibst du in London?«
»Ich war nur auf einer Weihnachtsfeier.«
»Und da hat man dich für eine Escort gehalten?«
»Oh, du kennst dich aus?«
»Carla, das ist überhaupt nicht witzig.«
»Bitte, Dad, in gut zwei Stunden bin ich zu Hause, dann reden wir«, beschwichtigt sie ihn.
Zwölf Uhr fünfundzwanzig, es wird knapp.
»Bis später. Love you, Dad!«
Carla blickt auf und direkt in die fragenden Augen ihres Fahrers: »Alles mitbekommen?«
»Yeah! Ließ sich nicht vermeiden. Aber keine Sorge: Taxis sind verschwiegene Orte.«
»Und die Fahrer?«
»Ehrensache, junge Dame.«
»Ziemlich blöde Geschichte, die mir da passiert ist.«
»Geht mich nichts an.«
»Sehe ich aus wie eine Nutte? Taxifahrer kennen sich doch damit aus, oder?«
»Nein!«
»Wie bitte?«
»Sie sehen nicht aus wie eine Nutte. Aber dass ihr Dad sich Sorgen macht, ist doch wohl verständlich.«
»Ach, mein Dad, er ist wunderbar. Manchmal etwas zu nervig mit seiner Fürsorglichkeit, aber ansonsten prima. Er hofft inständig, dass ich pünktlich bin, aber das schaffen wir doch, nicht wahr?«
»Ich habe selbst Kinder, die alle an Weihnachten nach Hause kommen. Sie sind meine letzte Tour für heute. Da werde ich noch etwas Gas geben, Lady, damit Sie rechtzeitig zu Ihren Eltern kommen.«
»Ich habe nur noch meinen Dad. Meine Mutter ist gestorben, als ich zehn war.«
Carla wundert sich, dass sie dem Fahrer gegenüber ihre Mutter erwähnt. Normalerweise verdrängt sie gerade vor Weihnachten die Erinnerungen an sie und besonders den Schmerz über ihren Tod. Vielleicht hat ihr Mitteilungsbedürfnis auch damit zu tun, dass gestern Abend dieser Name plötzlich wieder aufgetaucht ist: Stanley Asthon. Der Fahrer unterbricht ihre Gedanken: »Wo müssen Sie denn hin?«
»Nach Hertfordshire. Mein Vater ist Polizist, und wir wohnen etwas außerhalb in einem dieser alten Cottages – sehr ländlich und sehr gemütlich. An Heiligabend gehen wir beide immer in den Prince of Wales, unser altes Dorfpub, wo sich viele Alte und Junge aus dem Dorf zu einem Umtrunk treffen, bevor in den Familien die Bescherung beginnt – es hängt also alles von Ihnen ab!«
Um zwölf Uhr achtundzwanzig biegt das Cab in die Straße vor Paddington Station ein. Der Fahrer zwängt das Taxi in eine schmale Lücke und lässt sich von den ärgerlich hupenden Wagen nicht aus der Ruhe bringen. Knapp, aber es reicht.
Carla zahlt und gönnt sich und ihrem Fahrer ein für ihre Verhältnisse großzügiges Trinkgeld. Als sie aussteigen will, klingt es aus dem Radio:
I'm driving homefor Christmas
Ican't wait to see those faces
I'm driving home for Christmas
»Pech gehabt«, grinst Carla, »aber trotzdem Dankeschön und Ihnen frohe Weihnachten.«
»Ihnen auch! Und grüßen Sie Ihren Vater. Unbekannterweise. Scheint 'ne interessante Tochter zu haben!«
»Ach übrigens: Ich bin Journalistin. Just for the record.«
»Natürlich«, lächelt der Mann und grüßt mit der Hand an der Stirn, während er sich bereits in den Verkehr einfädelt. »Das behaupten viele, Lady«, murmelt er in sich hinein, als er um die Ecke biegt.
Zermatt
»Grüezi, Herr Dr. Bensien. Willkommen daheim.«
»Merci, Max. Schön, Sie zu sehen. Aber ganz sind wir ja noch nicht in Zermatt.«
Max verzieht selbstredend keine Miene darüber, dass der vornehme Dr. Bensien ihn auf der Stelle korrigiert, obwohl man in Täsch doch eigentlich schon in Zermatt ist. Doch so pingelig war er schon immer gewesen, dieser feine Herr aus dem Douvalier-Bensien-Clan.
Carl Bensien ist spät dran. Im dichten Schneetreiben hatte er für die Anreise zum Verladebahnhof Täsch länger gebraucht als geplant.
»Der Zug fährt in zehn Minuten, Dr. Bensien. Ich versorge Ihr Gepäck und parke das Auto. Oben wartet jemand auf Sie.«
Das Skiparadies in den Schweizer Alpen ist autofrei. In großen Hallen an der Talstation lassen die angereisten Gäste aus aller Welt ihre Fahrzeuge stehen und begeben sich mit der Zahnradbahn nach Zermatt. Im Ort selbst verkehren nur Elektrofahrzeuge und Pferdekutschen. Die vielen Fußgänger verleihen Zermatt etwas Gemächliches, selbst wenn der Ort kurz vor Weihnachten mit den vielen Lichtern und Verkaufsständen an jeder Ecke eine hektische Betriebsamkeit entwickelt. Carl Bensien kennt Zermatt noch aus jener Zeit, als es nicht viel mehr als ein kleines Dorf war. Nur noch die Fahrt in der roten Bahn, dann ist er wirklich angekommen. Wie seit zweiundfünfzig Jahren. Außer letztes Jahr.
»Das ist sehr freundlich von Ihnen.« Den älteren Hausdiener kennt Carl noch aus der Zeit, als im Bensien-Clan die Welt noch völlig in Ordnung schien; Max, in seiner schicken Uniform, hat ganz rote Bäckchen vor Kälte, was ihm ein gesundes Aussehen verleiht.
Carl Bensien steigt entspannt in die Zahnradbahn, die ihn in weniger als einer halben Stunde gemütlich nach Zermatt schaukeln wird. Das Glück ist ihm hold: Er hat das Abteil in der ersten Klasse für sich allein, während in den beiden anderen Waggons Stimmen aus aller Herren Ländern ihrer Freude auf weiße Weihnachten und Skifahren lauthals Ausdruck geben.
Driving home for Christmas intoniert gerade das Familienoberhaupt einer vielköpfigen amerikanischen Familie, während er seine Schar mit zügigen Handbewegungen in das Abteil dirigiert. Es sind die letzten Reisenden, der Schaffner winkt mit der Kelle, und ruckelnd setzt sich der Zug in Bewegung.
Seit Wochen dudelt der Song in New York und London aus allen Boxen und Kehlen; eigentlich kann Bensien die Melodie schon lange nicht mehr hören, aber als er nun wirklich heimkommt und die majestätischen weißen Berge immer näher rücken, kann sich auch der verschlossene Bankier einer leisen Sentimentalität nicht mehr verschließen. Sobald er heimischen Boden betritt, wird aus dem internationalen Banker ein Eidgenosse, und ganz automatisch verfällt Carl Bensien dann in das vertraute Schweizerdeutsch.
Er streckt seine langen Beine aus, verschränkt die Arme vor der Brust. Sein Blick schweift durchs Abteil und bleibt an der Werbung an der Wand hinter der Fahrerkabine hängen: »Ricola! Die guten alten Kräuterbonbons. Wer hat's erfunden?« Bensien muss schmunzeln, als er an den Mann aus der Bonbonwerbung denkt, der so treuherzig-hartnäckig »Wer hat's erfunden?« fragen kann.
Das ist wenigstens etwas zum Anfassen. Aber es könnte auch ein Kunstname für ein Zertifikat sein: Risk Collateral Leveraged Asset oder ähnlich. RICOLA. Wie dieses HOLIRI aus dem Londoner Labor. Klingt süß, obwohl es eines der kompliziertesten Derivate ist, für die beim besten Willen die Verbriefungen von abgeleiteten Wertpapieren nicht erfunden worden sind: HOLIRI – Holistic Individual Risk Security – wie verrückt muss man eigentlich sein, um solche Dinger zu entwickeln?
»Ohne Risiko, Carl«, hatte Isabella Davis ihm diese Woche auf seine Rückfrage bezüglich der Risiken energisch am Telefon beschieden.
»Ohne Risiko ist gar nichts im Leben«, hatte er ihr entgegnet, ehe sie sich zum Schluss wenigstens gegenseitig noch »Frohe Weihnachten!« gewünscht hatten.
Während Carl Bensien das Werbeplakat mustert und sich der Zug in eine weitere Kurve auf dem Weg nach oben legt, murmelt er: »Sind ja Super-Senior-Tranchen, die ersten fünf Milliarden, die ich ihr als Weihnachtsgeschenk genehmigt habe. Da kann ja nichts passieren.«
Das Telefonat mit Isabella Davis vor drei Tagen hatte ihn ein paar graue Haare gekostet. Die hochbezahlte Finanzingenieurin hatte sich nur widerwillig mit seinem Zugeständnis von fünf Milliarden Dollar zufriedengegeben, dann aber eingesehen, dass sie sich an dem Schweizer die Zähne ausbeißen würde, wenn sie auf ihrer Forderung bestehen würde. Seinem Assistenten Tim war bei den Summen, die Isabella von ihm als Anlagekapital verlangt hatte, der Mund offen geblieben.
Der quirlige Rotschopf, seit einem halben Jahr sein neuer Risk Assistent, wird sicher schon in Aspen bei seinen Eltern sein. Bensien war zum Abschied ein bisschen schroff zu ihm gewesen, als sie nach dem Telefonat mit Isabella Davis noch weiter über die Holiris diskutiert hatten. Still für sich gelobt er Besserung und tippt in sein Handy: »Lieber Tim, dir und deiner Familie frohe Weihnachten in Aspen. Bin gerade in Zermatt angekommen. Wir sollten im kommenden Jahr mal zusammen Ski fahren gehen. Mal sehen, ob so ein alter Mann wie ich dich noch im Griff hat. Beste Grüße, Carl Bensien.«
Als er die Sendtaste gedrückt hat, fährt der Zug in den Bahnhof von Zermatt ein. Carl Bensien steht auf, nimmt Mantel und Hut. Noch einmal blickt er auf das Ricola-Plakat. Mir gefallen die Holiris nicht, legt er sich gedanklich fest: Verschiedene Risiken verschiedener Menschen auseinanderzuschneiden und dann neu zusammenzuwürfeln, nein. Und die Risiken sollen alle nichts miteinander zu tun haben? Das kann nicht sein. Aber das prüfe ich im neuen Jahr, beschließt er und verlässt das Abteil.
Gegen Viertel vor drei Uhr dürfte er im »Zermatterhof« sein – bis zum familiären Kirchgang um fünf Uhr bleibt ihm noch ausreichend Zeit für einen Besuch bei Erwin an der Bar, rechnet er beim Umstellen seiner Patek Philippe – ein Erbstück, das bereits sein Großvater getragen hat – auf kontinentaleuropäische Winterzeit.
Seine achtzigjährige Mutter hatte ihn ausdrücklich zu diesem Weihnachtsfest nach Zermatt bestellt. Madame Antoinette Catherine Douvalier Bensien ist die Matriarchin des Clans, seit sein Vater Emil Bensien vor zehn Jahren gestorben war. Sein Kompromiss besteht darin, im Grandhotel »Zermatterhof« zu übernachten und nicht im Familienchalet.
»Eine Tradition bricht man nicht, Carl«, hatte ihn seine Mutter am Telefon vor ein paar Wochen belehrt; die älteste geborene Douvalier führt als gestrenge Hausherrin auch in Zermatt unwidersprochen das Zepter. Die Douvaliers besitzen seit Ewigkeiten ein Familienchalet am Dorfrand von Zermatt, etwas abseits vom Trubel, wie es sich für eine zurückhaltende Genfer Privatbankierfamilie gehört. Von außen wirkt das von hohen Tannen vor neugierigen Zaungästen geschützte Anwesen eher schlicht, ist aber innen sehr geräumig. Aus massivem, Jahrhunderte altem Arvenholz gebaut, bietet das Chalet einen fantastischen Blick auf das Matterhorn.
Carl ist immer gerne dort gewesen. Schon als Knabe bei Opa Douvalier, dann mit Mutter und Vater, später mit Frau und Kindern. Seine Mutter hatte bemängelt, dass ihr Sohn nach der Scheidung im letzten Jahr nicht nach Zermatt gekommen war. Um der Kinder und auch der Familie wegen, wie er sich selbst gegenüber zugeben muss, hatten sich Carl Bensien und seine Exfrau Martina inzwischen arrangiert.
Er musste sich eingestehen, dass die arrangierte Heirat zweier alteingesessener Schweizer Kaufmannsfamilien nicht funktioniert hatte, auch wenn Martina und er in jungen Jahren und mit den Kindern durchaus glückliche Zeiten miteinander verbracht hatten. Über die Jahre waren sie zu einer »Gemeinschaft mit Kindern« geworden – zu wenig, um fern der Heimat auch in London gemeinsam glücklich zu sein. Das wiederum hatte niemand in der Schweiz so richtig mitbekommen; umso mehr hatte die Trennung und spätere Scheidung in der Familie für Ratlosigkeit und Entsetzen gesorgt.
Während seine Söhne Emil und Etienne direkt aus dem Internat und seine Exfrau aus Zürich angereist sind, hat Carl Bensien die Reise aus New York auf sich genommen. Trotz der enormen Distanz fühlt er sich nicht müde; Fliegen ist sein tägliches Brot. Der elegante Bankier zählt zu den Menschen, die im Flug wie ein Baby schlafen können, was ihm in der First Class trotz seinen 1,92 Metern problemlos gelingt.
Oben am Bahnhof wartet der angekündigte Porter am Ausgang. Ohne Namensschild in der Hand, in Zermatt kennt man die Sprösslinge der Douvaliers.
»Dr. Bensien, willkommen. Dort vorne steht ein Schlitten für Sie.« Der Mann hätte ein Zwilling von Max sein können.
»Merci.« Das Schneetreiben hat ein wenig nachgelassen, und Carl atmet die feucht-frostige Luft tief ein. »Seien Sie mir nicht böse, aber ich möchte laufen.«
»Bei diesem Wetter, Dr. Bensien?«
»Ich bin weit gereist, um heute hier zu sein, und warm angezogen. Da kommen mir ein paar Schritte zu Fuß sehr gelegen.«
»Wie Sie wünschen. Ich kümmere mich um das Gepäck.«
»Das ist nett von Ihnen«, Carl winkt dem jungen Porter zu und stapft auf die Bahnhofstraße. Es sind nur wenige hundert Meter bis zu seinem Hotel, und er genießt es, sich in der Menge treiben zu lassen. Auf der Straße wimmelt es von Menschen, geschäftig eilen die meisten von Laden zu Laden. Unübersehbar funkeln die Schaufenster der Bijouterie, in der er damals die Ringe gekauft hatte. Bis sie sich entscheiden konnten, hatten sie den Juwelier an den Rand der Geduld getrieben. Martina wollte ganz moderne, er eher klassische Ringe. Am Ende war die Klassik eher im Metall versteckt, sie wählten Gold statt Platin, dafür bekam Martina die leicht achteckige Form. Zuletzt erwiesen sie sich klug genug für pragmatische Lösungen. Selbst die Scheidung, das gemeinsame Sorgerecht und die Urlaube mit den Kindern stellten einen für beide akzeptablen Kompromiss dar. Nur die Lust auf eine feste Bindung, die hatte Martina ihm gründlich verdorben. Seit der Trennung führte Carl Bensien kaum ein auch nur halbwegs passables Liebesieben, wie er sich eingestehen musste. Ein paar halbherzige Versuche hatte er zwar unternommen, doch dabei war es geblieben, echte Gefühle hatte er dabei nicht empfunden.
Über sich und seine Familie nachdenkend, erreicht der Bankier den »Zermatterhof«: Rechts und links der Zufahrt desGrandhotels türmt sich der Schnee. Unter dem großen Dach der Eingangshalle klopft sich Carl Bensien den Schnee vom Mantel. Das ganz in Kirschholz gehaltene Entree, dekoriert mit Christsternen und Tannenzapfen, vermittelt sogleich die Behaglichkeit, die er noch aus Kindertagen kennt, wenn er Großvater Douvalier begleiten durfte, der in diesem Haus stets zur gleichen Zeit an jedem Sonntagnachmittag einen Apéritif zu sich nahm.
»Ich gehe an die Bar«, nickt er der Rezeptionistin zu, nachdem er eingecheckt hat.
»Gerne, Herr Dr. Bensien. Ich werde Ihnen Bescheid sagen, sobald Ihr Gepäck im Zimmer ist.«
»Lassen Sie sich Zeit. Ich werde erst um fünf erwartet«, antwortet Carl, bereits auf dem Weg in die Rudenbar.
My feet on holy ground
So I sing for you
Though you can't hear me
»Hier auch«, seufzt Carl leise beim Betreten der Bar. Diese amerikanische Leier passt einfach nicht zum Spross einer Zürcher Industriellenfamilie mit hochkultivierten Wurzeln mütterlicherseits in Genf.
»Dr. Bensien, wie schön, Sie hier zu sehen. Ich habe Sie vermisst im letzten Jahr.« Erwin Blatter, seit über dreißig Jahren im Haus und seit achtzehn Jahren Barchef im »Zermatterhof«, kommt extra hinter der Theke hervor, um dem Gast herzlich die Hand zu schütteln.
»Salü, Erwin. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite.«
»Calanda?«, fragt der rundliche Barkeeper, den alle nur beim Vornamen nennen. Sein Haupthaar war früher auch schon voller, stellt Carl Bensien fest. Die Bar hat sich seit seinem letzten Besuch nicht verändert. Die helle Verkleidung des Tresens, der ebenfalls helle Parkettboden mit dem dunklen Gitternetz und die dazu farblich passenden Hocker mit weichem Lederpolster bilden einen schönen Kontrast zur dunklen Holzvertäfelung im Eingangsbereich, zu dem hin sich die Rudenbar öffnet, ähnlich wie in seinem Londoner Club, dem er auch nach seinem Wechsel zur Carolina Bank nach New York treu geblieben ist.
Als Chief Risk Officer hält er sich meist zweimal im Monat für ein paar Tage in der englischen Metropole auf und wohnt dann im Club. Bensien schätzt vertraute Orte; ob Club oder Bar – er ist ein Gewohnheitsmensch. Also hockt er sich mit Schwung auf seinen angestammten Platz an der runden Theke mit Blick in die Empfangshalle, wo er schon als Junge gesessen ist.
»Wie immer, Erwin.« In London und New York verlangte es ihn so manches Mal nach diesem Schweizer Bier. Schneller als gewöhnlich nimmt er einen großen Schluck – bereits nach dem ersten Zug ist das Glas halb leer.
»Sie sehen blass aus, Dr. Bensien, wenn ich mir das erlauben darf.«
Natürlich weiß Erwin, dass er sich diese Vertraulichkeit bei Carl Bensien leisten darf.
»Zu viel Fliegerei, zu viele Meetings, Erwin. Ich habe in den letzten Monaten kaum frische Luft bekommen. Investmentbanking ist ein ungesundes Geschäft.«
»Ich denke, Sie sind seit zwei Jahren in New York stationiert?«
»Stimmt, aber man muss diesen Händlern rund um den Erdball immer wieder in die Augen schauen. Sonst machen die, was sie wollen.«
»Wie bei mir, Dr. Bensien. Ich schaue den Leuten an der Bar in die Augen, und ich weiß, ob ich ihnen trauen kann.«
»Vielleicht sollte ich die nächsten zwei Wochen mal bei Ihnen hinter der Bar stehen.« Und in das Gelächter hebt er sein Glas: »Noch ein Bier bitte.«
»Ihrer Figur hat die viele Fliegerei aber nicht geschadet«, ein gewisser Neid in Erwins Stimme ist unüberhörbar.
»Fitnessclub, Erwin. Im Gebäude. Dreimal pro Woche morgens. Wer will schon durch New York oder London rennen, wenn er zuvor in der Schweiz joggen konnte?«
Relativ zügig trinkt Carl Bensien auch sein zweites Bier, ehe die junge Rezeptionistin mit dem Schlüssel zu ihm kommt.
»Frohe Weihnachten, Erwin. Bis morgen. Heute ist en famille.«
»Bitte grüßen Sie Ihre Frau Mutter und, ähm…, Ihre Familie.«
»Schon gut, Erwin. Was meinen Sie, warum ich hier wohne? Hat auch seine Vorteile, denn sonst musste ich immer vom Chalet herunterlaufen.«
Lächelnd verabschiedet er sich und begibt sich in eine Medium Suite, ausgestattet mit Schlafzimmer und einem kleinen Erker im Wohnraum nebst Esstisch – alles in Holz gehalten. Aus beiden Zimmern hat der Bewohner einen atemberaubenden Blick auf das Zermatter Wahrzeichen.
Wenn er schon vierzehn Tage im Hotel wohnen muss, will sich Carl Bensien auch bewegen können. Zudem beabsichtigt er, sich mit seinen Söhnen ungestört von fremden Ohren zu treffen; im Chalet hörte immer jemand mit. Und wenn die drei Bensiens ordentliche Burger essen wollten, mussten sie sich vor seiner Mutter und seiner Exfrau verstecken.
Erwin serviert gerade in der Halle eine Magnumflasche Veuve Clicquot an Russen, als Bensien aus dem Aufzug tritt. Er mustert die Gruppe, und seine leicht hochgezogene Stirn verrät dem Barchef, wie wenig der Bankier deren Gebaren schätzt.
Carl Bensiens langer, schlanker Körper steckt in einem maßgeschneiderten, einreihigen Flanellanzug, darunter trägt er eine Weste mit drei Knöpfen; eine seiner wenigen Lässigkeiten, die er sich gestattet, ist seine in der Hosentasche befindliche linke Hand. Nur der Doppelschlitz am Rücken erlaubt, dass der dunkelgraue Anzug trotzdem perfekt sitzt. Bensien hat ein bräunliches Einstecktuch passend zur Krawatte gewählt, die mit einem grauen Streifen leicht durchwirkt ist und eine dezent modische Note setzt. Das maßgeschneiderte Hemd ist hellblau, ohne Monogramm mit Manschetten-Erbstücke seines Großvaters. Monogramme, so hatte ihm sein Vater beigebracht, gehören sich bei Zürcher Industriellen nicht – werden sie doch zur äußersten Zurückhaltung auf allen Ebenen erzogen. Die Hose ist derart geschnitten, dass sie auch ohne Gürtel passt; sie sitzt leicht auf den Schuhen auf und hat keinen Schlag. Im Winter bevorzugt Bensien Schuhe mit schwarzer Gummisohle, da das Leder bei Nässe und Schnee leicht brüchig werden kann.
Einzig diese Kniestrümpfe, denkt Erwin, als er sie bei einem langen Schritt des Bankiers hervorblitzen sieht. Sein Gast trägt stets Strümpfe, die ein paar Farbstufen heller sind als die jeweilige Hose. Vor einigen Jahren hatte Bensien einmal mit einigen seiner früheren Internatskollegen aus der Westschweiz an der Bar gebechert. Viel lockerer als sonst war Dr. Bensien da, im Kreise seiner Buddies. Nicht so kontrolliert, erinnert sich Erwin. Die Jungs hatten ihm erklärt, dass der hellere Sockenton das Erkennungszeichen ihres Internats sei, das sich über die Jahre erhalten hat.
Als Bensien an Erwin vorbeigeht, fragt der eine Russe gerade: »Können Sie spielen ›Driving home for Christmas‹?«
Bensien hält kurz an: »Na denn, frohe Weihnachten, lieber Erwin« und, mit Stirnrunzeln zu den Russen, »trotz allem.«
»Ihnen auch, Dr. Bensien.« Der Barkeeper schaut Carl noch einen Moment hinterher. Als Bensien die große Eingangstür des »Zermatterhofs« geöffnet wird, rufen die Glocken zum Kirchgang. In Zermatt ist es sechzehn Uhr dreißig.
Carl Bensien trifft eine Viertelstunde später vor der Kirche ein. So richtig wohlfühlt er sich heute nicht in seiner Haut. Martina und die Kinder zu sehen ist das eine, aber an Weihnachten, wenn selbst seine Mutter ein wenig die Contenance der Romantik und dem Likör opfert, wird ihm das Ganze sentimentale Auf und Ab vielleicht doch zu viel. Noch eine Viertelstunde bis zur Weihnachtsmesse.
»Hallo, Dad«, klingt es synchron von beiden Söhnen und gleichzeitig reserviert, als sie ihren Vater entdecken. Seit ihrer Zeit in London nennen die Jungs ihn am liebsten ›Dad‹. Carl Bensien schlägt die Kühle der Buben auf den Magen; er weiß, wie sehr es ihm die beiden verübeln, dass er nicht mit Martina in die Schweiz zurückgekehrt ist. Die Jungs umarmen ihren Vater dennoch herzlich, weil sie froh sind, dass er in diesem Jahr wieder mit in Zermatt ist. Der Größere, Emil, obwohl erst fünfzehn Jahre alt, ragt schon fast an den Vater heran. Etienne ist einen Kopf kleiner, aber auch jünger als sein Bruder. Anfang Januar wird Etienne dreizehn Jahre alt. So lange will ihr Vater in Zermatt bleiben. Die altmodischen Namen haben sie von ihm, Dr. Carl Emil Etienne Bensien, der sie wiederum von seinem Vater und Großvater mütterlicherseits geerbt hat.
»Hallo, Carl.«
»Hallo, Martina«, begrüßt Carl Bensien seine Exfrau mit drei Küssen ä la Suisse. Martina Bensien trägt Nerz mit passender Fellmütze. Ihre 1,80 Meter verleihen dem Pelz noch mehr Eleganz, ihr filigraner Körper braucht im Winter viel Wärme. Sie trägt elegante Winterstiefel zur Hose – ein Zugeständnis an die klirrende Kälte. Das Schneetreiben hat inzwischen aufgehört.
Nachdem er sich schnell aus ihrer Umarmung gelöst hat, begrüßt Carl Bensien reihum die Familie. Onkel Theodore mit Frau Claudine und den Kindern Fabienne und Dominik, seiner Cousine und seinem Cousin. Carls und Dominiks Hände streifen sich kaum.
»Hallo, Dom.«
»Hallo, Ceeb.«
Dominik und er waren im selben Internat gewesen, allerdings nicht in derselben Klasse, da Carl zwei Jahre älter ist als sein Cousin. Niemand nannte ihn im Internat Carl, sondern alle Ceeb – die Anfangsbuchstaben seiner Vornamen. In der Familie ist Dominik der Einzige, der ihn Ceeb nennt. Seit Carl vor zehn Jahren allerdings den Kopf für Dominiks Fehler hinhalten musste, ist ihre Freundschaft dahin.
Dom war schon immer ein Draufgänger gewesen und hatte zu viel riskiert. Nur dass Carl dummerweise für die Währungsgeschäfte verantwortlich war, weil er eben älter war, etwas schneller studiert und dann auch erfolgreicher bei Douvalier & Cie. gearbeitet hatte. Dominik hatte sich Zeit gelassen und war erst mit fünfunddreißig Jahren in die Bank der Familie eingetreten, die sein Vater Theodore, Carls Onkel, leitete.
Zu jener Zeit war Carl schon sieben Jahre dabei; nach Studium und Promotion war er mit dreißig Jahren als Trainee bei Douvalier & Cie. eingetreten. Während Carls älterer Bruder Claus von ihrem Vater auf die Übernahme der Industrieholding, der Bensien-Gruppe, vorbereitet wurde, sollte Carl die Interessen des mütterlichen Douvalier-Vermögens bei der Bank vertreten. Mutter war neben ihrem jüngeren Bruder Theodore eine der großen Anteilseignerinnen von Douvalier & Co. Privatbankiers in Genf.
Vor zehn Jahren, mit zweiundvierzig, stand Carl Bensien kurz davor, Gesellschafter der Bank zu werden und entgegen der Tradition als ein Namensfremder seinem Onkel Theodore Douvalier als Sprecher zu folgen. Doch Dominik Douvalier, der zu diesem Zeitpunkt fünf Jahre mehr oder weniger in der Bank gefaulenzt hatte, ohne sich richtig in das Geschäft hineinzuknien, hatte sich mit Währungsrisiken verzockt. Und Cousin Carl trug die Verantwortung.
Theodore Douvalier hatte die Chance genutzt, seinen Neffen aus der Privatbank zu drängen, da er ansonsten kaum hätte durchsetzen können, dass sein Sohn eines Tages die Leitung der Bank übernehmen könnte. Sein Schwager war kurz zuvor völlig unerwartet verstorben, und die Bensiens standen zu sehr unter Schock, um sich zu wehren.
Carl Bensien verließ die Bank und ging nach London, da er der Schweiz beruflich den Rücken kehren wollte. In der City arbeitete er für eine der Mitte der Neunzigerjahre noch existierenden Privatbanken. Dominik Douvalier wurde Anfang 2001 Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter von Douvalier & Cie. Privatbankiers in Genf. Seit dieser Zeit waren die Zürcher Douvalier Bensiens – wie der Familienzweig von Carls Mutter genannt wurde – nicht mehr in der Geschäftsführung der Bank in Genf vertreten. Das Verwaltungsratsmandat übernahm Carls älterer Bruder Claus, der jedoch rein gar nichts von Banking verstand.
Verstohlen mustert Carl Bensien seinen Cousin, der – zumal er ihm nicht in die Augen schauen konnte – sich verlegen mit Martina unterhält. Dicklich, zu wenig Bewegung, ungesund – wenigstens bekommt ihm das Ganze nicht auch noch, denkt Bensien. Noch mehr erstaunt ihn jedoch, dass ihm die Begegnung überhaupt nicht zusetzt, und das stimmt ihn an diesem Tag zum ersten Mal ausgesprochen heiter.
Er grüßt weiter in die Runde der zahlreichen Nichten und Neffen, die er kaum mehr auseinanderhalten kann, ehe am Ende seine Mutter Antoinette auf ihn wartet. Mutter hat volles Ornat angelegt. Der ganze Familienschmuck wird heute ausgeführt, alles von erlesener Eleganz. Madame Douvalier Bensien, im Kostüm von Chanel, trägt das Haar silbergrau mit Wasserwelle. Sie würde selbst bei minus zwanzig Grad Celsius keinen Hosenanzug tragen. Handschuhe, Fellmütze und -mantel sowie Stiefel mit leichtem Absatz vervollständigen ihre eindrucksvolle Erscheinung.
»Bonsoir, mon eher«, sagt sie und küsst Carl auf die Wange, der sich respektvoll zu ihr hinunterbeugt. »Ich schätze es sehr, dass du hier bist.«
»Ich freue mich auch, Mutter. Du siehst blendend aus.«
»Merci, mein Sohn.«
»Wo ist Claus?«, fragt Carl und blickt nach seinem älteren Bruder suchend um sich.
»Er kommt erst morgen«, antwortet seine Mutter schneidend. »Keiner hält mehr etwas auf die Tradition, mein Sohn.«
»Mutter, es gibt Dinge, die man nicht ändern kann. Lass uns nicht davon anfangen. Es ist Weihnachten.«
Das Einsetzen der Kirchenglocken beendet den aufkeimenden Zwist. Carl hakt seine Mutter galant unter, seine Söhne nehmen Martina in die Mitte. Auf den Stufen zur Kirche schaut ihn die Matriarchin noch einmal von der Seite an: »Man kann alles ändern, Carl, wenn man nur will. Auch du.«
Perth
»Let's go, Jim«, mit müder Stimme und einem Fingerzeig auf ihre Lange Eins bedeutet Isabella Davis ihrem Mann, dass es Zeit ist, die Feier zu verlassen. Die große Herrenuhr macht sich gut an ihrem kräftigen rechten Handgelenk. In Perth ist es wenige Minuten nach Mitternacht. Während für den Douvalier-Bensien-Clan in der Dorfkirche von Zermatt der Heilige Abend beginnt, ist er für Familie Davis bereits so gut wie vorbei. Isa, Jim und die fünf Kinder Pete, Rich, Charlie, Claudia und Melissa sind müde, Jetlag und die sommerlichen Temperaturen im Westen von Australien leisten ihren Teil.
Isabella Davis trägt ein blaues, kniefreies Kleid mit weißen Punkten und Spaghettiträgern. Bei über zwanzig Grad im Dezember genau das richtige Outfit. Die blauen Ballerinas mit der weißen Hacke seien witzig, meinte wenigstens ihre Älteste, als sie sich vor Stunden auf den Weg zu den Großeltern Davis gemacht hatten.
»Okay, let's go, Davis family«, wiederholt Jim mit seinem dröhnenden Bass die Anordnung seiner Frau. Da alle satt und müde sind, gibt es keine Widerworte. Bei diesem Blick weiß Jim, dass es keinen Sinn hat, seine Frau überreden zu wollen, doch noch einen Moment zu verweilen. Ohnehin war es schwierig genug für ihn gewesen, Isabella davon zu überzeugen, nach so langer Zeit die Weihnachtstage wieder einmal bei seinen Eltern in Perth zu verbringen.
»Schön war es, Mama.« Isabella küsst ihre Schwiegermutter beim Abschied auf die Wange. Das Heucheln fällt ihr für ein paar Tage nicht schwer.
Der Tannenbaum in der großen Halle des Golfklubs ist an manchen Stellen mit weißer Farbe besprüht worden, um Schnee zu evozieren. Solange man nur auf den bunten Baum mit den roten Kugeln und dem glitzernden Lametta schaut, funktioniert das wie eine Fata Morgana … Doch ein Blick aus dem Fenster genügt, um zu realisieren, dass draußen keinSchnee liegt und die Sonne nur Nachtruhe hält. Auch der Speisesaal ist weihnachtlich dekoriert. Man merkt den Australiern halt doch ihre europäische Herkunft an, stellt Isabella einmal mehr bei sich fest, wenn sie sich in »down under« aufhält.
»Legst du mir die Stola um, Jim?«
Isabella hält den Kopf meist leicht schräg nach links vorne geneigt. Ihr blondes Haar fällt vom Scheitel dann nach vorne und bedeckt ihre linke Gesichtshälfte. Mrs Davis, wie sie Jim manchmal scherzhaft vor anderen nennt, hat diese Haltung seit Jahrzehnten einstudiert, sie ist ihr zur zweiten Natur geworden. Nur wenn sie den Kopf ganz hoch nimmt, sieht man beide blauen Augen und die Narben. Dieser unglaubliche Blick, denkt Jim.
Vor dreizehn Jahren hatte sie James Davis auf einer Happy Hour in New York kennen gelernt; seitdem setzt sich meistens Isabella durch. Jim spielt in dieser Beziehung eindeutig die untergeordnete Rolle, schließlich ist es seine Frau, die in ihrer Familie das Geld nach Hause bringt. Nicht, dass er als Anwalt schlecht verdient, aber Isabellas Gehalt als Managing Director bei der Carolina Bank in London konnte er nicht im Ansatz erreichen. Als Physikerin mit Spezialgebiet »Rocket Science« berechnet und strukturiert Isabella Davis alles, was die Carolina Bank an Derivaten und Zertifikaten auf den Markt bringt. Sie ist, wie sie fast immer in der Bank genannt wird, die »Rakete« des Kapitalmarktbereichs.
Schnell verabschiedet sich der Londoner Davis-Zweig bei den australischen Familienmitgliedern, die alle zusammen im Chidley Point Golf Club am Swan River getäfelt haben. In Perth ist es auch nach Mitternacht noch angenehm warm, selbst wenn vom nahen Indischen Ozean ein laues Lüftchen weht. Eine Viertelstunde später sind die sieben Davis in ihrer Suite im »Ozean Beach Hotel« angekommen, ein Hotel, das seine beste Zeit hinter sich hat.
Als Isabella die Suite betritt, rümpft sie ein wenig ihre Nase; aber es ist ja nur für ein paar Tage, ehe sich die ganzeFamilie zum Skilaufen in die französischen Alpen aufmacht. Da liegt dann richtiger Schnee, was die Kinder und Jim kaum erwarten können, für Isabella jedoch eine große Überwindung bedeutet, da ihre Narben extrem kälteempfindlich sind. Wenigstens muss sie dann die lärmige Sippschaft ihres Gatten nicht mehr ertragen, und während sechs Mitglieder ihrer Familie auf den Brettern die Pisten hinunterwedeln, freut sich Isabella auf ruhige Stunden im Hotel und kleine Spaziergänge im Schnee.
Die Kinder ziehen sich schnell mit ihren Geschenken in ihren Bereich der geräumigen Suite zurück, während Isabella sich auszieht und ins Bad begibt. Sie muss sich das Bad mit Jim teilen, weil die beiden Mädchen sich nicht mit den drei Jungs im gleichen Badezimmer aufhalten wollten. Selbst eine Drei-Zimmer-Suite mit »nur« drei Bädern kann ziemlich klein sein, wenn sich fünf Kinder darin breitmachen.
Jim beobachtet seine Frau, die bereits in ihr seidenes Nachthemd geschlüpft ist, durch die geöffnete Badezimmertür. Die schwere Perlenkette legt sie immer erst am Nachttisch ab, ebenso die Uhr. Beide nicht von ihm. Beide Sonderboni. Ringe und Ohrstecker behält sie auch nachts an. Ein kleiner Trost für ihn, dass er sie ihr geschenkt hat.
Isa ist mit 1,74 Meter für eine Frau recht groß und als ehemalige Leistungssportlerin immer noch durchtrainiert und schlank. Seit dreiundvierzig Jahren vergeht kaum ein Tag, an dem sie keinen Sport macht; jeden Morgen verbringt sie eine halbe Stunde im Keller an den Geräten. Etwas maskulin ist sie, was ihr in der Männerwelt der Trading Floors das Leben leichter macht. Als sie merkt, dassJim sie beobachtet, schließt Isabella die Türe.
»Du Spanner«, dringt es durch die geschlossene Türe, mit einem Lächeln in der Stimme, glaubt Jim jedenfalls herauszuhören. Der Spiegel auf der Außenseite der Badezimmertür zeigt ihm einen Neunundvierzigjährigen mit schütterem Haar und Doppelkinn, gekrönt von abstehenden Ohren in Shorts und T-Shirt, mit neunzig Kilo deutlich übergewichtig.
Gott sei Dank, gesteht er sich selbst ein, haben die Kinder mehr von Isabellas Schönheit als von seinem Äußeren geerbt. Aber Jim weiß, warum sich Isabella für ihn entschieden hat. Er ist nicht zu anspruchsvoll und in jeder Hinsicht hilfsbereit.
»It is a deal, Jim«, antwortet sie stets, wenn er sich – was selten genug geschieht – beklagt. Beide führen das, was man eine zufriedene durchschnittliche Funktionsehe nennt. Isabella fühlt sich wohl in Jims Gegenwart, sie vertraut ihm mehr als jedem anderen. Sie ist stolz auf das, was sie aufgebaut haben, wie sie oft genug betont, aber geknistert hat es eigentlich nie zwischen ihnen, geht es ihm durch den Kopf. Andererseits haben beide das, was sie wollten: eine Familie und ansonsten viel Freiraum. Sie für ihre Arbeit, er für seine Arbeit, beide auch für die Kinder, aber Jim ist in Familienangelegenheiten wesentlich engagierter als seine Frau. Das Öffnen der Badezimmertür reißt Jim aus den Gedanken, die ihn immer wieder einholen.
»Frei für dich, mein Schatz.«
»Dankeschön«, freut sich Jim, den langsam die Müdigkeit übermannt.
Ihre Wege kreuzen sich und Isabella nimmt Jim in den Arm, küsst ihn und murmelt: »Es war gar nicht so schlimm bei deinen Eltern.«
Jim, plötzlich wieder hellwach, nutzt die seltene Gelegenheit und versucht seine Frau zu liebkosen. Zu seiner Überraschung lässt sie sich sogar darauf ein, was er dem guten australischen Rotwein und den sommerlichen Temperaturen zuspricht.
Sie küssen sich, werden jedoch durch ein Brummen gestört. Isas Handy vibriert auf dem Nachttisch. Sie löst sich aus der Umarmung ihres Mannes und nimmt ihr Handy zur Hand.
»Oh, den muss ich nehmen«, sie lächelt und schaut kurz zu Jim hinüber. Der weiß bei diesem Lächeln ohnehin, wer am anderen Ende der Leitung ist, und verzieht sich ins Bad.
»Okay«, hört er sie noch sagen, ehe Isabella anfängt zu singen:
But I will be there
To sing this song
To pass the time away
Driving in my car
Christmas
Gonna take some time
Jim kann weder das Lied noch den Kerl am anderen Ende der Leitung ausstehen, weiß aber, dass er gegen ihn nicht ankommt. Was Frauen an Mitch Lehman so anziehend finden, ist ihm ein Rätsel. Er stopft sich zwei Wattebäusche in die Ohren und erledigt seine Nachttoilette. Nach dem Zähneputzen nimmt er sie noch einmal heraus, um den Stand der Gesangsstunde zu testen:
Get my feet on holy ground
So I sing for you
Though you can't hear me
When I get through
And feelyou near me
Zum Glück ist der Kerl weit weg, denkt Jim und stopft sich die Ohren wieder zu. Er entscheidet, etwas länger im Bad zu bleiben und auf dem Klo zu lesen, bis der Spuk vorbei und seine Wut vielleicht verraucht sind. Als er das Bad schließlich verlässt, zeigt die Uhr auf Isabellas Nachttisch halb zwei Uhr morgens am 25. Dezember 2006. Isabella schläft.
»Was das nun wieder sollte«, murmelt er. Seine Wut hat sich immer noch nicht verzogen. Jim geht dicht auf seine Frau zu, beugt sich über sie und holt aus. Mit voller Wucht zielt seine rechte Hand in Richtung ihrer linken Wange. Die Narben sind klar zu erkennen – eine schwere Verbrennung aus ihrer Kindheit. Die ganze linke Seite, vor allem die Partie hinter ihrem Auge bis über das Ohr hinaus und den oberen Teil des Halses, waren schwer verbrannt, als sie als zehnjähriges Mädchen mit dem Gaskocher hantierte. Vorne auf der Wange waren fast alle Narben wegoperiert worden, und man musste schon ganz nahe an sie herankommen, um etwas zu erkennen, aber das ließ Isa ohnehin nicht zu. Von der Schläfe an und um das Ohr herum konnten die Schönheitschirurgen nichts mehr ausrichten. Besonders wenn sie ungeschminkt ist und ihre Haare den schlimmeren Teil unter dem Ohr nicht verdecken, sind die Narben deutlich zu erkennen. Isabellas Gesicht wirkt dann auf einmal geradezu hässlich.
Kurz vor der Wange hält Jim inne und streichelt sie ganz zart. »Ich könnte dich an die Wand klatschen, wenn du mit diesem Kerl redest«, sagt er leise. Isabella hört ihn nicht, sie schläft seelenruhig den Schlaf der Gerechten.
Für Jim ist unerklärlich, dass eine Frau mit ihrer Verantwortung so ruhig schlafen kann. In seine Musterung schiebt sich die Erinnerung an ein Telefonat zwischen Isa und Mitch Lehman, ihr Boss und Gesangsadressat. Völlig untypisch hatten sich Mitch und Isabella gestritten – über irgendwelche Holiris. Als Jim nach dem Telefonat gefragt hatte, worum es denn gegangen sei, hatte sie noch ganz in Rage gezischt: »Das verstehen nur Finanzingenieure.«
»Aber das ist Mitch doch auch nicht«, hatte Jim eingeworfen.
»Genau das ist das Problem, mein Lieber«, hatte sie erwidert und sich Jims Zärtlichkeiten hingegeben. Isabella konnte den Schalter umlegen wie ein binäres System.
Ihr großer Brustkorb hebt und senkt sich rhythmisch, die Brillantohrringe glitzern im Schein des Lichts aus dem Bad. Während Jim seine Frau ansieht, kommt ihm in den Sinn, dass die Partner in seiner Anwaltskanzlei letzthin sorgenvoll über die Risikopositionen der Banken gesprochen haben.
Muss ich Isa gelegentlich drauf ansprechen, nimmt er sich vor, ehe er das Licht im Bad löscht und schwer vor Müdigkeit ins Bett sinkt. Isa liegt nun auf ihrer rechten Seite, mit dem Gesicht zu ihm, sodass er die ganzen Narben sieht. Eine Frau mit zwei Gesichtshälften: links hässlich und vernarbt, rechts schön und eben. Jim hat oft versucht, ihr Bild im Kopf zu »mischen«, aber es funktioniert nicht, man kann nur jeweils eine Seite von Isabella betrachten, beide zusammen irritiert sein Gehirn. Selbst wenn die Haare die linke Seite verdecken, liefert ihm sein Gehirn die Narben darunter.
New York
»Na dann, frohe Weihnachten. Ich kann es schon jetzt kaum erwarten, dich in zwei Wochen wiederzusehen«, schmeichelt Mitch seiner »Bonus-Lady«, die seit Jahren wesentlich dazu beiträgt, dass seine Geldmaschine auf Hochtouren läuft.
»Montag, 8. Januar, acht Uhr morgens, mon Général«, hat sich Isabella noch auf der anderen Seite der Welt verabschiedet und sich nach Ende der globalen Gesangsstunde schlafen gelegt. Zwischen den beiden liegt die halbe Welt: Isabella ist in Perth, Australien, »General« Mitch Pieter Lehman in New York City, USA, dreizehn Zeitzonen trennen die beiden Banker.
Mitch Lehman sitzt um halb eins mittags, 24. Dezember, in einer New Yorker Flughafen-Lounge. Er wartet auf das Auftanken seines Flugzeugs und auf seine Schwiegereltern. Das Ziel lautet Hawaii, wo er eine Insel gekauft hat, die er seiner Familie nun als seine neueste Trophäe vorführen will.
Als Lehman vor einer halben Stunde die weihnachtlich dekorierte Lounge der Privatjetkunden betreten hat, hörte er dieses Driving home for Christmas aus den Lautsprechern. Bei diesem Song denkt er stets an Isabella Davis – und das seit über zwanzig Jahren. An einer Weihnachtsparty an der Universität in Austin waren sie zusammengekommen. Beide hatten zu viel getrunken: Isa warf ihre Hemmungen wegen ihrer Narben über Bord, Mitch wollte sich einfach vergnügen. Zu den Klängen von Driving homefor Christmas aus dem Partykeller waren sie unbemerkt in seine Studentenbude im ersten Stock geschlichen.
Mitch war die sportlich herbe schöne Frau schon vorher aufgefallen, die sich immer zur Seite drehte und sich halb zu verstecken schien, sobald man einander ins Gesicht schauen musste. Gesellschaftliche Anlässe in Texas waren fast noch schlimmer als anderswo für Isabella, weil gerade im Lone Star State alles immer besser, schneller, schöner oder größer war als im Rest der USA. Ihre Eltern versuchten alles, ihr das Leben am Stadtrand von Dallas so behütet wie möglich zu gestalten. Aber Isabella wollte nach der Verbrennung nie mehr mit den anderen Mädchen spielen, wie es sich für einen Haushalt mittleren Einkommens in Texas gehörte, Ballett tanzen oder im Chor singen. Sie zog es vor, mit den Jungs draußen rumzutoben. Erst als die Spielkameraden die Mädchen als Frauen zu entdecken begannen, begann Isabellas Leidenszeit. Ihre Unsicherheit wurde schlimmer, je älter sie wurde.
Isabella war es nicht entgangen, dass dieser junge Student aus Kalifornien sie irgendwie anders, unbekümmerter betrachtete als die anderen. Mitch hatte niemandem erzählt, dass er in einem Armenviertel von Los Angeles ohne Vater und bei einer Mutter, die in einer Bar arbeitete, aufgewachsen war. Er hatte alles gesehen, was das Leben für jemanden am untersten Ende der Kaufkraftklasse für jemanden bereithielt: zerschlagene Gesichter, misshandelte Frauen, Drogensüchtige, gewalttätige Männer, Verbrennungen, Schnittwunden, Schüsse und Blut und nicht zuletzt schnellen, miesen Sex in Besenkammern und in Treppenhäusern.
Mitch kapierte schnell, dass man in diesem Viertel nur überleben würde, wenn man sich geschickt aus allem heraushielt. Und er lernte, wen man für sich einspannen und ausnutzen konnte. Er suchte sich gezielt und äußerst raffiniert seine Partner und nahm sich stets das beste Stück vom Kuchen. Dem katholischen Pfarrer Melander gaukelte er den geborenen Messdiener vor und ließ sich von diesem, ohne mit der Wimper zu zucken, das College bezahlen. Für den Gebrauchtwagenhändler schaffte Mitch die besten Unfallwagen ran, auch wenn er manchmal nachhelfen musste. Die einsame Dame aus dem Kirchenchor beglückte er mit seiner Männlichkeit und nahm von ihr das Startgeld für die Uni.
Als es an der Zeit war, ging er nach Texas, um Los Angeles endgültig hinter sich zu lassen.
Mitch Lehman war nicht besonders intelligent, sondern nur gerissen. Er nahm sich, was er brauchte, das hatte er auf der Straße gelernt. Isabella, das hatte er begriffen, war eine sehr gute Studentin, sie würde ihn durch die Prüfungen bringen, wenn er ihr nur genügend den Hof machen würde. Und Charme hatte er. Schließlich musste er neben der Uni arbeiten, um sein Studium zu finanzieren, zum Lernen blieb nicht viel Zeit.
Im Dunkel der vierten Adventsnacht hatten sie sich damals ihrer Leidenschaft hingegeben. Für Isa war es eine Erlösung, dass es einen Mann gab, der nicht am nächsten Morgen erschreckt davonlief, wenn er ihr vernarbtes Gesicht bei unbarmherzigem Tageslicht sah. Von diesem Morgen an erkor sie Mitch Lehman zu ihrem heimlichen Traumprinzen.
Als sie ihn Monate später einmal fragte, warum ihn ihre Narben nicht zu stören schienen, bekam sie die verblüffende Antwort: »Die sehe ich nicht, Isa. Ich sehe durch die Narben hindurch.« Dass er Leid und Abgründe bereits zur Genüge gesehen hatte, damals in Los Angeles, erzählte er auch ihr nicht.
Für Mitch blieb diese erste sexuelle Begegnung mit Isa unvergesslich. Und er dachte immer an die Adventsnacht mit ihr, sobald die ersten Takte von Driving home gespielt wurden, kurz darauf erfolgte ganz automatisch der Griff zum Handy. So auch heute in der New Yorker Flughafen-Lounge.
Charlotte hat bislang Gott sei Dank nichts davon mitbekommen.
Die ausnehmend hübsche Texanerin hatte sich Mitch an der Uni gezielt ausgesucht. Als sich sein Studium dem Ende näherte, war es Zeit für Mitch, wieder auf ein Pferd zu setzen, das ihn seinen Zielen näherbrachte, obwohl sich zwischen ihm und Isabella eine Vertrautheit entwickelt hatte, die er sonst bei niemandem zuließ.
Nach ausführlichen Recherchen über die Generalstochter und ihre gesellschaftliche Mitgift entschied sich Mitch für Charlotte. Wie der Pfarrer, der Autohändler, die ältere Dame und die junge Isabella betrachtete er auch Charlotte nur als einen weiteren Stein, der seinen Erfolgsweg pflastern würde. Nach der »Physikkanone« Isa jetzt »Miss University« Charlotte, die ansonsten kaum durch Leistungen an der Uni auffiel.
Isabella hatte den Tag kommen sehen; ihr war immer klar gewesen, dass ihre gemeinsame Zeit noch im Biotop des Campus enden würde. Niemand würde eine Frau mit solch entstellenden Narben an seiner Seite haben wollen, wenn es darum ging, seinen Platz im richtigen Leben zu erobern. Sie war nicht vorzeigbar, das wusste Isabella, deshalb musste sie mit außergewöhnlichen Erfolgen diesen Makel wettmachen, und zwar dauerhaft. Folglich würde sie sich jemanden suchen müssen, dem nicht gerade die große Auswahl zu Füßen lag. So war Isabella ein paar Jahre später bei Jim Davis gelandet.
Charlotte war nicht der Grund, sondern nur der Auslöser für das Ende ihrer abgeklärten Beziehung mit ein paar emotionalen Splittern. Und ihre Wege trennten sich ohne großen Streit und Tränen, sie wussten beide, wann es an der Zeit war, Adieu zu sagen.
Schnell und ohne emotionales Geplänkel fanden sie wieder zusammen, als Mitch in der Carolina Bank jemanden brauchte, der komplexe Probleme und Strukturen genau durchrechnen konnte. Und das war Isa.
Seit dieser Zeit hängen sie wieder wie die Kletten aneinander, ohne jedoch ihren alten Beziehungsstatus zu erneuern. Sie telefonieren täglich miteinander, wenn der andere auf Reisen ist, und leisten sich sogar ein paar Gefühle rund um die Erinnerungen an die studentische Weihnachtsnacht.
Charlotte wiederum hatte Mitch gewählt, weil dieser Mann den Ehrgeiz in sich hatte, den an dieser Universität kaum jemand schlagen konnte, wie Charlottes Vater erkannte, als ihm Mitch Lehman das erste Mal vorgestellt wurde.
Der General war keineswegs begeistert, aber er wusste auch, dass er seiner Tochter diesen Mann kaum ausreden konnte. Mitch sah in seinem künftigen Schwiegervater General Peters den Mann, der ihm die Türen zum Establishment öffnen würde.
Für den General und seine Gattin schmückte Mitch die Story vom Waisenjungen, dessen Eltern in Israel ums Leben gekommen waren, noch ein bisschen mehr aus als sonst. Seit Mitch sich an der Universität in Texas eingeschrieben hatte, hatte er seine wahre Identität abgelegt und seine Familie verleugnet. Israel war ihm quasi in den Schoß gefallen: Es passte zu seinem Namen, dass auf einer Behörde in der Geburtsurkunde das zweite »n« von Lehmann verloren gegangen war, und er sah keinerlei Veranlassung, diesen Schnitzer zu korrigieren. Die ganzen Jahre beließ er es bei vagen Andeutungen, dass seine Eltern und Verwandten bei einem dramatischen Ereignis ums Leben gekommen wären. Fragte jemand nach, rettete er sich damit, dass er nicht darüber reden könne – zu schmerzhaft und bedeckte die Augen theatralisch mit einer Hand.
Nur dem General erzählte er ein bisschen mehr, dass es ein Unfall, kein Attentat gewesen sei und dass er darüber seinen Glauben verloren hätte. Bei dieser Variante musste Mitch nicht viel recherchieren und konnte sich getrost auf seine Gabe verlassen, Geschichten so zu erzählen, dass man sie ihm jederzeit abkaufte. Mitch kannte keinerlei Skrupel: Auch nicht, als er einer katholischen Hochzeit zustimmte. Für Charlotte tue ich alles, hatte er der diskret vom General vorgetragenen Bitte entsprochen.
Seit Beginn basiert die Beziehung zwischen Mitch Pieter Lehman und seiner Frau Charlotte Amanda Lehman, geborene Peters, auf Berechnung. Selbstverständlich wusste Charlotte schon damals, dass Isabella mit den besten Sex unter den Mädchen an der Uni geboten hatte. Und dass Mitch wohl weiter viel Sex haben würde, den sie kaum alleine befriedigen konnte, war ihr ebenfalls von allem Anfang an klar.
Auch das kannte sie bereits von ihren Eltern – eine Soldatenehe ist schwierig.
Charlotte Lehman strickt sich von Anbeginn ihr eigenes Leben, was bereits seit zwanzig Jahren gut funktioniert. Mitch ist ohnehin nie zu Hause – außer während der Schulferien und an Feiertagen wie Weihnachten. Wie seinerzeit ihr Vater. Zwei Kinder im Teenageralter geben ihr die Liebe, die sie braucht, und Sex kann die nach wie vor gut aussehende Mittvierzigerin, die an gewissen Stellen ein wenig Hilfe von einem Chirurgen nur zu gern akzeptiert, ebenfalls genug haben.
Schwarzer Pagenkopf, mittelgroß und amerikanisch edel gekleidet – federnd kommt Charlotte ihm auf dem Gang zur Lounge entgegen. Mitch mustert seine Angetraute: die teuren Jeans an den schlanken Beinen, die eleganten Tods, ihre weiße Bluse, deren Kragen aus dem Cashmere-Pullover herausragt. Über die Schultern hat Charlotte einen ihrer wattiertem Burberrys gelegt; draußen ist es richtig kalt.
Charlotte hat ihre Eltern untergehakt. Die Kinder Pieter und Isa zotteln gelangweilt hinterher. Lehman hat alle nach New York einfliegen lassen; dass es im Privatjet weiter nach Hawaii gehen würde, wird er als Überraschung nach dem Dessert auftischen.
Als Letzter begrüßt ihn sein Schwiegervater: »Hallo, Mitch. Wie ist die Lage an der Front?«
»Bestens, General.«
»Na dann, alle Mann – oh, und Frauen – an Bord.«
Retired General George A. Peters lacht meckernd; selbst im normalen Anzug mit Krawatte sieht man ihm sofort den Soldaten an – nur die Rangabzeichen fehlen auf dem dunklen Stoff. Als hoch dekorierter Offizier und Vietnamveteran ist der hagere Mann mit den kurz geschorenen Haaren und den stets blank gewienerten schwarzen Schuhen Mitchs Feindbild par excellence, was dieser sich jedoch nie anmerken lassen würde. Seit der Armeearzt vor über fünfundzwanzig Jahren Mitch als untauglich eingestuft hatte und er seine Westpoint-Ambitionen wegen seiner Rückenprobleme aufgeben musste, trauert er einer Militärkarriere nach. Sein ganzes Gehabe – der schneidige Befehlston und sein Verlangen nach bedingungslosem Gehorsam, blinder Loyalität und Disziplin – haben in dieser Niederlage ihren Ursprung. Mitch Lehman ist Chef des gesamten Kapitalmarktbereichs der Carolina Bank und hat sich im Unternehmen eine eigene Armee nachgebaut. Seine Kapitalmarktsöldner auf dem Trading Floor behandelt er wie Soldaten, die von seinen Obristen geführt werden.
Der von vielen bewunderte Mitch Lehman ist aber vor allem eines: ein Trader, der am liebsten handelt. Das Geld im Opferstock hatte er sich schon als Jugendlicher zwischendurch »ausgeliehen«, um Autos auf- und teurer weiterzuverkaufen. Zweifelsohne wäre Lehman mit seinem Ehrgeiz auch General geworden, doch wenn man beobachtete, wie er mit seinen Obristen umging, konnte man sich an schlechte Schleifer auf den Exerzierplätzen erinnert fühlen. Lehman hatte sicher genügend Ausdauer, Energie und skrupellose Beharrlichkeit für eine Militärkarriere, aber zur wahren Führungspersönlichkeit fehlte ihm schlichtweg die Statur. Und das lässt ihn der echte General in der Familie immer wieder spüren.
Nachdem die Großfamilie im Flugzeug die Plätze eingenommen hat, übernimmt Schwiegervater Peters das Kommando.
»Wann gibt es denn etwas zu trinken und zu essen, Mitch?«
»Sobald wir in der Luft sind, General«, lautet die spitze Antwort; Mitch ist es nicht gewohnt, von anderen herumkommandiert zu werden.
»Und wie laufen die Geschäfte?« Peters zeigt sich stets interessiert am Erfolg seines Schwiegersohns; er saß nach seiner Pensionierung ein paar Jahre im Board der Investmentbank, bei der er Mitch den ersten Job nach dem Universitätsabschluss verschafft hatte. Die beiden stehen an der Bar, die in der Mitte des Jets eingebaut worden ist. Sie trennt den Ess- und Sitzbereich von den Schlaf- und Toilettenräumen. Wenn man es nicht wüsste, glaubte man sich in der modern gehaltenen Bar in einem schicken Loft. Nur die festen Halterungen für die Flaschen und die für Flugzeuge typischen Fenster erinnern daran, dass die beiden Herren zehntausend Meter über der Erde ihren Bourbon schlürfen.
»Alles bestens, George. Wir machen Geld wie Heu, die Märkte laufen wie von selbst. Mein Handelsbereich wird für Carolina alleine fünf Milliarden Dollar Gewinn einfahren. Nach Bonus. Einunddreißig Prozent Rendite aufs Eigenkapital, General. Zufrieden?«
»Sicher.« Der General zögert einen Moment. »Aber wo kommt das alles her, Mitch? So viel hat man doch früher nicht verdient.«
»Ganz einfach: Wir machen Geld mit Geld. Und Geld war viele Jahre billig zu haben, Greenspan sei Dank. Wir unterlegen schon lange nicht mehr nur die Industrie mit Kapital. Das wirft viel zu wenig ab, es muss viel zu viel mit eigenem Kapital unterlegt werden und bringt zu viel Ärger, wenn da mal wieder einer pleitegeht. Nein, George, wir machen das untereinander. Das bringt es wirklich.«
»Und das funktioniert?«, fragt der General skeptisch und nimmt einen ordentlichen Schluck von seinem Whiskey.
Mitch hasst ihn alleine für die Frage. Woher nahm der Alte das Recht, ihn zu kritisieren?
»Du brauchst nur gute Finanzingenieure, die die Modelle basteln.«
»Mitch, ich bin zwar schon ein paar Jahre nicht mehr im Board, aber ich weiß nicht …«
»Du brauchst nur die richtigen Fachleute, George, die die Modelle im Griff haben. Wir haben die besten von allen. Eine wahre Geldmaschine.«
»Kriege gewinnt man auch nicht im Kartenraum, Mitch.«
»Keine Sorge, George. Wir haben uns gegen alles abgesichert. Wir können die Realität wirklich abbilden. Es gibt keine Lage, die wir nicht modellieren könnten. Es ist ganz einfach so: Wir können nicht verlieren.« Direkt in die Augen sehen kann er seinem Schwiegervater fast nie, auch jetzt redet Mitch quasi an Peters linkem Ohr vorbei.
»Als Kommandierender musst du aber alles selbst unter Kontrolle haben, nicht nur deine Finanzingenieure. Weißt du eigentlich, was genau die da abziehen?«
Der General mustert seinen Schwiegersohn, den er eigentlich nur wegen des Geldes für voll nimmt. Sicher ist Mitch alert und fit – bei seinem Konsum an Alkohol und gutem Essen muss er täglich auf die Foltergeräte –, er verfügt sogar über einen Fitnessraum in der Bank. Aber für sein Gewicht von neunzig Kilo ist er mit 1,80 Meter einfach nicht groß genug, um als schlank und wirklich durchtrainiert zu gelten.
Über Mitchs Hose spannt sich der Gürtel. Das sieht jeder, weil man dauernd auf sein unübersehbares rotes Monogramm »MPL« auf dem Hemd starren muss. Er wählt jeweils Hemden in der Farbe passend zu diesen albernen Gummistöpseln, die er seit jeher als Manschettenknöpfe trägt.
Bei dem kann man so viel nach Maß schneidern, wie man will, denkt Peters, während er auf Mitchs Antwort wartet, er sieht immer ein bisschen unpassend aus. Vom Gelschopf bis zu den Schuhen, selbst die Breitling Daytona passt nicht ganz zu ihm, und erst die polierten Fingernägel; Peters verzieht das Gesicht. Auch die Haare sind nicht nach des Generals Gusto; für ihn gilt nur der kurze Messerschnitt als korrekt und nicht der gegelte, nach hinten gekämmte rotblonde Schopf mit der freien Stirn.
Wenn er Mitch ärgern wollte, nannte der General seinen Schwiegersohn »Dandy« und schickte ein verächtliches Grinsen hinterher, wofür ihn Mitch töten könnte. Stattdessen begnügte er sich mit einem vielsagenden Blick aus seinen stechend blauen Augen, der selbst den wahren General verunsichern konnte, wenn sich die Blicke der beiden doch einmal trafen.
»Das tue ich.« Mitch schenkt dem musternden General ein strahlendes Lächeln. »Seit über zehn Jahren arbeite ich mit denselben Leuten. Die wissen, was sie tun.«
Natürlich ahnt General George A. Peters nicht, dass Mitch von seiner Kapitalmarktsöldnertruppe rund um den Globus ehrfürchtig »General« genannt wird. Mitch hat sich mit seinem Handelssaal in London sein eigenes West Point gebaut: ein General, mehrere Obristen, zahlreiche Leutnants und schließlich das Fußvolk in den riesigen Handelssälen. Hinzu kommen eine Handvoll Spezialisten, seine »Fachoffiziere«, allen voran Isabella Davis, wenn es um die Einschätzung und Bewertung der Risiken geht. Mein bester Mann, denkt Mitch stets, wenn er Isabella als einzige Frau in der Runde der Obristen sieht. Mitch gilt bei seiner Truppe als diszipliniert und hart gegen sich selbst und andere; er regiert mit eiserner Faust, riskiert alles und hat bisher stets gewonnen. Deshalb glaubt er auch, sich auf seinen Stab verlassen zu können. Denn alle wollen teilhaben am großen Spiel. Und wer hintergeht schon den besten Spieler von allen?
»Und fünfzig Millionen Dollar bekomme ich auch noch dafür!« Mitch nippt mit unverhohlener Selbstzufriedenheit an seinem Drink.
Der General pfeift durch die Zähne: »Das ist ein sehr überzeugendes Argument.«
Sie stoßen an – auf die fünfzig Millionen, auf die Bank, auf die Familie und auf Weihnachten.
»Schau dich ruhig mal ein wenig um.« Mitch spielt einen seiner Trümpfe aus, er weiß, wie neidisch sein Schwiegervater den ganzen Luxus betrachtet.
Die Boeing 737 gehört Mitch zwar nicht, aber er nimmt sie für diverse Anlässe in Anspruch, meist geschäftlicher Natur. Zwei Schlafzimmer mit Wasser gelagerten Betten, eine bezogen mit einem zarten Büffelleder, ein beiges Interieur, mit Chrom abgesetzt, auch an den Fenstern. Die Kinder sind vor allem vom Heimkino mit der dreimal zwei Meter großen Leinwand begeistert.
Im vorderen Bereich gibt es Besprechungsräume, in denen auf diesem Flug das erste Festessen an Weihnachten eingedeckt ist. Kristall, Damast, Wedgewood-Geschirr, selbst echte Kerzen fehlen nicht und verbreiten eine festliche Stimmung. Nicht, dass Mitch Wert darauf legte, aber das konnte man alles bestellen – Jet mit Weihnachten komplett. Sogar ein kleiner geschmückter Baum steht neben dem Tisch.
Seine beiden Edelprostituierten Camilla und Diana hatte er auch in diesem Flieger schon oft dabei gehabt, denkt er leicht wehmütig beim Betrachten des großen Besprechungstischs. Zum letzten Mal sah er sie an der Weihnachtsfeier … War 'ne schöne Feier, erinnert sich Lehman, auch wenn ihn die Sache mit den blauen Bändchen am Ende ein paar Nerven gekostet hatte. Die Jungs haben es ihm auf alle Fälle gedankt. Ein Geschenk, das man sich selbst nicht kauft. Und Pearson hatte die Sache mit der Maus vom »CityView« schließlich doch gelöst.
Lehman reicht einen weiteren Whiskey an seinen Schwiegervater, während die Damen edlen Champagner genießen und den herrlich eingedeckten Tisch loben.
»Willkommen zum ersten globalen Dinner am Heiligen Abend 2006«, ruft Mitch und bittet zu Tisch. Sie speisen Hummer und Jacobsmuscheln als ersten Gang, dazu ein Sancerre, danach gibt es Bisonsteaks mit Pommes Duchesse und einen exzellenten Bordeaux. Die Stimmung ist locker, mit zunehmendem Weinkonsum sogar ausgelassen. Charlotte und ihre Eltern plaudern angeregt, selbst die Kinder maulen nicht, als Mitch ihre elektronischen Spielzeuge vom Tisch verbannt. Lediglich Mitch bleibt angespannt. Ununterbrochen wippt er mit dem Fuß, oft klackert er mit den langen Fingernägeln auf den Tisch.
Als die Stewardess den Tisch abgeräumt hat, steht Mitch auf, lässt die Leinwand herabfahren, die oben in der Decke des Besprechungsraums eingelassen ist. Ohne weitere Ankündigung verdunkelt sich der Raum und auf der Leinwand erscheint eine Insel. Auf einer Klippe thront ein blendend weißes Haus wie ein Leuchtturm inmitten eines Ensembles kleinerer Häuser. Die Kamera zeigt zudem einen riesigen, menschenleeren Strand, einen kleinen Hafen und eine Landebahn. In die letzten Sekunden des Films stellt sich Mitch in die Projektion, bis es hell im Raum wird. Während die Familie sich noch an das Licht gewöhnen muss, verkündet Mitch: »Unser Ziel. Meine Insel, direkt vor Hawaii. Und spätestens in einem Jahr sieht alles so aus, wie ihr es gerade gesehen habt.«
Während die Kinder begeistert jubeln und Charlotte als Einzige das »meine neue Insel« registriert hat, erhebt General Peters sein Glas. »Anerkennung, Mitch.« Für seinen Schwiegervater ist dies das äußerst mögliche Zeichen positiver Wahrnehmung.
Nach dem Essen begeben sich alle zur Ruhe, für die Londoner ist es inzwischen Nacht und für die Eltern Zeit für den gewohnten Mittagsschlaf. So bekommt Mitch endlich die Chance, sich mit seiner Stewardess zu befassen. Zwei Wochen nur mit Charlotte – nichts für ihn. Also hat ihm Diana etwas für die Ferien besorgt.
Die beiden ziehen sich in eine kleine Kammer direkt hinter dem Cockpit zurück, die früher als Navigationsraum diente … Solche Quickies lernten die Trader schon in jungen Jahren in New York. Dort gab es direkt neben den Investmentbanken verschwiegene Etablissements mit kleinen Räumen so schmal wie Besenkammern, in denen die Damen warteten – fünfzig Dollar für fünf Minuten. Seit dem Aufkommen von Aids, konnten die Jungs der Investmentbanken sogar Kondome mit dem Logo ihres Arbeitgebers benutzen.
Danach wirft auch Mitch sich auf einen Ledersessel, fährt die Lehne zurück und die Fußstütze aus. Ein letzter Schluck Bourbon, dann drückt er den Knopf. Es wird dunkel. Mitch zuckt noch einen Moment mit dem Bein, dann fällt auch er in einen tiefen Schlaf. Seit dem Start in London um zehn Uhr morgens und dem zwischenzeitlichen Stopp in New York sind ganze vierzehn Stunden vergangen. Noch haben die Lehmans ein paar Stunden Reise vor sich: Driving home for Christmas.
Und in London schlägt Big Ben gerade wieder Mitternacht in der Heiligen Nacht.
»Schätzchen, ich habe auch einen Schuss frei. Vom großen Mitch geschenkt bekommen! Wie wärs?«, flüstert der junge Typ Carla Bell ins Ohr, der plötzlich aus dem Nichts auf sie zukommt. Dabei hat sie sich extra etwas abseits in der Nähe der Aufzüge gestellt, um mit einem Glas Champagner in der Hand erst einmal das bunte Treiben auf der Weihnachtsfeier der Carolina Bank zu beobachten. Der Great Ball Room im ehrwürdigen »Grosvernor House« füllt sich schnell mit gut gelaunten Menschen, doch die Journalistin mag es nicht, alleine inmitten der Menge zu stehen.
»Wie bitte?! Fuck you«, stößt sie laut hervor, ist aber so perplex, dass sie dem gut aussehenden Bürschchen, sicher ein junger Associate Director der Bank, keine scheuert, sondern ihn entgeistert mit offenem Mund anstarrt.
»Ich wusste gar nicht, dass ihr Escorts so zickig seid. Mitch zahlt doch gut, oder?«, klagt der bereits leicht Angetrunkene mit loser Krawatte und zerzaustem Haar. Er zeigt auf ihr blaues Bändchen und klingt konsterniert, bleibt jedoch weiterhin fordernd vor ihr stehen.
Was geht hier bloß ab? Bei Carla Bell beginnen die Alarmglocken laut zu klingeln.
»Ich weiß nicht, wer du bist und was du meinst. Ich bin jedenfalls Reporterin des ›CityView‹ und hier zur Weihnachtsfeier eingeladen.« Carla Bell versucht seitlich auszuweichen, wobei sie etwas Champagner auf ihr schwarzes Kleid verschüttet.
Die Verwirrung steht dem jungen Mann deutlich ins Gesicht geschrieben: »Entschuldigung, das ist ein Missverständnis. Sorry, sorry. Ich habe wohl schon zu viel getrunken.« Entschuldigend hebt er beide Arme, dreht sich auf demAbsatz um und ruft ihr noch nach: »Nehmen Sie besser das blaue Bändchen ab.«
Was soll das, fragt sich Carla irritiert und starrt auf das Bändchen am rechten Handgelenk, das sie noch von der Party des Vorabends trägt. Aus blauen Plastikfäden gewirkt und aufgedreht, ähnelt das blaue zentimeterdicke Armband Modeschmuck, der gestern an der Einlasskontrolle als Erkennungszeichen ausgegeben wurde und ihr so gut gefallen hat …
Instinktiv zieht sie sich einen Meter zurück und steht nun im Halbdunkel hinter zwei Zierbäumchen. Dort bringt sie sich erst einmal wieder unter Kontrolle, atmet tief durch, trinkt ihren Rest Champagner in einem Zug aus.
Irgendetwas stimmt hier nicht. Carla Bell beginnt, die Menschen hier genauer in Augenschein zu nehmen. Die Männer sehen alle gleich aus: Anzüge, in der Regel dunkle Farben, Hemden mit Manschetten, Krawatten, die einige schon gelockert haben. Alle halten ein Glas in der Hand, die ausladenden Gänge und Säle sind erfüllt von lautem Lachen; unter den selbstbewusst auftretenden Bankern herrscht eine ausgelassene Stimmung. Wie Pfauen stolzieren einige umher, manche zeigen ihre Frauen wie Trophäen herum, wenn sie nicht gerade nur als Männergruppe zusammenstehen, wie Carla Bell aus ihrer Ecke heraus registriert.
Bei den Frauen verhält es sich anders: Da schwirren zunächst einmal sehr viele junge Frauen herum, die eigentlich kaum voneinander zu unterscheiden sind – die Partyuniform der Londoner City schreibt für Sekretärinnen und Assistentinnen das kleine Schwarze mit High Heels für den Abend vor. Dieses Outfit gilt nicht für die hier an einer Hand abzuzählenden Bankerinnen, die sich in ihren strengen Businesskostümen klar von den unteren Chargen absetzen. Solche Frauen gibt es unter den Investmentbankern jedoch nur wenige in der City; noch immer ist Investmentbanking überwiegend Männersache. Die dritte Gruppe besteht aus den Ehefrauen der Banker, die zu solchen Anlässen stets aufgetakelt antreten, weil sie endlich mal wieder aus ihren Vorstadthäusern heraus dürfen.
Die wenigen Bankerinnen sind teuer, aber eher praktisch in Windsor oder Akris gekleidet, zumal sie meist direkt aus dem Büro kommen. Die Ehefrauen stehen sich in Chanel, Hermes oder ändern Couturies die Beine in den Bauch und reden über Schule oder Golf. Das hat Carla Bell bereits auf anderen Weihnachtspartys mitbekommen und sich dann eher mit den Bankern unterhalten, bis diese so angetrunken waren, dass jede weitere Unterhaltung zwecklos wurde. Warum sollte sie sich mit vierzigjährigen Frauen über Schule oder Golf unterhalten? Sie hat weder Kinder, noch spielt sie das Spiel der alten Männer.
Dass sie allerdings so aussieht wie die jungen Frauen, die sich ansonsten um Reisekosten, Buchungen oder Schreibarbeiten kümmern, ist ihr bislang gar nicht aufgefallen. Carla Bell, selbst gerade erst fünfundzwanzig Jahre alt, hat ebenso ein kleines Schwarzes an, trägt Schuhe mit hohen Absätzen, so wie die meisten Mädchen hier, alle in den Zwanzigern, die rund um Liverpool Street Station in der alten City oder Canary Wharf draußen in den Docklands für die Banker arbeiten. Sie haben wenige Gelegenheiten, einmal in die teuren Hotels zu kommen, in die sie sonst ihre Chefs einbuchen müssen. Die Weihnachtsfeier der Carolina Bank ist einer dieser seltenen Anlässe, an dem alle drei Frauentypen Zusammentreffen. Da sie sich jedoch fest an ihre Gruppe halten, besteht eigentlich keine Gefahr der Durchmischung.
Die Party ist big– so wie alles in diesem Jahr. Der Saal ist inzwischen richtig voll, eine Band spielt weihnachtlichen Jazz. In jeder Ecke befindet sich eine Bar, in der Mitte des Festsaals hat man ein riesiges Buffet aufgebaut, auf dem keine Spezialität fehlt. In kleineren anliegenden Sälen werden wahlweise Karaoke oder andere Spiele für große Kinder geboten. Weihnachtlich sehen eigentlich nur der riesige, bunt geschmückte Baum in der Nähe der Bühne aus und die Kellner mit ihren roten Mützen.
Mitch Pieter Lehman und seine Kollegen haben allen Grund zu feiern, 2006 ist ein Bombenjahr gewesen: Die Kurse explodierten, die Deals flogen so einfach wie nie, die Händler waren dabei, ein immer größer werdendes Rad zu drehen. Selten war es so einfach gewesen, Geld zu verdienen. Den Banken wurde alles abgekauft, ihre Handelsabteilungen kreierten die wildesten Wertpapiere und hatten sich von der eigentlichen Dienstleistung für die »normale« Wirtschaft längst völlig losgelöst. Angst vor einer neuen Blase hatte hier keiner. Das erste Buch Moses, dass es nach sieben fetten wieder sieben magere Jahre geben würde, gehört nicht zur bevorzugten Lektüre dieser Kaste. Jeder dachte nur an seinen Bonus.
Der Gastgeber, Mitch Lehman, würde für das Jahr einen Bonuspool bekommen, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellte. Und keiner würde ihm reinreden, wie viel er an wen seiner Leute verteilte. Dank den Gewinnen, die er eingefahren hat, ist Mitch Lehman unantastbar. Eine stolze Zahl seiner Jungs würde wieder Millionen Dollar, Euro oder Pfund bekommen. Boni sind der Treibstoff, mit dem der Motor der gierigen Geldmaschinen betrieben wird.
Carla Bell hatte bereits einige Kommentare über erste Schätzungen der Boni geschrieben: Milliarden von Dollar würden wieder unter eine kleine Anzahl von ein paar Tausend Leuten gebracht, und mehr als hundert Topbanker würden wieder zweistellige Millionenbeträge kassieren.
Und so ist auch die Party, denkt Carla, immer mehr und immer schneller. Als Journalistin eines wichtigen Finanz-Newsletters wird sie zwar stark umworben, doch sie weiß genau, dass sie nicht dazugehört. Banker sind ihr seit Kindesbeinen verhasst. Dass ein Banker ihre Mutter vor fünfzehn Jahren in den Tod getrieben haben sollte, hat sich wie Gift in ihr festgesetzt. Und nun schreibt sie ausgerechnet über Banker und deren Welt, was zu ihrer eigenen Überraschung großes Interesse in ihr auslöst. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ihr Vater ihre Fragen nach den wahren Umständen des Todes ihrer Mutter vehement abgewehrt hat – das Thema ist tabu und doch stets präsent, geht es Carla durch den Kopf. Mit der Zeit hat sie gelernt, ihren Kummer zu unterdrücken, doch in Momenten wie diesen, wenn die ganze Welt verrückt zu spielen scheint und sie die kitschig-romantischen Weihnachtsinszenierungen zu ersticken drohen, holt sie der Schmerz mit voller Wucht wieder ein.
Finanzjournalismus war ursprünglich nicht ihr Ziel gewesen, sie war da eher zufällig reingerutscht. Carla Bell hatte zwar für die Universitätszeitung geschrieben, wollte aber Lehrerin für Mathematik und Physik werden. Als sie Simon Trent, Gründer und kreativer Kopf des »CityView«, anlässlich eines Vortrags an der Uni kennen lernte und ihr nach einer heftigen Diskussion über Ethik und Finanzen, Geld und Geist spontan mit den Worten »dann zeigen Sie doch mal, was Sie drauf haben« den Job als Reporterin angeboten hatte, hatte sie schon eine Anstellung in der Tasche, noch ehe sie ihr Studium zu Ende gebracht hatte.
Bereits nach einem halben Jahr bot ihr Simon Trent die überraschend frei gewordene Stelle im Bankenressort an, und Carla Bell griff beherzt zu. Ihr Ehrgeiz war geweckt, und sie wollte wissen, wie Banken, Banker und deren System funktionieren. Noch hatte sie in diesem ersten Jahr als Reporterin beim »CityView« – einem der renommiertesten Newsletter in der Londoner City – wenig Anlass gehabt, ihre schlechte Meinung zu überdenken.
Die Feier der Carolina Bank zählt seit jeher zu den absoluten Highlights des Partykalenders am Ende des Jahres in der City. Der Champagner fließt in Strömen und es werden edelste Fischeier kiloweise aufgetischt. Im Prinzip gehört das Hotel an diesem Abend der Bank, eine große Anzahl der Gäste übernachtet gleich dort. »Grosvernor House« ist eines der älteren Nobelhotels mitten in Mayfair, nahe zu Museen und den Theatern des West Ends gelegen.
Mitch Lehman hat sich für eine Stehparty entschieden. So können sich die Leute besser verteilen und unterhalten – und es fällt auch nicht auf, wenn er zwischendurch verschwindet, weil er es nie lange an einem Platz aushält. Auch an Partys bevorzugt er eine schnelle Gangart, wechselt von Gruppe zu Gruppe, gibt hier eine Anekdote zum Besten, klopft dort den jungen Nachwuchsstars anerkennend auf die Schulter, präsentiert sich als strahlenden Sieger, dem – einmal mehr – alles gelingt. Tische gibt es nur im kleineren Ball Room und in anderen Nebenräumen, und natürlich sind auch die Red Bar und einige Suiten drum herum für die Caroliner reserviert.
Als Carla Bell sich wieder gefangen hat, hält sie Ausschau nach dem Associate, der sie so geschmacklos angemacht hat. Er tummelt sich bereits wieder in dieser Ecke des Great Rooms. Und hier sammeln sich, wenn man genau beobachtet, in der Nähe der Aufzüge ein paar auffallend junge Frauen im kleinen Schwarzen, die alle blaue Bändchen am rechten Handgelenk tragen. Kaum zu bemerken, aber für jeden sichtbar, der es wissen sollte. Wenn man es weiß, geht ihr durch den Kopf, dann ist es ein unmissverständliches Erkennungszeichen.
Carla Bell sieht an sich herab. Den Carolina-Gästen wurde am Eingang ein kleiner roter Button von einer netten Dame ans Revers geheftet – ein hübscher Kontrastpunkt zum kleinen Schwarzen. Roter Button, schwarzes Kleid, blaues Bändchen. Zwei Farbtupfer. Sieht eigentlich klasse aus. Sicher ist sie nicht ganz so aufreizend geschminkt und ihr Kleid ist nicht ganz so knapp, aber mit dem blauen Bändchen kann jeder Eingeweihte sie für eines der bewussten Mädchen halten.
Sogleich will sie das Ding abreißen und wegschmeißen, um keinesfalls noch einmal verwechselt zu werden, doch dann stoppt sie inmitten der Bewegung, ihre Neugier ist angestachelt. Sie beschließt, das blaue Bändchen am Handgelenk zu belassen, auch wenn sie es nun mit der anderen Hand versteckt.
Als ein Kellner recht nahe an ihrem Versteck vorbeikommt, springt sie leicht vor, stellt ihr leeres Champagnerglas ab und nimmt dem erschrockenen älteren Herrn mit der völlig unpassenden roten Mütze einen Martini mit Olive vom Tablett. Mit einem Lächeln und einem Danke hüpft sie wieder einen Schritt zurück.
Sie streicht sich ihr langes rotblondes Haar nach hinten über die Schultern und kaut die Olive sehr langsam. Der Geschmack vermischt sich angenehm im Mund mit dem Martini. Leise schlürfend, beobachtet sie die Szenerie: Sie zählt nie mehr als eine Handvoll von den »Blaubändern«. Alle haben eine klasse Figur, besser als ihre, taxiert sie neidisch, obwohl sie sich keineswegs verstecken muss. Ab und zu verschwindet eine der Frauen mit einem oder manchmal auch mehreren der jungen Burschen aus Mitch Lehmans Truppe. »Ping« macht es jedes Mal, wenn sich eine der alten schweren Aufzugstüren öffnet. Ihr »persönlicher« Associate scheint inzwischen auch Erfolg zu haben, denn er macht sich mit einem breiten Lächeln und einer jungen Dame mit blauem Bändchen auf den Weg nach oben.
Manche Gesichter unter den Bankern kommen Carla Bell bekannt vor, sie hat sie in den letzten Monaten bei diversen Unternehmenspräsentationen, an Capital Market Days und an einer zweitägigen Konferenz über Investment Opportunities in Europa getroffen, die die Carolina Bank im Sommer in Spanien veranstaltet hatte.
Damals hatte sie gerade ihren neuen Job im Bankingteam des »CityView« angetreten und war auf Einladung der Carolina Bank auf ihre erste größere Dienstreise nach Spanien gegangen. Der Trip hatte sie sehr beeindruckt, zumal der finanziell immer schwachbrüstige »CityView« diese Reise bezahlte. Auch wenn sie Distanz hielt, das teure Hotel, das gute Essen und das ganze edle Drumherum verfehlten ihre Wirkung nicht. Wer wie sie vom Dorf kommt, den beeindruckte ein Fünf-Sterne-Hotel mit all seinen Annehmlichkeiten. Die Wellnessoase hatte es ihr besonders angetan, mit schlechtem Gewissen verbrachte sie einige Zeit ihrer Dienstreise bei Hot-Stone-Massagen oder im Jaccuzzi.
Ihre Einladung nach Spanien wie auch heute Abend zur Carolina-Party verdankt sie Robert Pearson, dem PR-Guru der City, der vor allem für Mitch Lehman arbeitet. Der Berater hatte Carla in den letzten Monaten als neues Talent am Journalistenhimmel entdeckt, wie er ihr schmeichelte. Mitch hatte ihm die junge Reporterin empfohlen, weil sie noch so leicht formbar sei. Lehman konnte zwar jeden Kurs bewegen, wenn es sein musste, aber leider nicht jede Zeitungsspalte füllen. Für ihn waren Journalisten Schmierfinken, die es eben zu schmieren galt. Mit Charme oder auch anders.
Carla Bell pfeift leise durch die Zähne, als sich mit einem »Ping« die Aufzugstüre erneut öffnet. Denn genau dieser Robert Pearson entsteigt dem Lift mit einer Rothaarigen, die, als sich die Türe öffnet, offensichtlich noch eine schnelle Streicheleinheit verteilt. Nutten! Auf die Idee muss erst einmal jemand kommen, geht es Carla Bell durch den Kopf: Nutten auf der Weihnachtsfeier.
Fehlt nur noch die absolut hieb- und stichfeste Gewissheit. Ihr leeres Martini-Glas steckt sie in den Topf des Zierbäumchens und entscheidet sich, nicht Robert zu folgen, sondern seiner rothaarigen großen Begleiterin, von der er sich gerade mit einem Klaps auf den Po verabschiedet. Ihre »Kollegin« geht offensichtlich zur Damentoilette, die in einem kleinen Nebengang des Great Ball Room liegt.
Niemand außer den beiden scheint an diesem stillen Örtchen zu sein, denn alle Türen stehen offen. Carla starrt der Rothaarigen hinterher, die in der letzten Toilettenkabine hinten an der Wand verschwindet. Sie nimmt die Toilette daneben und verhält sich ruhig. Zwei Minuten, drei Minuten, dann rauscht die Spülung. Viermal klackern die Absätze, dann hört sie das Zippen des Seifenspenders. Die Rothaarige muss nun am Waschbecken stehen, schätzt Carla. Viel Zeit bleibt ihr nicht; sie atmet einmal tief durch, betätigt ebenfalls die Spülung, öffnet die Tür und geht auf das nächste Waschbecken zu. Zum Glück ist niemand zum »Nasepudern« in den eleganten Toiletteraum gekommen. Der Waschraum ist sogar mit zwei Sesseln dekoriert, in denen es sich die Damen für Small Talk bequem machen konnten. Aber Carla Bell ist alles andere als zum Plaudern zumute.
Die Rothaarige sieht gar nicht »nuttig« aus, sie ist ziemlich hübsch, das hat Carla schon bei der Verfolgung gemerkt. Ihre Nachbarin ist gerade tief über das Becken gebeugt und lässt Wasser in die wohlgeformten Hände laufen, um sich die Stirn zu benetzen. Wenn sie ihre Schminke neu auflegen und in den Spiegel schauen würde, ist die Chance verpasst.
Carla nimmt das Becken links von ihr, sodass die junge Frau direkt auf ihr blaues Bändchen am rechten Handgelenk gucken kann. Auch Carla beugt sich vor, das Wasser läuft, ihr Haar fällt herunter und verdeckt ihr Gesicht.
»Und«, fragt Carla mit nervöser Stimme, »wie läuft es so?«
Die junge Frau blickt leicht nach links, sieht Carlas blaues Erkennungszeichen und seufzt, ohne wirklich aufzuschauen: »Oh Gott! Mitch hat wohl seine jungen Hengste von der Weide geholt, ich hatte schon vier … Ich brauch 'ne Pause. Und du?«
»Der Nächste wartet schon. Ich muss mich beeilen. See you later«, greift Carla einmal schnell ins Handtuch und flüchtet aus der Toilette.
»Hoppla.« Der Kellner kann sich nur mit einem eleganten Sidestep vor einem Zusammenstoß retten, als Carla aus der Toilette schießt. Sie nimmt ein Glas vom Tablett und gießt den Martini direkt in sich hinein. Der ältere Mann im weißen Livree und roter Weihnachtsmütze kommt gerade aus dem Servicebereich, der auf der anderen Seite des Nebengangs liegt. Nun steht bereits ein leeres Glas auf seinem Tablett, ehe er den großen Saal von »Grosvernor« House erreicht hat.
»Danke, das war bitter nötig«, stöhnt Carla und stibitzt sich im Gehen noch ein Glas.
»Bitte, Lady, aber immer schön langsam. Sie wissen, wie so etwas hier sonst endet«, ermahnt der Kellner sie; die rote Mütze ist ihm sichtlich unangenehm. »Gegen Mitternacht sind die meisten sturzbetrunken. Passen Sie also auf sich auf.«
»Danke. Ich weiß.« Carla rekapituliert kurz, dass dies der dritte oder vierte Martini sein muss. Und zuvor hat sie noch ein Glas Champagner getrunken.
»Sagen Sie, sorry, ich, ich …«, hält Carla den Mann am Unterarm zurück.
»Ja bitte. Kann ich etwas für Sie tun?«
»Ja«, sagt Carla und zieht ihn nahe zu sich heran. »Sagen Sie, sehe ich aus wie eine Nutte?«
»Wie bitte?« Der Kellner rückt etwas von ihr ab und nimmt Carla kritisch in Augenschein.
»Wissen Sie, junge Frau, ich arbeite schon lange hier, aber das hat mich noch keine gefragt.«
»Ich will es aber wissen«, bittet Carla und schaut dem Kellner direkt in die Augen.
»Nein.« Er atmet heftig aus.
»Nein?« Carlas Stimme schwankt zwischen Zweifel und Erleichterung.
»Nutten haben kalte Augen, Ihre sind lebhaft und warm.« Dabei steht er stocksteif wie ein Butler vor ihr, mit dem Tablett in der rechten Hand und blickt in ihre rehbraunen Augen.
»Danke Ihnen und schöne Weihnachten.«
»Ihnen auch. Und wie gesagt: Passen Sie auf sich auf.«
Carla Bell schlängelt sich auf die Suche nach Robert Pearson an einigen recht betrunkenen Typen, Männern wie Frauen, vorbei. Pearson steht in der Ecke der Aufzüge und unterhält sich offensichtlich blendend mit einigen Gästen. Lehmans PR-Berater ist ein langer Schlacks, der vorwiegend aus Beinen und Armen zu bestehen scheint, er würde immer noch als Universitätsassistent durchgehen, obwohl er mindestens fünfzig Jahre zählt. Pearson gilt als lebende Legende unter den Public-Relations-Beratern in der City: Er kann Storys schieben, drehen oder auch töten. Der Oxfordabsolvent belegt unangefochten Platz eins unter den Spin Doctors der City, wobei ihm gerade sein jugendlicher Charme viele Türen öffnet.
Gerade als Carla Bell sich zum dritten Mal fragt, hingehen oder warten, Konfrontation oder Schmusekurs, gesellt sich der Gastgeber zur Gruppe um Pearson. Mitch Lehmans Auftritt im Kreise einiger Jungbanker, die ihm bewundernd lauschen, nimmt ihr die Entscheidung ab; Glück für Pearson, zumindest für den Augenblick.
Als sie sich abwenden will, bemerkt Robert seine neue Entdeckung am Journalistenhimmel und eilt mit ausgebreiteten Armen auf sie zu.
»Carla, schön Sie zu sehen. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Darf ich Ihnen Mitch Lehman vorstellen, unseren Gastgeber heute Abend?«
Ohne ihr Widerstreben zu beachten, greift Pearsons feuchte Rechte nach Carla Bell und zieht sie hinter sich her zu seinem Boss. Er schiebt sie regelrecht neben Mitch, der sich ihr freudig zudreht. Schönen Frauen schenkt Mitch Lehman mit größtem Vergnügen sein Augenmerk.
»Lehman, Mitch Lehman«, er reicht ihr die Hand.
»Carla Bell vom ›CityView‹«, antwortet sie und lässt sich Zeit für eine Kopf-bis-Fuß-Musterung des nur unwesentlich größeren Starbankers. Ein paar Kilo zu viel auf den Hüften, taxiert Carla. Lehman wollte sie immer schon einmal persönlich kennen lernen, den Mann, der »über Wasser laufen konnte«, wie es in einem Porträt bei der Konkurrenz über ihn geheißen hatte, das sinnigerweise auch mit »Walking over water« überschrieben war.
Für den Moment ist die Nuttengeschichte auf Eis gelegt. Robert Pearson könnte sie sich jederzeit vorknöpfen, an Mitch Lehman kommt sie wohl so schnell nicht wieder derart greifbar nah heran.
»Freut mich. Robert hat Sie mir wärmstens ans Herz gelegt.« Mitch knipst sein betörendes Lächeln an. »Einen Drink?«
»Gerne. Einen Martini.« Carla schaut sich nach einem Kellner um, entdeckt aber keinen. Einen Drink kann ich noch vertragen, wägt sie die Ermahnung des älteren Kellners ab, obwohl sie praktisch noch gar nichts gegessen hat. Carla Bell kann das Essen manchmal einen ganzen Tag vergessen, wundert sich dann spätabends, warum ihr Magen knurrt; erst recht ärgert sie sich, wenn sie wieder in einen leeren Kühlschrank blickt.
»Robert, kannst du das organisieren?«
»Sicher.« Pearson macht sich erleichtert auf die Suche nach einem Kellner. Sobald es um ein weibliches Wesen geht, kann Mitch Lehman jedem Mann im Umkreis von zehn Metern ein Gefühl der Überflüssigkeit vermitteln.
Die befehlende Bitte an Pearson spricht Lehman halb über die Schulter, ohne Carla dabei aus den Augen zu lassen, die das amüsiert zur Kenntnis nimmt.
»Wann geht es bei Ihnen in die Ferien, Mr. Lehman?«, versucht sie sich in Small Talk und verschränkt die Arme so vor der Brust, dass man das Bändchen nicht sehen konnte.
»Erst am 24. In die USA. Und Sie?«
»Auch am 24. Aber nur nach Hertfordshire«, lacht Carla.
»Nette Gegend, mein ehemaliger Chef hat dort vor vielen Jahren mit den Behörden verhandelt, weil er einen passenden Ort für ein Ausweichzentrum für den Handel suchte. Sie wissen, dass alle Banken über zweite geheime Handelssäle verfügen, falls der Hauptsaal von Terroristen in die Luft gesprengt wird? Wir haben uns die Gegend ein paar Mal zusammen angeguckt. Sehr schön dort.« Mitch freut sich, dass er so einfach ein unverfängliches Thema gefunden hat, um mit der hübschen Journalistin ins Gespräch zu kommen.
»Das dürften Sie mir doch gar nicht erzählen, wenn es geheim ist, Mr. Lehman.« Carla möchte Mitch ein bisschen ärgern, eine Masche, mit der sie sich den Big Boys der City gerne nähert, weil die meistens nicht so recht mit ihr umzugehen wissen. Weibliche Reize und ein freches Mundwerk lösen so manche Bankerzunge und bringen mitunter interessante Informationen zutage.
»Wurde ja leider nichts draus, sonst wären wir uns vielleicht schon früher begegnet. Eigentlich schade, dass sichAshton am Ende für Irland entschieden hat.« Mitch läuft zur Hochform auf, die Kleine gefällt ihm auf Anhieb.
Für den Bruchteil einer Sekunde glaubt Carla, sich verhört zu haben, doch bevor sie nachhaken kann, wieselt Pearson mit einem Tablett voller Martinis heran.
»Bitte, Carla.« Robert reicht ihr den Martini, Mitch lehnt ab – und bringt ihn so in die peinliche Situation, mit zwei vollen Gläsern balancieren zu müssen.
Abwesend starrt Carla in ihr Glas, die Gedanken rotieren, und wenn sie sich nicht täuscht, hat Lehman soeben »Ashton« gesagt, ein Name, der sie erschreckt, ihr heiße Schauer über den Rücken jagt.
Sofort ist das grauenhafte Bild wieder präsent: Ihre Mutter liegt tot in der Badewanne, mit aufgeschlitzten Pulsadern. Und Ashton, Stanley Ashton, so heißt der letzte Mann, der ihre Mutter lebend gesehen hat. Ashton, Ashton, bei Carla beginnt sich alles zu drehen. Er muss es sein, denn wie viele Ashtons kann es geben, die zugleich als Banker und noch dazu in einer hohen Position tätig sind, geht es ihr durch den Kopf. Sie muss sich Gewissheit verschaffen, auf der Stelle. Carla reißt sich zusammen, krampft sich am Glas fest und versucht ganz ruhig zu bleiben.
»Wie heißt der Mann, der Sie in unsere kleine Stadt geschickt hat?«, bringt sie sich wieder ins Gespräch.
»Ashton, Stanley Ashton«, wundert sich Mitch. Die Konversation nimmt eine Wendung, die ihn irritiert.
»Ach so«, gibt sich Carla desinteressiert, »ich hatte eine Schulfreundin, deren Vater Morgan Ashton hieß.«
Kein Zweifel, er ist es. Und nun läuft sie jemandem über den Weg, der ihn nicht nur kennt, sondern der auch noch mit diesem gewissenlosen Mann zusammengearbeitet hat. Nichts anderes ist Stanley Ashton für sie. Ein Mensch, der den Tod in Kauf nimmt, auch wenn Mutter sich selbst getötet hat. So weit hat sie sich das ganze Drama vor fünfzehn Jahren zusammengereimt, denn ihr Vater will bis heute nicht wirklich darüber sprechen.
Carla Bell nimmt einen großen Schluck aus ihrem Glas – und plötzlich wird es ihr schwarz vor den Augen. Mit einem leichten Seufzer versucht sie, sich am Ärmel von Robert Pearson festzuhalten, der erschrocken einen Schritt zur Seite tritt.
Das Zersplittern des Glases geht im allgemeinen Gelächter und Gesumme der Gäste unter, und Mitch Lehman springt geistesgegenwärtig genug nach vorn, um Carla gerade noch auffangen zu können. Im nächsten Moment hätte er sie beinahe auf den Boden fallen lassen, als er das blaue Band an ihrem Handgelenk entdeckt.
Verstört zischt er Pearson an: »Was wird hier gespielt, Pearson?« Dabei deutet er auf das Band, sodass es nun auch Robert sieht. Sein Gesicht verliert jede Farbe, doch erst einmal müssen sie sich um die junge Frau kümmern, die langsam wieder zu sich kommt.
Wenn Mitch Lehman Robert Pearson mit seinem Nachnamen anspricht, bedeutet das dicke Luft. Der PR-Berater schaut verstört von Lehman zu Carla und wieder zurück.
»Das Band, du Idiot«, presst Lehman leise zwischen den Zähnen hervor, während er die benommene Journalistin in Richtung eines Sessels bugsiert. Wie gelähmt starrt Robert auf die groteske Situation.
»Entschuldigung«, stammelt Carla Bell, wieder zu sich gekommen. Verwirrt schaut sie auf Mitch Lehman, der neben ihrem Sessel steht. Sie versucht aufzustehen, doch ein erneuter Schwindel zwingt sie zurück in die Polster.
»Alles in Ordnung, Mrs Bell?«
»Ja, danke. Danke fürs Auffangen, Mr Lehman«, haucht sie leise.
»Gern geschehen. Da habe ich mal etwas gut bei Ihnen. Tut mir leid, aber ich werde gebraucht, doch Robert kümmert sich um Sie. Wir sehen uns, Mrs Bell«, verabschiedet sich Mitch Lehman freundlich, aber deutlich kühler als zuvor.
»Sicher«, antwortet sie immer noch benommen.
Dass Lehman und Pearson das blaue Band an ihrem Handgelenk entdeckt und ärgerlich-besorgte Blicke getauscht haben, bemerkt sie nicht. Lehman verschwindet in Richtung der Aufzüge, Pearson hockt sich auf die Lehne ihres Sessels. In einer anderen Situation hätte sie schleunigst das Weite gesucht, doch jetzt ist ihr das alles egal. Hauptsache, sie sitzt und kann nicht wieder umfallen.
»Besorgen Sie mir etwas Wasser?«, bittet Carla Pearson; sie muss für einen Moment ihre Gedanken ordnen. Mitch Lehman hat also mit Stanley Ashton gearbeitet, diesem Schwein. Der dafür verantwortlich ist, dass er eine kleine zufriedene Familie in eine Katastrophe gestürzt hat. Nur schwer kann sie die Tränen zurückhalten; Carla Bell muss ihren ganzen Willen aufbieten, um nicht laut zu schreien.
Stattdessen beißt sie sich in die Unterlippe, bis sie Blut schmeckt. Blut, rotes Blut, so rot wie das Badewasser ihrer Mutter. Lange ist es ihr gelungen, das Bild und die ganze Zeit von damals zu verdrängen. Mit dem Namen Stanley Ashton ist jedoch eine Türe aufgesprungen, die sie seit einigen Jahren erfolgreich abgeschlossen und den Schlüssel dazu weit weggeworfen hat. Unbändige Wut macht sich in ihr breit und verleiht ihr die Energie, sich wieder aufzurichten. Pearson will sie sich noch vorknöpfen, koste es, was es wolle.
»Nicht gleich wieder verschütten.« Robert kehrt mit einem Martini für sich und einem großen Glas Wasser für Carla zurück. Sein Lächeln wirkt verkrampft.
»Auch bei den Nutten gewesen, Robert, als Sie vorhin aus dem Aufzug kamen?« Bevor Pearson sie mit Anzüglichkeiten wegen ihrer Ohnmacht lächerlich machen würde, wirft sie ihm blitzschnell den Knochen vor die Füße, ehe sie sich auf den Heimweg aufmachen würde.
Pearson entgleisen die Gesichtszüge, obwohl ihn nach zwanzig Jahren PR in der City nichts so leicht überraschen konnte. Keine Sekunde später hat er sich jedoch gefangen:
»Wie bitte? Ich war mich nur kurz erfrischen, da ich hier übernachte. Sie wissen vielleicht, dass ich in Oxfordshire lebe, es ist einfacher für die Kinder, die dort in die BoardingSchools gehen. Wenn ich in der Stadt übernachte, schlafe ich immer hier im ›Grosvernor House‹.«
Robert hofft, mit dieser Familiengeschichte vom Thema abgelenkt zu haben, doch Carla bleibt dran.
»Robert, was sollen die blauen Bändchen? Das sind doch Nutten.« Dumm nur, dass Carla zu Robert aufschauen muss, der vor ihrem Sessel steht.
»Sorry?«, mimt er den Erstaunten.
»Ich bin verwechselt worden, Robert. Einer der jungen Typen hat mich ziemlich dreist aufgefordert, mit ihm in diesem Aufzug nach oben zu gehen und eine Nummer zu schieben. Er hielt mich für genauso eine, wie die, mit der Sie rausgekommen sind. Eine schöne Geschichte, nicht wahr?«
Carla hält ihm ihr rechtes Handgelenk entgegen und starrt ihn an.
Verdammt, flucht Pearson, das Problem scheint noch viel größer, als er in seinem ersten Schrecken angenommen hat.
»War wohl alles ein bisschen zu viel heute? Carla, wir schauen jetzt erst einmal, dass Sie gut nach Hause kommen.«
»Lassen Sie den Unfug, Robert. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen.« Nur mit größter Mühe kann Carla ihren Ärger unterdrücken. Sie steht auf, um Robert auf Augenhöhe zu begegnen. Doch der ist mit seinen 1,90 Meter immer noch ein Stück größer als sie. Der Schwächeanfall scheint vorüber, sie kann bereits wieder stehen.
»Hören Sie, Carla, ich kann Ihnen das erklären. Schreiben Sie nichts, ehe wir das nicht in Ruhe besprochen haben, ja. Ich lasse Sie jetzt von unserem Fahrerservice nach Hause bringen und dann reden wir morgen in aller Ruhe darüber. Einverstanden?«
Carla steht zwar wieder auf ihren Beinen, doch so richtig wohlfühlt sie sich nicht, eher unbehaglich über die verwirrende Situation.
»Wieso sollte ich das nicht schreiben?« Sie nimmt einen Schluck Wasser und Robert ins Visier.
»Weil ich Ihnen ein Geschäft anbieten werde.«
»Für Geschäfte bin ich nicht zu haben. Ich bin nicht käuflich, Robert.«
»Natürlich nicht, Carla. Aber das besprechen wir morgen. Ich komme um zwölf Uhr mittags zu Ihnen in die Redaktion. Okay?«
»Okay. Aber schreiben werde ich das auf jeden Fall. Ich bin schließlich Journalistin!« Sie schwankt leicht, eine Melange aus Martini, Ashton, Lehman und blauen Bändern schwirrt durch ihren Kopf. Es ist dringend Zeit, kontrolliert von dieser Feier zu verschwinden.
»Ich weiß«, antwortet Robert, der diesen Spruch nur zu genau kennt. Pearson weiß, dass er etwas Zeit gewonnen hat; der »CityView« erscheint nur montags, mittwochs und freitags.
Mit einem matten »bis morgen« lässt Carla Bell den verdatterten Pearson einfach stehen und stakst zur Garderobe. Die Weihnachtsfeier entwickelte sich genau so, wie der nette Kellner es ihr prophezeit hatte: Einige Gäste torkeln schon mächtig hin und her. Müde schleicht Carla vorsichtig die große Eingangstreppe hinunter und stößt auf Isabella Davis, Lehmans Chefin für strukturierte Produkte.
»Hallo, Mrs Bell, auch genug?«
»So ist es, Mrs Davis. Schön, Sie noch zu sehen.«
»Kann ich Sie im neuen Jahr mal anrufen?« Carla Bell schafft es noch, die Finanzingenieurin nach einem Termin zu fragen. »Ich möchte mich über strukturierte Produkte, Zertifikate, Derivate und so weiter mit Ihnen unterhalten. Vor allem alles, was mit Immobilien besichert ist. Sie machen doch auch so etwas, oder?«
»Ja, ja, sicher, sicher«, stutzt Isa, »aber wo ist das Problem?«
»Nirgendwo. Ich will nur genauer verstehen, wie das funktioniert. Ist doch ein großes Geschäft?«
»Sehr sogar und sehr profitabel. Aber jetzt ist erst einmal Weihnachten«, entgegnet Isabella Davis, als wie auf Bestellung ihr Blackberry klingelt.
»Man hat nie Ruhe, Mrs Bell.« Isabella reicht ihr die rechte Hand, während sie bereits mit der linken auf die Empfangstaste drückt. »Na denn, frohe Weihnachten!«
»Ihnen auch, Mrs Davis. Ich melde mich im neuen Jahr.«
Sie nicken einander kurz zu.
Davis hängt nun am Telefon – kurz vor Mitternacht und drei Tage vor Weihnachten.
Carla Bell lässt sich in einen der Sitze im Fond fallen und nennt dem Fahrer ihre Adresse in Islington im Londoner Norden. Bloß nach Hause, denkt sie und betrachtet das blaue Bändchen, das sie immer noch trägt. Als sie es abreißen will, stoppt sie und murmelt vor sich hin: »Das halte ich Robert Pearson morgen noch einmal unter die Nase.«
»Wie bitte?«, fragt der Fahrer.
»Nichts, nichts für Sie. Bitte fahren Sie.«
World. Financial Center
Aus dem Augenwinkel sieht Carla bei der Abfahrt, wie Isabella Davis mit dem Arm kreisende Handbewegungen vollführt. Ganz offensichtlich versucht sie, irgendjemand am anderen Ende der Leitung etwas zu erklären, obwohl der das gar nicht sehen kann. An diesem anderen Ende der Leitung ist Carl Bensien, ebenfalls wild mit dem freien rechten Arm rudernd. Auch er will etwas durchsetzen, doch bei Isabella muss man schon sehr gute Argumente auffahren, um ihr Paroli bieten zu können.
Der Chief Risk Officer und die Global Head of Structured Products liefern sich seit zwei Jahren einen ständigen Kampf, wenn es um das richtige Maß an Risiko für die Carolina Bank geht. Wenn Carl mit Isabella telefoniert, geht es jeweils hoch her. Tim MacGovern, seit einem halben Jahr Bensiens neuer Risk Assistent, staunt jedes Mal darüber, wie sein ansonsten nicht aus der Ruhe zu bringender Chef bei Debatten mit der »Rakete« seine Stimme hebt und laut wird.
Es gehört zur Tradition des Hauses, dass ein smarter junger Kopf dem Chief Risk Officer rund zwei Jahre als persönlicher Assistent zur Hand gehen und alles über Global Risk Management lernen kann. Danach gehen die Assistenten zumeist in eine Region, um dort im Regional Risk Management zu arbeiten. Carl hatte Tims Vorgänger nach Singapur versetzt – eine Aussicht, für die sich die harte Arbeit als Bensiens Assistent lohnt.
Bensien stellt an seine persönlichen Assistenten allerdings die Bedingung, stets aufmerksam zuzuhören und zuzusehen – sowie jetzt gerade.
Umgekehrt wie bei den drei Affen, hatte er es bei der Einstellung formuliert. »Und was ist mit dem Reden«, hatte Tim nachgehakt und die drei Affen imitiert.
»Gerne auch, aber nur unter vier Augen«, hatte die unmissverständliche Antwort gelautet, auch wenn Carl über die Parodie geschmunzelt hatte. Genau das hatte Tim vor ein paar Tagen getan. »Wir müssen reden, Chef.« Tims Gesichtsausdruck war ernst. »Es geht um diese Holiris.« Über diese Konstrukte streitet Carl Bensien jetzt mit Isabella Davis, während Tim über eine zweite Ohrmuschel die Diskussion mitverfolgt.
»Nein, Isabella, diese Informationen reichen mir nicht aus.«
Carl blickt dabei auf seine Wanduhren, die in das Glas der Trennwand seines Büros eingelassen sind. New York, sieben Uhr abends, London gerade Mitternacht. Die Freiheitsstatue strahlt erhaben von Liberty Island herüber – ein Anblick, der Carl auch nach zwei Jahren in Big Apple immer noch den Atem raubt und für einen Moment alles andere vergessen lässt. Diese überwältigende Sicht aus seinem Büro im vierzigsten Stock des World Financial Centers auf den sich öffnenden Hudson River, der sich bei den drei Inseln Liberty, Ellis und Governors Island mit dem East River vereint, ist für den Schweizer, der die Berge mehr vermisst, als er je gestehen würde, ein leiser Trost.
»Ich will morgen eine deutlichere Dokumentation dieser Holiris haben, sonst gebe ich sie dir nicht frei.« Carl konzentriert sich wieder auf das Telefonat.
»Carl, wir haben da eine Supersache strukturiert, die gerade das Risiko der Immobilien senkt. Damit fahren wir doch viel besser. Das musst doch gerade du unterstützen, wenn du unser Risiko managen willst«, argumentiert Isabella in der weihnachtlich geschmückten Eingangshalle des »Grosvernor House«. Auch sie möchte fertig werden und am nächsten Tag nur noch ihren Schreibtisch vor dem Urlaub in Australien aufräumen. Auf lange Diskussionen hat sie keine Lust.
»Kann ja sein, aber wir haben das Ding noch nicht richtig unter die Lupe nehmen können. Geschweige denn gestresst«, gibt Bensien zu bedenken, der in seiner Verantwortung das ganze Projekt auf der Stelle stoppen könnte. Isabella Davis hatte mehrfach erlebt, dass der Schweizer keine Angst vor General Lehman zeigte, dener treffen wollte, wenn er ihre Handlungsfähigkeit einschränkte.
Zwischen Lehman und Bensien herrscht ein regelrechter Krieg: Hier ein Trader mit Tellerwäscherkarriere, dort ein Bankier aus dem Zürcher Wirtschaftsadel. Und sie steht zwischen den Fronten, aber für jeden erkenntlich auf Mitchs Seite, denn der zahlt ihren Bonus, Millionen und Millionen jedes Jahr.
»Charly, wir fliegen morgen bereits nach Perth. Können wir das nicht aufs neue Jahr verschieben? Lass uns ein paar Tage Pause machen!«
Carl Bensien kann es überhaupt nicht leiden, wenn ihn jemand Charly nennt. Bei Isabella macht er eine Ausnahme; im Grunde mag er die Rakete ja. Sie ist eine der besten Rocket Scientists der City, das ist Bensien durchaus bewusst, und ihr Financial Engineering hat bislang immer funktioniert. Unter anderen Umständen wären sie vermutlich ein super Team:
Geschwister im Geiste, denn sie kann rechnen wie er, was er enorm schätzt. Aber sie arbeitet eben für Mitch Lehman, und genau dem traut Bensien keinen Millimeter über den Weg, selbst wenn er in der Zentrale quasi als unantastbar gilt.
Der Vorstandsvorsitzende Don Kramer lässt Carl meist stillschweigend gewähren. Besser sein »Swiss Knife«, wie er ihn im trauten Kreis manchmal nennt, setzt sich dem Ärger mit Lehman aus – falls nötig, konnte Kramer immer noch eingreifen. Der joviale »DFK« beherrscht das Spiel des Ausgleichs ausgezeichnet, nicht umsonst steht er seit drei Jahren an der Spitze dieser Bank und wird von den Medien schon jetzt als einer der ganz großen Bosse der Wall Street gefeiert.
Vermitteln, die Wogen glätten, Zuckerbrot verteilen und ab und zu die Peitsche knallen lassen, das ist sein Job, jedoch nicht der von Carl. Wenn es um Zahlen und Fakten, vor allem aber um Präzision und Korrektheit geht, ist Bensien stur wie ein Esel, und für Mitch Lehman ein rotes Tuch. Was sich, sehr zum Missfallen von Mitch Lehman, bis in die untersten Chargen des weitverzweigten Händlernetzes der Carolina Bank herumgesprochen hat.
Bensien scheint Bewegung zu brauchen, beobachtet Tim. Sein Chef tigert, soweit das Kabel reicht, vor der großen Glasfront auf und ab, während er stirnrunzelnd die Erläuterungen von Isabella Davis entgegennimmt.
Tim MacGovern stammt aus Aspen, Colorado, und fährt Ski, seit er laufen kann. Er ist über 1,80 Meter groß und drahtig. Seine roten Haare leuchten schon von Weitem wie ein Fanal, unterstützt von den im ganzen Gesicht verteilten Sommersprossen. Tim kann nie still sitzen; nur wenn er sich in mathematische Probleme vertieft, hält es ihn versunken an einem Ort. Eigentlich passt das Gesicht von Tim mehr zu einem derben Holzfällerhemd als zu einem feinen Anzug mit Krawatte, hatte Carl bei der Einstellung gedacht. Doch bereits in den ersten Tagen entpuppte sich der junge Mann als ausgesprochen smart, was Zahlen anging. Allerdings hatte Carl ihn auch genommen, weil er so euphorisch und mit leuchtenden Augen vom Skifahren erzählt hatte. Als er vor gut sechs Monaten zum Bewerbungsgespräch vor ihm saß, hatte er nur einen Wunsch geäußert: Urlaub über Weihnachten und Silvester, weil er nach Aspen zu den Eltern und zum Skifahren wollte. Kaum jemand konnte das so gut nachvollziehen wie Carl, der seit frühester Kindheit auf Skiern stand.
»Präzisiere noch einmal, was ihr mit den Dingern vorhabt«, befiehlt Carl Isa und schaut dabei auf den mithörenden Tim. Bensien fuchtelt mit der Hand und gibt Tim das Zeichen, sich Notizen zu machen.
»Also, Carl, es ist ganz einfach: Wir sichern die Wertpapiere nicht mehr nur mit einem Vermögenstyp in unterschiedlichen Risikoklassen ab, sondern gleich mit mehreren Typen mit unterschiedlichen Risiken. Wir streuen das Risiko also breiter.«
»Schon«, entgegnet Carl, der plötzlich ganz ruhig hinter seinem Schreibtisch steht, »aber du bringst auch mehr Risiken rein.«
»Richtig, aber statt eines mit Immobilien besicherten Wertpapiers verkaufen wir dann ein sauber strukturiertes Papier, das mit einem ganzheitlichen Vermögen besichert ist. Insofern sind auch die Vermögenswerte breiter aufgestellt.«
»Statt nur Immobilien also Leasing, Kontokorrent, Kreditkarte und so weiter?«
»Genau so ist es, Carl. Deshalb auch Holistic Individual Risk Security oder kurz: Holiri – das neueste Produkt aus meiner Derivateküche.«
»Was für ein Name!«
»Reines Marketing, Herr Kollege. Hört sich doch süß an.«
»Und was ist mit Interdependenzen? Wie machst du das? Wenn jemand kein Geld mehr für die Hypothek hat, dann spielt er vielleicht auch zu viel mit seinen Kreditkartenlimiten?«
Auf die süße Tour braucht Isabella dem pedantischen Risikomanager gar nicht erst zu kommen … Tim kann sich ein Lächeln nicht verkneifen, das auch Carl bemerkt. Carl fixiert Tim und signalisiert mit einem süffisanten Lächeln »Jetzt habe ich sie«; er weiß, dass er mit dem Hinweis auf die gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen allen Kreditarten einen Schwachpunkt in Isas Plan entdeckt hat.
»Das stimmt nur, wenn es sich um ein und dieselbe Person handelt, aber wir schneiden die Schuld einzelner Krediteure ja auseinander und setzen alles anders zusammen. Den Hypokredit des einen, das Leasing des nächsten und vielleicht die goldene Kreditkarte des anderen, Carl. Da ist nix groß mit Interdependenzen«, hält Isabella dagegen, indem sie ihre Stimme deutlich anhebt.
»Aber in deinem Papier hast du neben einzelnen doch auch ein gesamtes Risiko, Isabella?«
»Wir nehmen das leicht zu berechnende Einzelrisiko und legen eine normalverteilte Zusatzkomponente für das Gesamtrisiko obendrauf.« Isabella legt ihre ganze Überzeugungskraft in ihre Antwort und hofft, damit durchzukommen.
»Und das soll funktionieren?« Carl blickt fragend auf Tim. Der junge Mathematiker wundert sich, wie unmenschlich dieses Geschäft doch manches Mal ist: Menschen auseinanderschneiden und wieder zusammensetzen? Wenn ich so etwas meinen Eltern erzählen würde, denkt Tim und lauscht mit zunehmendem Unbehagen.
»Meiner Ansicht nach auf jeden Fall. Ich habe es gerechnet, Carl.«
Bensien schweigt eine Weile, dann zuckt er mit den Schultern.
»Okay, Isabella«, seufzt er. »Ich gebe dir zunächst einmal fünf Milliarden Dollar in einer ersten Tranche frei. Aber nur Super Senior mit Triple-A-Rating, damit das klar ist. Und nur, weil Weihnachten vor der Tür steht. Die kannst du platzieren. Aber ich schaue mir die Sache nach den Feiertagen noch einmal ganz genau an. Wenn du Pech hast, reduziere ich dir selbst die noch einmal.«
Auch Carl möchte sein Büro am nächsten Tag aufräumen, am Nachmittag einen kleinen Umtrunk für sein Team anbieten und dann in Urlaub fahren. Die Luft ist raus, er braucht Abstand.
»Einverstanden, Carl, damit kann ich leben. Lass uns nach dem 8. Januar reden, dann bin ich wieder da. Und frohe Weihnachten.« Isabella atmet tief aus. Geschafft! Denn im Prinzip haben Mitchs Vertriebsleute bereits mit dem Marketing für die Holiris begonnen.
»Frohe Weihnachten, Isabella«, grüßt Carl versöhnlich zum Schluss, legt auf und schaut noch einmal nachdenklich in Richtung Statue of Liberty. Manches Mal überkommt ihn eine Spur von Wehmut, dass er nicht mehr in Zürich lebt und von seinem Haus an der sonnigen Goldküstenseite auf den See und die dahinter liegenden Schweizer Berge blicken oder zum Mittagessen von der Bank über den Paradeplatz spazieren kann.
Aber er hat ja seine »Grafiken«, wie er die als Kursverläufe stilisierten Bergsilhouetten von Pilatus, Säntis, Matterhorn und Dom bezeichnet, die die rechte Wand seines geräumigen Büros zieren. An der linken Seite einer großen Glasscheibe sind die Uhren eingelassen. Eine Seite mit globalem Zeitsystem auf Glas, die andere Seite mit stilisierten Berg-Kurs-Verläufen auf einer hellen Holzwand – ein Gegensatz, über den Tim schon mehrfach nachgedacht hat.
Zumal hinter der Glaswand der War Room der Bank zu sehen ist. Nächstes Jahr werden dort einige globale Kapitalmarktmanöver durchgeführt, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Tim ist mächtig stolz darauf, Teil dieser Mannschaft zu sein, die seit Monaten an den Stresstest-Simulationen arbeitet.
Natürlich gab es Stresstests in allen Banken und auch bei der Carolina Bank, aber was sie jetzt im Geheimen entwickelt hatten, würde eine ganz neue Art von Risikoanalyse bedeuten. »Bei Dopingtests muss man sich ja auch immer etwas Neues einfallen lassen, um den Sündern auf die Spur zu kommen«, hatte Carl Tim den Grund für das neue Verfahren und die strikte Geheimhaltung erklärt.
Die Grafiken und die Glaswand, vorne der Blick auf Lily, wie Tim die Freiheitsstatue gerne nennt, und die Bildschirme auf seinem Schreibtisch leisten ein Übriges, um Carls Büro als das bevorzugte Ambiente eines kultivierten harten Arbeiters zu geben. Nur hinter seinem Schreibtisch stapeln sich Bücher und Zeitschriften. Zudem ein paar wenige private Bilder, die offensichtlich die Familie zeigen, über die Carl allerdings noch nie ein Wort verloren hatte.
Tim weiß nur, dass Dr. Bensien Mathematik an der ETH in Zürich studiert und mit einer Arbeit über ökonometrische Modelle promoviert hatte. Auch Tim ist Ökonometriker. Sein Professor an der Uni hatte das Unternehmen »econometrics« gegründet, das Banken sehr erfolgreich bei der Modellberechnung beriet. Und über diese Firma war Tim zu Bensien gestoßen, als Carl econometrics als Berater ins Haus holte, um das Risk Management der Carolina Bank auf Vordermann zu bringen.
Im Sommer 2004 hatte ihn sein alter Freund Don Kramer, der wenige Monate zuvor Chef der Carolina Bank geworden war, in London getroffen und Carl Bensien flugs als Chief Risk Officer für die Carolina Bank an Bord geholt. Bensien ahnte, dass Martina beim Stand ihrer ehelichen Nichtbeziehung kaum mehr mit ihm von London nach New York kommen würde, und hatte – ganz entgegen seiner Gewohnheit, alles ausführlich zu bedenken – quasi auf der Stelle zugesagt. Der Schweizer sollte das Risk Management der Bank verfeinern – eine Herausforderung, die er nur zu gern annahm.
Seine Zusage hatte ihrer Ehe den Rest gegeben. Martina ging zurück nach Zürich, die Jungs waren ohnehin im Internat in der Westschweiz und Carl wechselte nach New York. Seit knapp zwei Jahren im Vorstand der Carolina Bank, lag er von Anfang an quer im ExCom, wie der Vorstand abgekürzt wurde, mit Mitch Lehman und dessen Truppe. Und seit einem Jahr war Bensien geschieden, das hatte Tim irgendwann mitbekommen. Das Familienfoto musste also aus besseren Tagen stammen.
»Tim, was hältst du von diesen Holiris?«
Carl geht um seinen Tisch herum und bittet Tim in die Sitzecke mit Blick auf die grafischen Berge. MacGovern nimmt seine Aufzeichnungen mit und schnippt mit dem Finger durch den vollgekritzelten Zettelblock.
»Nun, Chef, wenn ich Mrs Davis richtig verstanden habe, will sie eine neue Derivate-Familie aufsetzen, die Risiken aus Hypothekenkrediten, Kreditkartenverbindlichkeiten, klassischen Konsumkrediten, dem Leasing für das Auto vor der Tür und der Einkommenshöhe eines Menschen so auseinander- und wieder zusammensetzt, dass ein völlig anderer Risikomensch dabei herauskommt. Eigentlich doch einleuchtend, dass dieses Modell besser ist als nur eine Risikoart, wenn auch in unterschiedlichen Klassen.«
»So weit, so gut, Tim«, Carl lehnt sich entspannt auf der kleinen Sitzcouch zurück, »aber wie willst du die Volatilität am Markt berechnen?«
Daran hat er nicht gedacht, Tim zuckt verlegen mit den Schultern.
»Lass uns mal für einen Moment auf die Basics zurückgehen. Das ist immer gut, wenn jemand etwas Neues auflegen will.« Carl beugt sich nach vorne. »Es bleibt doch dabei, dass auch diese neue Holiri-Familie Derivate sind, deren Bewertung sich vornehmlich aus den Preisschwankungen von dahinterliegenden Basisinstrumenten ableiten, oder?« Selbst im Englischen zieht Carl das Ende des Fragesatzes immer ein bisschen in der Stimmlage nach oben, so wie Schweizer das machen.
»Ja, und wo liegt das Problem?« Tim versteht immer noch nicht, worauf sein Chef hinaus will.
»Unsere Mrs Davis lässt in ihrem neuen Derivat das Risiko immer hin und her springen, ohne es vollends auftreten zu lassen, Tim. Mal ist es mehr bei den Hypotheken, mal bei den Kreditkarten.« Carl dreht beide Hände in der Luft hin und her, als wollte er Glühbirnen einschrauben. »So bastelt sie sich meiner Ansicht nach unterschiedliche reale Zusammenhänge surreal zusammen, und zwar immer so, dass für sie dabei eine gute Risikoeinschätzung herauskommt. Da können mehr Triple-A-Produkte herauskommen, als unterlegtes Triple-A-Vermögen da ist.«
»Das stört Sie daran?« Tim kaut nachdenklich auf seinem Kugelschreiber und versucht den Gedanken seines Chefs zu folgen.
»Ja. Man könnte böswillig sagen, sie packt es immer dahin, wo es ihr am wenigsten wehtut.«
»Wieso sollte sie das tun?«
»Tim, wofür habe ich ein smartes Kerlchen wie dich als Assistenten? Da kann ich ja gleich einen Trader nehmen«, knurrt Carl etwas unwirsch; er verliert rasch die Geduld, wenn jemand seinen Gedanken nicht schnell genug folgen kann. »Lassen wir das Wieso erst einmal beiseite und fragen nach dem Wie. Bei einer Risikoart spielst du Drei-Band-Billard auf dem Tisch. Wenn man jetzt mehrere Arten und Klassen hat, ist das so, als spieltest du Drei-Band-Billard nicht auf der Fläche des Tischs, sondern im Raum mit drei Dimensionen.«
»Kapiert, sie hat eine Ebene mehr drin, nicht wahr?«
»Genau. Wie Vektoren im Raum, und da weiß ich nicht, wie sie das Marktrisiko berechnen will.«
»Man kann ja auch nicht Billard im Raum spielen«, antwortet Tim.
»Richtig«, lacht Carl.
»Das müsste mathematisch jedenfalls ein ziemlich komplexes Gleichungssystem sein«, wirft Tim ein.
»Ich habe nichts gegen Holiris. Hört sich unmenschlich an, aber das ist eine andere Frage. Ich will nur wissen, ob ihre Berechnungen stimmen. Denn sonst schätzt sie das Marktrisiko falsch ein.« Carl steht bei seinen letzten Sätzen auf, ärgert sich, dass er wieder mal zu ungeduldig mit seinem Assistenten ist, und geht an ihm vorbei, um ihm väterlich auf die Schulter zu klopfen: »Entscheidend ist aber nicht nur das Berechnungssystem, sondern vor allem auch, welche Risikoverteilung sie annimmt. Dass das alles normalverteilt sein soll, kann ich nicht so recht nachvollziehen. Aber das schauen wir uns im Januar an. Mache dir bitte eine Notiz, dass sie nur fünf Milliarden ausgeben darf, die alle erstklassig in Super-Senior-Tranchen geratet sein müssen.«
»Was ist mit dem Wieso, Chef?«
»Weil sie schlau ist und erkennt, dass Immobilien alleine nicht mehr laufen. Und Trader brauchen andere Quellen, mit denen sie ihre Handelsströme in Bewegung halten können. Das ist ihr Job bei Lehman. Sie musste sich etwas einfallen lassen. Unser Job ist es, auf die Gesamtbank aufzupassen.«
Als Tim auch aufsteht, wechselt Carl das Thema: »Wann geht es nach Hause, Tim?«
»Morgen, Chef. Und dann auf die Ski. Kurz vor Weihnachten sind die Hänge noch so schön leer. Was ist mit Ihnen, Chef?«
Als Carl länger schweigend aus dem Fenster blickt, beide Hände tief in die Taschen der Anzughose bohrt, realisiert Tim, dass er die falsche Frage gestellt hat. Entsprechend knapp fällt die Antwort aus.
»Zermatt. Tim, lass uns Schluss für heute machen. Ich muss noch zum Umtrunk des Vorstands in die Zweiundvierzigste. Wir sehen uns morgen noch kurz.«
Carl verabschiedet sich, nimmt die Treppe in die Zweiundvierzigste; das Vorstandscasino liegt nur zwei Etagen über seinem Büro. Auf dem Weg nach oben ärgert er sich, und zwar über sich selbst. Tim meinte es doch nur gut mit der Frage, denkt er beim Öffnen der Feuertüre zum obersten Stockwerk des World Headquarter der Carolina Bank.
»Bonsoir, Carl.« Don Kramer kommt mit einem Glühwein in der Hand auf ihn zu.
»Salü, Donald.« Beide schmunzeln, als sie sich die Hand reichen. Wenn Don ihn auf Französisch mit eindeutig Westschweizer Akzent anspricht, ärgert Carl ihn immer mitSchweizerdeutsch. Don hatte das in der Schweiz fast in den Wahnsinn getrieben, da er in der Schule Hochdeutsch gelernt hatte.
Kramer und Bensien kannten sich, seit sie während zwei Jahren gemeinsam das Traineebüro bei Douvalier & Cie. in Genf geteilt hatten. Über zwanzig Jahre war das inzwischen her: An einem kleinen Schreibtisch in der Minikammer saß der Neffe des Privatbankiers Theodore Douvalier, am anderen der Sohn amerikanischer Industrieller, der bei den Geschäftspartnern in Genf das Bankgeschäft erlernen durfte. Danach machte Carl schnell Karriere in der Bank, die mit seinem abrupten Abgang vor zehn Jahren endete. Natürlich hatten alle Beteiligten Stillschweigen vereinbart, und auch Carl hatte nur vage Andeutungen gemacht. Nichtsdestotrotz waren seinem alten Freund Don die Umstände der Familientragödie bekannt.
Kramer selbst war nach der Traineezeit und ein paar industriellen Lehr- und Wanderjahren in die Carolina Bank eingetreten; er hatte dort das Geschäft mit Unternehmensfinanzierungen vorangetrieben und war vor gut zwei Jahren an die Spitze berufen worden.
»Alter Freund, wie geht es dir?« Kramer greift Bensien um die Schulter. Mit seinen 1,90 Meter ist er fast genauso groß wie Carl, wiegt aber sicher hundertfünfzehn Kilo. Kramer ist vom Scheitel bis zur Sohle ein Genussmensch mit Bauch, Glatze, Doppelkinn und kleinen flinken Augen, denen nichts entgeht.
»Habe mich gerade wieder über Isabella geärgert.«
»Du meinst über Mitch«, korrigiert Don, der ihn zur Bar steuert und dabei das rechte Augenlid zusammenkneift.
»Genau. Wir müssen besser prüfen, was die machen.« Carl bleibt direkt vor Don stehen.
»Kann es sein, dass du zu viel Angst vor dem Risiko hast, Carl?« Lehman und Davis haben sich beide schon vor Tagen bei Kramer beschwert, dass Bensien die Freigabe der Holiris blockiert.
»Ich habe einmal zu wenig Angst davor gehabt, und du weißt das.«
Kramer zieht Bensien in eine Ecke: »Ich weiß, Carl. Und deshalb habe ich dich geholt. Aber du musst auch mich und Lehman verstehen. Der Mann ist eine Geldmaschine. Ohne ihn fielen wir gegen die anderen Banken mit unserer Rendite total ab.«
Bensien lehnt sich an einen Pfeiler in der Ecke, starrt ein paar Sekunden auf Ellis Island: »Das weiß ich auch, Don. Aber ich will das ganze System auf Herz und Nieren prüfen. Ich habe ihr erst einmal fünf Milliarden Dollar mit erstklassiger Besicherung freigegeben. Okay?«
»Einverstanden, und jetzt ist erst mal Break angesagt, genieße Zermatt, spann zwei Wochen aus. Danach sehen wir weiter, wenn dein Stresstest gelaufen ist, okay?«
Kramer ist ein erstklassiger Vorstandsvorsitzender, weil er Amerikaner ist und gleichzeitig die Europäer versteht, schließlich hatte er viel Zeit in Europa verbracht, die Sitten und Gebräuche kennen gelernt und in den dort geltenden Strukturen gearbeitet. Zudem kennt er sowohl die Bedürfnisse der Industriekunden als auch das klassische Kreditgeschäft.
Nicht ausreichend sattelfest hingegen fühlt er sich im Kapitalmarktbereich, die Welt des Mitch Lehman. Deshalb hat Don seinen Traineekollegen Carl in den Vorstand der Bank geholt. Don weiß, wie gewissenhaft Carl ist, und dass er sich auf seinen alten Freund verlassen kann.
Die Carolina Bank spielt eine Sonderrolle unter den großen Namen an der Wall Street, da sie im Prinzip zwei Banktypen unter einem Dach vereint. Die klassische Commercialbank, die das Kredit-, Vermögensverwaltungs-, Firmen- und Privatkundengeschäft betreibt, sowie eine hochmoderne Investmentbank mit Unternehmensfinanzierungen und vor allem Kapitalmarkthandelsgeschäft. Während die Commercialbank in New York ihr Domizil hat, ist London Sitz der Investmentbank.
Die Chefs der Teilbereiche sitzen gemeinsam mit Kramer als Chief Executive Officer, Carl als Chief Risk Officer und zwei weiteren Verantwortlichen für Finanzen und Strategie im Vorstand der Dachgesellschaft, die von New York aus gesteuert wird. Kramer muss zwischen den Fürsten ausgleichen, Carl unter ihnen das Gesamtrisiko der Bank aufteilen. Da Lehman seit Jahren das meiste Geld für die Bank verdient, gilt er als die große, unantastbare Nummer im Vorstand.
Die Carolina Bank ist so etwas wie eine Deutsche Bank, eine UBS oder Credit Suisse, die alle neben der Commercialbank ein starkes Investmentbanking aufgebaut haben. Die Namen dieser Banken werden inzwischen in einem Atemzug mit den großen Bulge Brackets genannt: Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Lehman Brothers oder auch Bear Stearns, die jedoch reine Investmentbanken geblieben sind. Und alle liefern sich ein Rennen um die besten Leute und die höchste Rendite.
Intern konnte Kramer die unterschiedlichsten Typen Zusammenhalten und zum Wohle der Bank arbeiten lassen. Wie er gerade scherzend mit einigen Spitzenbankern auf das vergangene Geschäftsjahr anstößt, Lob ausspricht und sich bedankt – das war Don at his best. Carl Bensien beobachtet seinen Freund mit alter Zuneigung und neuer Beunruhigung. Er hat bei Kramer Veränderungen bemerkt, die ihm nicht gefallen. Don ist in letzter Zeit gierig geworden. Er lässt Leute wie Mitch Lehman immer ungehinderter gewähren.
»Home Suite«
Während Kramer und Bensien in New York den Abend mit Händeschütteln und Weihnachtswünschen verbringen, macht sich Robert Pearson in London nächtens auf die Suche nach Mitch Lehman. Da der General nie viel schläft, konnte er auch weit nach Mitternacht noch nach ihm suchen. Bei derCarolina Bank arbeitet Pearson in erster Linie für Lehman persönlich. Mitch als sein Auftraggeber sollte es um alles in der Welt auch noch möglichst lange bleiben.
Natürlich könnte, ja müsste der General mit ihm zufrieden sein, wenn er rational über die Arbeit seines Beraters nachdenkt. Robert Pearson hilft, Deals zu schieben oder zu bremsen, er kennt alle relevanten Personen und sämtliche Tricks in der Branche. Er kann Leute anschwärzen, die Lehman im Wege stehen, oder Themen in Zeitungen heben, die diesem dienlich sind.
Doch Lehman reagiert häufig impulsiv, rastet völlig aus, wenn etwas gegen seine Linie läuft. Der General hat, wie Pearson schon oft erfahren musste, eine sehr einfache Art, das Leben zu betrachten: Erst kommt Lehman und sein big Ego mit seinen big Balls, dann kommt Lehman und sein big Bonus und dann kommt Lehman und seine big Girls, wie er seine Gespielinnen nennt. Small kommt in Lehmans Welt nicht vor.
Erst danach sind die anderen an der Reihe, und Robert Pearson steht recht weit unten auf Mitch Lehmans Skala. Geht etwas schief, sind stets die anderen schuld. Und die Blauen-Bändchen-Nutten würde Robert ausbaden müssen, auch wenn er nur ausführendes Organ gewesen ist. Um zu verhindern, dass Lehman völlig ausrastet, geht Pearson lieber in die Offensive und sucht seinen wichtigsten Kunden. Denn das Geschäft will er unter keinen Umständen aufs Spiel setzen – enttarnte Nutten mit blauen Bändchen hin oder her.
Nachdem er Carla Bell zumindest für den Moment ruhiggestellt hat, macht er sich auf einen schweren Gang, wie ihm schwant. Es nützt ja nichts, dass das Ganze die Idee seines Auftraggebers gewesen ist. Pearson selbst hat die Nutten organisiert und rechnet sie unauffällig ab. Der General wollte seinen Jungs mal wieder etwas Besonderes bieten.
Nachdem er Lehman nicht bei seinen Obristen findet, ist eigentlich klar, wo dieser steckt: in seiner luxuriösen »Home Suite«; sie gehört natürlich nicht zu den zwanzig kleinerenSuiten, die von Robert für die Dienste der Escorts angemietet wurden.
Roberts Agentur heißt Pearson Advisors, er hat die beiden Buchstaben »PA« in Anführungszeichen als Logo gewählt, um auch seine Rolle als Personal Advisor, als persönlicher Berater seiner Herren unter Beweis zu stellen. Dass man auch Sekretärinnen, die Personal Assistants, in ihrer Kurzform »my PA« nennt, stört ihn nicht – im Gegenteil: Er hat sich zu einer dienstbaren Größe hochgearbeitet, die seinen Auftraggebern eine Menge abnimmt, worum sie sich nicht kümmern wollen. Wenn Lehman eine Notiz an ihn weiterleitet, schreibt er immer PA daran, ohne Gänsefüßchen, um Robert zu ärgern und auf eine Stufe mit seiner Hauptsekretärin zu stellen.
Seine eigene Firma hat Pearson vor über fünfzehn Jahren eröffnet, für Lehman arbeitet er seit gut fünf Jahren. Mitch Lehman mag zwar keine PR-Fuzzis, aber die skrupellose Vorgehensweise von Robert Pearson weiß er immer für sich auszunutzen. Erst vor ein paar Wochen hat Lehman den Vertrag um weitere fünf Jahre verlängert, ausgestattet mit einem dicken siebenstelligen Jahreshonorar.
Robert Pearson schlurft mit hängenden Schultern über den Gang zur »Home Suite« und klopft an der Tür.
»Hallo, Robert«, linst eine Frau mit verwuselten Haaren, aber wachem Blick hinter der Türe hervor, ehe sie ihm öffnet. Pearson zählt zu den Leuten mit nahezu unbeschränktem Zugang zu Lehman. Diana hat wohl schon gearbeitet, sonst trüge sie keinen Bademantel ohne etwas darunter, wie Pearsons Kennerblick feststellt.
Lehman hat ein Faible für die vierzigjährige gertenschlanke Brünette; eigentlich ist sie für eine Highend-Escorte, die fünfzehntausend Dollar pro Nacht kostet, zu alt. Der General bedient sich ihrer Leistungen schon sehr lange, und sie weiß, wie sie mit ihm umzugehen hat.
Und Diana hält sich fit: viel Sport, gesundes Essen, nur wenig Alkohol. Robert Pearson hatte sie schon mehrfach heimlich den Champagner ausschütten sehen, wenn sie sich unbeobachtet fühlte. In diesem Gewerbe konnte man nur erfolgreich überleben, wenn man sich ständig unter Kontrolle hatte.
Diana flätzt sich auf das Sofa vor dem lodernden Kamin in dem großen Wohnzimmer, von dem die anderen Räume abgehen: Schlafzimmer, Bad, ein Arbeitszimmer und der kleine Vorraum in Richtung Eingangstür. Im Ganzen misst die Suite sicher hundertfünfzig Quadratmeter.
»Du musst warten«, grinst sie und zeigt mit dem Daumen nach hinten auf die geschlossene Schlafzimmertüre, aus der unmissverständliche Geräusche dringen.
»Kann wohl nicht mehr lange dauern?«
»Camilla ist zäh, Robert«, antwortet sie trocken.
»Mitch auch«, gibt Robert zu bedenken.
»Die langen Nummern schiebt immer sie, wenn wir es drehen können. Sie kriegt ihn eher müde als ich. Setze dich lieber.«
»Solange kann er doch noch gar nicht hier sein. Ich habe ihn noch vor einer halben Stunde unten gesehen.«
Diana lächelt nur vielsagend. Robert nimmt ihr gegenüber Platz. Er und Diana kennen sich fast so lange, wie er für Mitch arbeitet. Sie war damals schon in seinen Diensten, während die junge Camilla erst vor zwei, drei Jahren dazukam. Diana hatte sie Mitch bei einem Dreier vorgestellt, als sie merkte, dass er etwas Abwechslung gebrauchen konnte. – Sie wusste, dass er gleich anbeißen würde. Nun kassiert sie von Camilla zwanzig Prozent Provision, muss selbst aber im Schnitt nur noch zur Hälfte ran. Ökonomisch betrachtet eine saubere Nummer für sie.
Seit dieser Zeit haben die Gespräche zwischen Diana und Robert einen vertraulichen Charakter, weil sie manches Mal gemeinsam auf Mitch und Camilla warten müssen. Mitch amüsiert sich immer nur mit seinen beiden big Girls, die ausschließlich ihm zu Diensten stehen. Teilen ist ihm verhasst, es erinnert ihn stets an die Zeit, in der er noch arm war und in L. A. mit Opferstöcken, Autos und Damen dealen musste.
Es macht ihm auch nichts aus, für sein Vergnügen zu zahlen, diese wenigen hunderttausend Dollar, die er dafür im Jahr braucht, fallen bei seinem Gehalt kaum ins Gewicht.
Pearson weiß, dass nahezu alle Obristen ein Doppel- bis Mehrfachleben führen. Die meisten Ehefrauen ahnen es, halten jedoch still und geben das Geld der Männer mit vollen Händen aus. Allerdings verhält sich niemand so dreist wie Lehman. Manches Mal darf sogar einer seiner höheren Offiziere eine Nacht mit Diana verbringen. Das betrachtet Lehman nicht als teilen, sondern als zuteilen. Ein feiner Unterschied für das big Ego des Generals.
Das gilt allerdings nicht für Pearson – schließlich ist er nur ein PA. Robert delektiert sich auch an käuflichen Damen, doch hält er Abstand zu allen, die seinem Boss gefallen könnten. Er ist viel zu gewieft, um die Dinge zu vermischen. Und auf diese Art und Weise haben Diana und er eine gemeinsame Agenda: Mitch zufriedenzustellen.
Die Jüngere ist Mitchs ganz persönliches »Eigentum«: Wer es wagt, das blonde Gift Camilla zu genau anzugucken, läuft Gefahr, von ihm exekutiert zu werden. Und wen Mitch verstößt, der sollte sich in seinem Machtbereich nicht mehr blicken lassen.
Lehman benutzt immer diese Suite, seine »Home Suite«, wenn er im »Grosvernor« seine Entspannung sucht. Er lacht selbst am meisten über sein Wortspiel: Home Suite home. Hier steht sein trautes Heim, sein Glück allein, sein Zuhause. Ein Kapitalmarktsöldner wie er besitzt kein Heim, sondern nur viele Häuser. Man findet sich überall und jederzeit zurecht, Luxussuiten sehen alle gleich aus: Kamin, Sitzecke, Esstisch, an den Wänden Reproduktionen berühmter Gemälde, großer TV hinter einer Holzwand, abgetrennte Schlafräume. Für Lehman werden stets Bloomberg-Terminals mit den Kursentwicklungen und der Nachrichtenlage am Kapitalmarkt in die Zimmer gestellt. Selbst ins Schlafzimmer.
Als Mitch aus dem Schlafzimmer kommt, springt Robert auf. Der General blickt mürrisch auf seinen Parasiten: »Wurde auch langsam Zeit, ich habe schon auf dich gewartet. Die kleine Bell trägt ein blaues Bändchen, Robert. Was zieht die hier für eine Nummer ab?«
»Ich musste sie erst beruhigen. Die Idee mit den Escorts ist aufgeflogen.«
»Was soll das heißen?«, fragt Lehman überrascht, der sich mit einem Glas Champagner zu Diana auf die Couch legt. Sein rotblonder Schopf, sonst immer glatt nach hinten gegelt, ist mächtig aus der Form geraten, die Haare stehen seitlich ab.
»Sie trug dummerweise selbst so ein blaues Band, hatte ein ähnliches Kleid an und stand in der ausgemachten Ecke. Und einer deiner Banker hat sie angebaggert. Eine ziemlich dämliche Summe von Zufällen!«
Mitch betrachtet Robert grimmig und zischt: »Na, das war ja eine tolle Empfehlung! Und was rätst du jetzt?«
»Wie gesagt, ich habe sie erst mal beruhigt und mich für morgen mit ihr im Büro des ›CityView‹ verabredet. Ich werde gutes Infofutter einsetzen, um sie ruhig zu halten.«
Robert steht wie ein Schuljunge vor ihm, während Mitch breitbeinig und stirnrunzelnd auf dem Sofa sitzt.
»Wer hatte auch die blöde Idee mit den Nutten?« Mitch starrt Robert mit seinen stechenden blauen Augen an.
»Es hilft uns nichts. Wir haben ein Problem. Aber ich kriege das schon hin«, gibt Pearson lieber vorsichtig zu bedenken, als sich auf diese Frage einzulassen.
»Können wir sie bestechen, mein lieber PR-Berater?«, fragt Mitch. Wenn er ›mein lieber PR-Berater‹ sagt, ist höchste Alarmstufe angesagt. Lehman ist der Meinung, dass man Journalisten mit ihren mickrigen Gehältern mit ein paar Dollar bestechen kann. Das jedoch hat ihm Pearson über die Jahre ausgeredet.
»Du behauptest doch immer, dass wir ihnen nur ein paar Infos rüberschieben müssen, damit sie dafür andere Geschichten fallen lassen. Also, dann mach mal.« Mitch richtet seinen Blick fordernd auf Robert. »Wenn du das Problem nicht löst, gibt es Ärger«, droht Mitch unverhohlen. »Lass dir was einfallen, aber auf keinen Fall will ich diese Geschichte irgendwo lesen. Habe ich mich klar genug ausgedrückt?« Lehman tippt mit seinem Zeigefinger wie mit einer Pistole auf Roberts Brust, um seiner Aussage Nachdruck zu verleihen. Robert kennt das, Mitch setzt solche Zeichen der Unterdrückung auch bei seinen Obristen immer wieder ein.
Pearson nickt, und als sich Lehman wieder in Richtung Schlafzimmer aufmacht, weiß er, dass seine Audienz vorbei ist.
»Bring das in Ordnung«, befiehlt der General noch über die Schulter, »sonst lass ich dich filetieren.«
Sogleich verzieht sich Pearson nach unten an die Red Bar; inzwischen ist es weit nach Mitternacht und er genehmigt sich noch einige Drinks, ehe er sich in sein kleines Zimmer im »Grosvernor House« ziemlich betrunken ins Bett begibt. Die Angelegenheit liegt ihm schwer im Magen. Lehman handelt immer eigenständig, er lässt sich auch in keiner Weise in den Verhaltenskodex der Bank einbinden, wie Pearson mehrfach bemerkt hat. Wer »unter ihm« Vorstandschef ist, interessiert Lehman nicht im Geringsten. Einzig vor Don Kramer zeigt Lehman ein wenig Respekt, das hat Pearson in den drei Jahren des Öfteren bemerkt. »DFK« hinterlässt alleine durch seine Statur Eindruck auf Mitch Pieter Lehman.
Typen wie Lehman lassen sich nur schwer zähmen. Seine Handelsabteilung ist so etwas wie der Staat im Staate der Carolina Bank. Doch selbst Mitch Lehman anerkennt, dass es ein paar Grenzen gibt, die er besser nicht überschreiten sollte. Zwar kann er sich in der Carolina Bank fast alles erlauben, weil er Milliarden Dollar für die Bank verdient, aber Nutten auf der offiziellen Weihnachtsfeier und auf Firmenkosten würden auch ihn in arge Erklärungsnot bringen. So etwas hasst der General.
Pearson ist klar, dass Lehman mit der Bestellung der Nutten ein hohes Risiko eingegangen ist. Und es ist wie im richtigen Leben: Das Risiko bleibt bestehen, nur trägt es jemand anderes. Jeder in der Branche weiß, dass Robert Mitchs »PA« ist.
»City View«
Gut gelaunt und für ihre Verhältnisse ausnehmend ausgeschlafen kommt Carla Bell in die Redaktion. Einer der großen Vorteile des Journalismus besteht aus ihrer Sicht in der Tatsache, dass man morgens nicht ganz so früh aufstehen muss. Carla ist alles andere als ein early Bird, sie trudelt, wie fast jeden Morgen, um kurz nach neun Uhr – andere würden sagen: kurz vor halb zehn – in der etwas heruntergekommenen, aber gemütlichen Redaktion ein. Simon hat es aufgegeben, Carla Pünktlichkeit nahezulegen, denn sie ist diejenige, die immer mit am Längsten in der Redaktion bleibt und ausgezeichnete Arbeit liefert.
»Guten Morgen, Annabelle«, trällert sie in Richtung Sekretariat, wo »die Chefin«, wie sie von allen genannt wird, im Eingangsbereich thront. Ein Eindruck, der sich durchaus auch wegen ihres rundlichen Körpers ergibt, der in einem extragroßen, alten Schreibtischstuhl Platz findet.
»Oh, so gut gelaunt heute Morgen, junge Dame.« Annabelle ist »die Mutter der Kompanie«, und gerade in dieser Rolle gibt sie die strenge Mutter für die Redakteure und eine fürsorgliche Mama für die Mädchen in der Redaktion. Da Carla derzeit jedoch die einzige junge Frau im Team ist, hat Annabelle somit viel Zeit, ihr Augenmerk auf die Kleine zu richten, die so schnell Karriere macht. Dass sie Simon geschickt um den Finger wickeln kann, ist Annabelle nicht entgangen.
Carlas gute Laune hat vor allem mit der Vorfreude zu tun, dass sie eine echt gute Story an der Hand hat – aber das kann Annabelle ja nicht wissen. Robert Pearson würde heute Morgen die Story bestätigen müssen, was Simon garantiert mit einem seiner seltenen »Großartig« kommentieren würde; der Chefredakteur zählt eindeutig nicht zu den Freunden der Carolina-Banker. Seiner Ansicht nach fehlt den Carolinern der britische Stil noch mehr als anderen modernen Investmentbanken.
Nichts war übrig geblieben von den alten Merchant Banks, die das Leben in der City noch in den Achtzigerjahren geprägt hatten, die Zeit, in der Simon Trent als Journalist angefangen hatte.
Die Carolina Bank, besonders ihre Spitzenkräfte im Londoner Handel, sind für Simons Geschmack viel zu aufgeblasen, zu amerikanisch. Nicht selten lässt er das die jungen Leute wissen. Simon Trent ist ein echter »Oxbridge-Bürger«, einer aus der Kaste, die in Eton und den Universitäten von Oxford oder Cambridge ihre Ausbildung genossen haben. Dort lernt man nicht nur ein Fach, sondern erhält Haltung für das ganze Leben – eine grundnatürliche Arroganz, die etwas näselnde Stimme eingeschlossen. Diesen Tonfall konnte man gar nicht hervorbringen, wenn man wie Carla Bell in Hertfordshire aufgewachsen und in staatliche Schulen und Universitäten gegangen war.
Anders als viele andere Oxbridge-Boys hat Simon Trent keinen Dünkel und kommt gut mit Leuten unterschiedlichster Couleur und Schichten zurecht. Im Journalismus bleibt ihm auch gar nichts anderes übrig, wollte man gute junge, hungrige Leute finden. An Carla Bell hat er von Anbeginn einen Narren gefressen, wohl auch, weil sie so eine auffallend kritische Haltung gegenüber Bankern an den Tag legt. Er weiß zwar nicht warum, aber das schafft die Distanz, die Trent als Grundlage für seriöse journalistische Arbeit betrachtet. »Bleibt dran«, feuert er seine Leute des Öfteren an, »aber lasst euch nicht vereinnahmen!« – auf diesen Zusatz kann man fast wetten.
Der Chefredakteur steht am Kaffeeautomaten des »CityView« im geräumigen Eingangsbereich der Redaktion und begrüßt sie: »Guten Morgen, Carla. Ich schätze, du hattest einen amüsanten Abend?«
»Morgen, Chef. Geht so, aber ich habe da eine Sache gehört, über die wir unbedingt reden müssen.«
»Schön, ich muss erst noch telefonieren, sehe dich später. Übrigens: Du siehst müde aus, Mädchen«, dröhnt er und lässt sie stehen. Dabei fühlt sich Carla heute ausgesprochen fit; es sind wohl die ganzen letzten Wochen, die man einfach morgens nicht aus dem Gesicht geschminkt bekommt.
Trent nimmt kein Blatt vor den Mund, schon äußerlich ein echter Bulle, der den schmalen Gang beinahe von Wand zu Wand ausfüllt und mit dem man keinen Ärger haben will; er kann schnaufen und brüllen, wenn ihm eine Geschichte nicht gefällt. Dann streicht er sich mit den Händen durchs Haar und zerzaust seine zurückgekämmte Frisur, die ansonsten durch seine Lesebrille gebändigt wird. Ohne seine klassischen englischen Anzüge, die immer etwas abgewetzt sind, würde er glatt als Möbelpacker durchgehen. Seine Sprache verrät jedoch den englischen Bourgeois, allerdings zählt seine Familie nicht zu den Begüterten der englischen Oberklasse.
Simon Trent und sein »CityView« passen auch äußerlich gesehen perfekt zusammen. Das ganze Mobiliar ist abgenutzt und gebraucht. Alles deutet daraufhin, dass es sich hier nicht um eine gut verdienende Agentur, Sozietät, Bank oder gar große Zeitung handelt. An diesem Orte pflegt man jedoch die alte englische Journalistenkunst, die sich auf der East Side der Themse kaum mehr finden lässt. Hart, aber fair, bissig, wenn es sein muss, jedoch nie persönlich verletzend, vor allem aber sauber recherchiert – so lautet das journalistische Credo des Chefs, das er wie ein Mantra allen Neuen und ab und zu auch den alteingesessenen Redakteuren vorbetet.
Der »CityView« beschäftigt neben Herausgeber, Chefredakteur und Geschäftsführer – Simon Trent in Personalunion – neun fest angestellte Redakteure und arbeitet ansonsten mit einem großen Pulk an Freelancern. Trent besitzt ein Auge für die richtigen Leute, sodass der »CityView« journalistisch recht erfolgreich ist. Letztendlich fehlt es jedoch an genügend Abonnenten- und Anzeigenkunden, um einen zuverlässigen Gewinn abzuwerfen. Doch in guten Jahren wie 2006 fällt auch für den Newsletter etwas vom großen Kuchen ab, der in der City verteilt wird.
Denn die Banker mögen solche Newsletter. Sie sind für den News Flow in der City von großer Bedeutung, zumal die alles überragende »Financial Times« und die nationalen Tageszeitungen wie die »Times« oder der »Telegraf« das Raunen in den Handelshäusern gar nicht abdecken können. Mit dieser Eitelkeit spielt Trent, obwohl er die neuen, die amerikanisierten Banker nicht leiden kann. Der »CityView« ist keineswegs ein Klatschblättchen. Trent verfolgt einen hohen Anspruch und ist immer wieder gut für eine exklusive Geschichte. Ihm gelangen bereits einige Scoops, die ihm von einer seiner gut geschützten Quellen zugesteckt worden waren.
»Simon, eines noch. Robert Pearson kommt um zwölf Uhr«, ruft Carla ihm hinterher, als er schon fast in Richtung seines Büros verschwunden ist. Trent dreht sich noch einmal um, wenn Pearson persönlich erscheint, muss es sich tatsächlich um eine wichtige Angelegenheit handeln.
»Was will der denn hier?«
»Das erzähle ich später«, entgegnet Carla, die ihre »Verwechslung« nicht gerade auf dem Flur zum Besten geben will und ihr Gesicht wie ein kleines ertapptes Mädchen verzieht.
Simon Trent und Robert Pearson kennen sich seit den Achtzigerjahren. Viele Jahre lagen sie im journalistischen Schützengraben – der eine bei Reuters, der andere bei Bloomberg – und beackerten häufig genau dasselbe Thema für ihre jeweiligen Brötchengeber. Damals konnten Konkurrenten noch Kollegen sein, nach getaner Arbeit sogar zusammen einen heben. Das hatten beide zur Genüge getan. Auch wenn sie vom Naturell her sehr unterschiedlich waren, hatte sich über die Jahre so etwas wie Freundschaft zwischen Pearson und Trent entwickelt, zumal sie auch noch an derselben Universität studiert hatten. Oxford, of course!, so hieß ihre Alumni-Vereinigung. Immer wenn einer der Alumnis einen Schritt auf der Karriereleiter in der City nach oben machte, gab das eine schöne kleine Personalnachricht im »CityView«.
Simon Trent ist immer Journalist geblieben und lebt aus tiefster innerer Überzeugung die Aufgabe der viertenGewalt der Medien im Staate. Vor einigen Jahren hat er sich mit seinem »CityView« selbstständig gemacht und sich einen Kindheitstraum erfüllt. Der Newsletter, wenn auch finanziell notorisch schwach auf der Brust, genießt hohen Respekt.
Robert Pearson dagegen hatte vor zwanzig Jahren die Seiten des Schreibtischs gewechselt und bei einer PR-Agentur angeheuert. Nach fünf Jahren gründete er seine Agentur »PA«. Robert hatte anständig angefangen, aber er lernte schnell – heute ist er skrupellos. Während Simon stets an das Gute glaubt, so glaubt Robert inzwischen nur noch ans Geld.
»Okay, Carla«, zieht er das Okay fragend in die Länge. »Das muss ja wirklich etwas Besonderes sein, wenn sich Robert persönlich hierher bemüht. Hast du einen Fisch an Land gezogen?«
»Ja, ist aber nichts für den Flur«, beendet sie das Thema und verzieht dabei erneut das Gesicht, was Simon mit einem anerkennenden Lächeln quittiert.
Carla ist ein Ass in komplizierten Kapitalmarktthemen – vor allem in jenen, die sich mit strukturierten Finanzierungen beschäftigen. Mit ihrem Background in Mathematik und Physik sind ihr diese komplexen Systeme vertraut. Das hilft, wenn man mit den »Strukkis« reden muss. In den Abteilungen für strukturierte Produkte arbeiten keine Banker, sondern hauptsächlich Physiker oder Mathematiker, die zwar rechnen, aber keine Kredite vergeben können.
»Bis gleich. Gute Geschichte, die du gestern noch geschrieben hast«, ruft er und verschwindet dann endgültig in seinem Büro. Carla hat Simon die Hintergrundstory über einen solchen »Strukki« geliefert, der jüngst eine der spektakulärsten Transaktionen durchgezogen hat.
Die Rubrik »The Man behind the Deal« ist so etwas wie die Klatschkolumne im »CityView«. Banker sehen sich nur zu gern dort porträtiert, auch wenn dies keiner zugibt. Solche Storys heben das Image, vor allem laufen die anderen Banker diesen Stars hinterher. Setzt einer der Stars auf eine bestimmte Markttendenz, folgen häufig die anderen wie dieLemminge. Trader leben von ihrem Starkult. Sie tun gerne so, als könnten sie in die Zukunft schauen und wüssten besser als andere, wie der Markt sich entwickelt. Und Carla konnte persönliche Dinge und Fakten gut miteinander verweben.
Um Punkt zwölf Uhr steht der lange Schlacks an der Türe, grüßt die »Chefin« ausnehmend freundlich, was Annabelle schmeichelt. Man sieht Pearson allerdings an, dass er nur wenig und wohl schlecht geschlafen hat. Mit Schwung reißt Simon Trent seine Türe auf, legt Annabelle ein Manuskript auf den Tisch und empfängt Robert mit einer umständlichen ironischen Verbeugung.
»Carla hat mir bereits berichtet, dass Mr Robert Pearson heute Morgen persönlich auftauchen würde«, begrüßt Simon seinen alten Buddy und stapft mit ihm weiter in Richtung Kaffeemaschine.
»Guten Morgen, großer Chefredakteur.« Robert schaut verblüfft, Simon hat er an diesem Morgen definitiv nicht in der Redaktion erwartet, weil sich die Chefredakteure aller Zeitungen in der City am letzten Arbeitstag vor Weihnachten immer in einem Pub an der Liverpool Street Station treffen.
»Noch nicht beim Editors Drink, Simon?«, fragt Robert, denn die Chefredakteure treffen sich eigentlich immer gleich um zwölf Uhr mittags, wenn die Pubs öffnen.
»Doch, doch. Ich gehe nur etwas später, sonst trinke ich wieder zu viel. Und wenn du schon mal hier bist, sollte ich mich als Chefredakteur vielleicht mit euch zusammensetzen, oder? Carla kann man doch noch nicht auf so einen wie dich alleine loslassen«, grinst Simon. »Worum geht es denn? Für 'ne kleine Sache kommst du doch nicht selbst.«
In diesem Moment weiß Robert, dass dieser Tag ziemlich beschissen verlaufen würde. Wenn er nun auch noch Simon davon überzeugen muss, die Nuttengeschichte zu tilgen, stehen seine Chancen ziemlich mies.
»Was macht Cecilia?«
»Danke der Nachfrage«, antwortet Simon. »Der Familie geht es insgesamt gut und Cecilia ebenso.« Simon reichtRobert mit einem »den kannst du gebrauchen« einen Kaffee im Plastikbecher; der nächste Kaffee läuft bereits aus der Maschine. Als einer der jüngeren Redakteure zu ihm kommt, um ihn etwas zu fragen, ist er abgelenkt. Robert nutzt die Gelegenheit sofort für ein schnelles Telefonat. Er dreht sich um und geht noch einmal in Richtung Eingangstür. Gut, dass Annabelle gerade nicht auf ihrem Platz thront, sondern im hinteren Teil in irgendwelchen Schränken kramt.
Pearson weiß in extremen Situationen rasch zu handeln. Simon würde niemals davon zu überzeugen sein, die Nuttengeschichte fallen zu lassen, zumal es sich um die Carolina Bank handelt, die ihm schon seit Jahren ein Dorn im Auge ist. Simon Trent ist durch und durch ein überzeugter Vertreter der alten englischen Schule, korrekt bis auf die Knochen – ein typischer Etonian, was Robert zu seinem großen Bedauern nicht ist. Man kann die Etonians sehr gut daran erkennen, dass sie in jeden dritten Satz lateinische Wörter einbauen. »Prima facie« ist Simons Lieblingslateiner, »bis auf Widerruf«. Selbstredend hatte sich Robert das antrainiert.
Robert wählt hastig die Nummer von Sir Peter Cane, dem Kommunikationsdirektor der Bank of England, auch ein Kommilitone. Cane kann es sich im extrem teuren London leisten, »nur« bei der Bank of England für ein Beamtengehalt zu arbeiten. Sir Peter zählt zu den Spezies Sohn alter Aristokratenfamilien, die »never even started to work for money«. Flugs wird er durchgestellt.
»Peter, tue mir bitte einen Gefallen und rufe jetzt sofort Simon Trent an und verwickle ihn für ein paar Minuten in ein Gespräch. Du hast einen gut bei mir, wenn dir das gelingt, aber ich kann Simon jetzt gerade nicht gebrauchen.«
»Na, du hast es aber eilig«, murrt der überrumpelte Sir.
»Peter, wie oft brauchst du mich mal eben schnell?«, gibt Robert zu bedenken.
»Okay, Robert«, antwortet Cane. Da sich die beiden schon mehrfach die Bälle zugespielt haben, fragt Sir Peter nicht weiter nach.
Indessen ist Carla Bell aus ihrem kleinen Kabuff hervorgekommen und grüßt Robert Pearson vergleichsweise herzlich.
»Guten Morgen, Robert. Danke noch einmal, dass Sie und Mr Lehman mich aufgefangen und mir nicht noch mehr Alkohol eingeflößt haben. Das würde meine Arbeitskraft heute sicherlich schmälern. Und wir produzieren schließlich für die Ausgabe zwischen den Jahren.« Sie fängt jede Unterhaltung stets mit freundlichem Small Talk an, wenn sie weiß, dass die folgenden Themen unangenehmer würden.
Carla führt Robert in Richtung Besprechungsraum: »Simon möchte sich zu uns gesellen, damit wir die Geschichte von gestern besprechen können.«
»Weiß er, worum es geht?«, versucht Robert die Ausgangslage zu klären.
»Ich habe ihm noch nichts erzählt.«
Gott sei Dank, denkt Robert, als Simon auf dem Weg ist zum kleinen stickigen Besprechungsraum ohne Fenster und funzeligem Neonlicht. Robert, innerlich nervös zitternd, ist äußerlich ganz Prinz Charming. Erst als Simon bereits die Klinke der Türe drückt, hört er die rettende Stimme von Annabelle.
»Simon, kannst du noch schnell Sir Peter nehmen«, trällert sie über den ganzen Flur.
Der verzieht das Gesicht, doch da er später zum Editors Drink will, ist es wohl besser, noch schnell zu telefonieren.
»Fangt schon mal ohne mich an, Cane will wohl über die letzte Notenbanksitzung mit mir plaudern.«
Glück gehabt, seufzt Robert. So ein Mist, denkt Carla; ihr ist Simons Verschwinden alles andere als recht, aber sie kann nichts daran ändern. Robert gehört nicht zu denjenigen, die man warten lassen sollte, außerdem hat sie alle Karten in der Hand. Sie nehmen Platz, und da für Robert die Zeit drängt, kommt er lieber gleich zur Sache: »Das mit den Nutten ist eine Privatangelegenheit der jungen Leute gewesen und nichts, was Sie erstens beweisen können und zweitens schreiben sollten. Lassen Sie das!«
»Kein Small Talk?« Carla weiß natürlich, dass Robert recht hat, sie kann die Sache mit der Rothaarigen auf der Toilette oder mit dem jungen anbaggernden Banker nicht mit harten Fakten untermauern.
»Ich würde das gerne schnell klären, Carla. Die Sache ist mir und meinem Mandanten sehr unangenehm, aber eben eine Privatsache.« Er schaut sie mit vor sich auf dem Tisch gefalteten Händen an. Imagemodul »gütiger Pfarrer«, wie es sich Robert auf der Herfahrt vorgenommen hat. Im Laufe der Jahre hat er sich eine ganze Reihe solcher Imagemodule gebastelt und kann sie nach Belieben und Notwendigkeit aus dem Hut zaubern: harter Hund, einfühlsamer Journalistenversteher und noch ein paar Rollen mehr.
»Eine der Prostituierten hat mir ihre Nummer gegeben. Ich kann sie jederzeit anrufen und mit ›sources close to the situation‹ zitieren. Robert, das geht zu weit! Wo kommen wir denn hin, wenn zu Weihnachtsfeiern die leichten Damen neben dem schweren Nikolaus stehen. Das ist doch keine Privatsache!«
Carla blufft, wie sie es bei Simon gelernt hat. Aber Robert vermag nicht genau einzuschätzen, ob sie tatsächlich nur blufft. Er realisiert, dass sie nicht so leicht klein beigeben würde. Die Lady scheint deutlich raffinierter zu sein, als ihr noch junges Aussehen vermuten lässt. Aber er wäre nicht »PA«, könnte er nicht zulegen. Die beiden schauen sich im fensterlosen Besprechungszimmer in die Augen:
»Nutten geben Frauen keine Telefonnummern. Ich kenne mich da aus. Das glaube ich Ihnen nicht, junge Dame«, lächelt er.
»Vergessen Sie nicht, Robert: Ich war für die zum Verwechseln ähnlich, quasi eine von ihnen«, antwortet sie und legt den Kopf mit ihrem »Carla-Bell-Ich-will-was-von-dir-Lächeln« zur Seite. Zur Bestätigung zieht sie den Pullover am rechten Arm etwas hoch und hält Robert das blaue Bändchen hin.
»Okay. Let's cut a deal«, knickt Pearson unter Zeitdruck ein. »Damit diese Geschichte nicht erscheint. Sie hat nichts mit dem Geschäft der Bank zu tun, aber sie wäre für alle Beteiligten sehr peinlich, nicht wahr? Auch für Sie Carla, denn Sie wollen doch sicherlich nicht in einer anderen Zeitung lesen, mit einer Nutte verwechselt worden zu sein.«
Carla fällt etwas in ihrem Stuhl zurück und schnappt nach Luft. Daran hat sie nicht gedacht. Robert würde die Sache im Falle eines Falles natürlich streuen. Und einer würde es sicher veröffentlichen; dafür hat Robert zu viele Eine-Hand-wäscht-die-andere-Nummern parat.
Nun ist auch Carla klar, dass Robert nicht klein beigeben würde. Gleichzeitig riecht sie ihre Chance, sie wollte schon lange auf seiner »preferred list« von Kontakten ganz nach oben klettern. Wollte sie wirklich tief in das System der Banker eindringen, so brauchte sie den großen PR-Guru noch, wie sie es sich heute Nacht auf dem Nachhauseweg bereits überlegt hat. Mit der Veröffentlichung der Nuttengeschichte würde sie diese Chance wohl verspielen.
»Wie lautet Ihr Angebot, Robert?«
»Sie bekommen von mir demnächst einige dicke Fische. Exklusiv«, sein Blick bohrt sich in ihre Augen. »Damit werden Sie bekannt, Simon ist zufrieden und in ein paar Monaten können Sie sich aus diesem Drecksloch in Richtung einer besseren Zeitung verabschieden.«
»Nicht schlecht«, antwortet Carla ruhig, obwohl sie überrascht ist, wie abfällig er über den »CityView« spricht. Sie wägt kurz ab: »Aber eines noch, Robert. Ich will Lehman. Exklusiv. Im Januar.«
»Wieso gerade Lehman selbst?«, fragt Robert beunruhigt.
»Nur so. Wir hatten gestern wenig Zeit. Und Sie wollen doch einen Deal, oder?«
»Okay. Mache ich, Carla.«
»Done«, ruft Carla, als Simon Trent gerade den Besprechungsraum betritt.
»Sorry, aber Sir Peter plaudert halt doch meistens länger.«
Robert seufzt unhörbar in sich hinein und reißt das Gespräch an sich: »Du kommst gerade rechtzeitig. Wir haben bislang nur über gestern Abend gesprochen, Simon. Schade, dass du nicht zur Carolina kamst. Da gab es interessante Gespräche und Geschichten. Mrs Bell hat einem Banker eine aus den Rippen geschnitten.«
Robert setzt an und erzählt Simon eine ziemlich vertrauliche Geschichte über einen anstehenden Vorstandswechsel in der Hanson Bank, und zwar so, als wüsste Carla das alles schon. Er hat immer ein paar Exklusivstorys im Kopf parat, die er wie ein Info-Trader handelt. Sein Gewerbe bietet ihm exakt den Informationsvorsprung, den Journalisten heute kaum mehr durch eigenes Recherchieren erarbeiten können.
»Wieso willst du nicht, dass wir das schreiben, Robert?«, setzt Simon ahnungslos nach.
»Ganz einfach: Der Wechsel findet nur statt, weil der Platz frei wird. Und der Vorgänger kommt zur Carolina Bank. Das ist mein Kunde, und die Sache ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Ich weiß, dass du die Carolina Bank nicht magst, aber ich bitte nur um ein wenig Aufschub. Das machen wir doch nicht zum ersten Mal, Simon!«
»Aber wenn wir warten«, steigt Carla gekonnt in die gespielte Diskussion ein, »dann schreibt jemand anders die Geschichte, Robert.«
»Genauso sehe ich es auch«, fügt Simon mit Blick auf Robert an, der den beiden gegenüber sitzt. Carla analysiert blitzschnell ihre Lage. Mit dieser Information bekommt der »CityView« eine richtig gute Geschichte gesteckt, dagegen fallen die Nutten eindeutig ab, redet sie sich ein. Ist also sogar die bessere Story, versucht sie sich selbst zu überzeugen.
»Okay, aus reiner Freundschaft«, wie er noch mehrfach betont, entscheidet Simon nach kurzer Überlegung, die Sache nicht in der Ausgabe zwischen den Jahren zu bringen, da fast alle Leser während der Feiertage die City verlassen würden.
»In der ersten Ausgabe des neuen Jahres, am 8. Januar. Aber wenn ein anderer die Story vorher bringt, Pearson, dann reiß ich dir die Eier ab.«
Die Ausdrucksweise der Sprachhandwerker untereinander ist manchmal alles andere als filigran, wie Carla hat lernen müssen. Alle drei stehen auf, Carla und Robert schütteln sich die Hand, was unausgesprochen die Zusage für ihren Deal ist. Simon und Carla begleiten Robert zur Tür, der seinen Fahrer mit dem Jaguar um die Ecke warten lässt. Journalisten müssen ja nicht unbedingt sehen, wofür er das viele Geld ausgibt.
»Also, wenn du vorher noch etwas hörst, ruf uns an; denn wir haben einen Notdienst, der die fertige Geschichte von Carla ins Internet stellen kann.«
Robert verspricht, sich im Falle des Falles zu melden, und verabschiedet sich von einer zufrieden wirkenden Carla; sie würde zu einem Scoop kommen, den sie gar nicht recherchiert hat. Als Robert in den Fond seines Autos sinkt, murmelt er vor sich hin: »Noch so eine Info-Nutte!«
Der PR-Mann unterscheidet zwischen Huren und Info-Nutten. Die einen lassen sich mit Geld, die anderen mit Informationen bezahlen. Alles ist nur eine Frage des Preises. Carla Bells Preis ist hoch: Sie will sicher ein paar wirklich dicke Storys haben.
Pearson handelt nach der Maxime seines alten Professors in Oxford, der den Studenten einmal den Preismechanismus nach einer Anekdote von George Bernhard Shaw erklärt hat:
Shaw hatte eine junge Dame gefragt, ob sie mit ihm schliefe, wenn er ihr eine Million Pfund dafür zahlen würde. Die junge Dame sagte sofort zu. Als Shaw sie fragte, ob sie auch mit ihm für nur ein Pfund schlafen würde, hatte die junge Dame ihn voller Empörung angefunkelt, wofür Shaw sie eigentlich hielte. Der Dichter antwortete daraufhin: »Das haben wir schon geklärt. Wir verhandeln nur noch über den Preis, meine Liebe!« So ist es nun auch bei Carla Bell, eine mehr auf Roberts Liste.
Über die Shaw-Geschichte kann Robert noch heute lachen. Die erste Zahlung hat er soeben geleistet: Zulasten einer anderen Bank hat er eine Indiskretion begangen, um seinen besten Kunden Mitch Lehman zu retten. Ohne Skrupel.
Zufrieden mit sich und mit der Welt wählt Robert die Nummer von Mitchs Büro und wird nach längerem Warten mit ihm verbunden.
»Problem gelöst, keine Nutten in der Zeitung, dafür eine Info-Nutte mehr.«
»Gut so«, tönt es aus dem Handy, ehe es knackt und ohne »Auf Wiedersehen« tutet.
Robert will noch »Frohe Weihnachten« sagen, doch offenbar hat Lehman dafür keine Zeit.
Wie nervöse Schulbuben vor einer Prüfung sitzen die Chefobristen um den ovalen Besprechungstisch: Peter Sanders, Aktiensegment, Scott Miller, Anleihebereich, dazu deren direkte Untergebene für Handel und Neuemissionsgeschäft mit Aktien und Anleihen. Dave Wagner, Währungsbereich, und Bill Selevsky, Leiter des Rohstoffsegments, blättern in ihren Unterlagen. Mit am Tisch sitzt auch Ron Stevenson, Chef Research für den Kapitalmarktbereich. Und Isabella Davis, zuständig für den Bereich strukturierte Produkte. Jim Klein, der neue Leiter des gesamten Derivatehandels, ist zum ersten Mal dabei; er hatte bereits eine Audienz bei Mitch, von der er sich noch immer nicht ganz erholt hat.
Jim hatte sich ein paar einführende Floskeln für sein Gespräch mit dem General zurechtgelegt: »Gutes neues Jahr«, »Wie waren die Ferien?«, und dass sich sein kleiner Sohn beim Skifahren das Bein gebrochen hatte. Doch Lehman würgte jede Unterhaltung ab, fragte nur nach seiner Markteinschätzung, gab ihm seine Performanceziele gleich mit auf den Weg und interessierte sich keine Sekunde für Kleins Bedürfnis nach Austausch.
»Let's talk about money and markets«, klingt es Klein noch immer in den Ohren.
Als Mitch den smarten Jim Klein im November von der Konkurrenz zu sich holen wollte, hatte er ihn charmant umgarnt, weil er den Händler – nachweislich einer der besten Derivative-Guys – überzeugen musste, seinen gut dotierten Job aufzugeben und zu den Carolinern zu wechseln. Doch nun, einmal in seinem Team, musste er gefälligst spuren wie die anderen.
Erst als der »Stab von General Lehman« vollständig versammelt ist, geht Cindy in Mitchs Büro. Die Jalousie hat sie schon früh herabgelassen, damit Mitch vor Blicken durch die Glaswand aus dem Besprechungsraum geschützt ist. Bereits seit sieben Uhr sitzt Lehman an seinem Schreibtisch, liest wichtige Unterlagen und sichtet Zeitungen, die Cindy vorsortiert hat; Mitch hasst Ausschnittdienste, er will sich nicht von Außenstehenden vorschreiben lassen, was er zu lesen hat.
Lehmans Büro ist ein großer Glaskasten in der Ecke des riesigen Handelssaals der Carolina Bank mit einem fantastischen Blick auf die Kathedrale von St. Paul's. Auf der einen Seite seines Büros liegt sein persönlicher Besprechungsraum, in dem nun die Obristen warten, auf der anderen Seite sein persönliches Fitnessstudio. Obwohl Büroflächen zu den teuersten Gütern in der City zählen, würde es niemand wagen, Mitch Gehabe zu kritisieren.
»Mitch, acht Uhr. Alle sind da«, Cindy legt ihm die Tagesmappe für Montag, 8. Januar 2007, auf den Schreibtisch.
»Noch einen Moment«, tönt es hinter zwei aufgeklappten Din-A4-Blättern hervor.
Die Frage ist, ob die Investmentbanken auch 2007 smart genug sind, um das Risiko eines Rückschlags an den Märkten richtig zu managen und ein weiteres Rekordjahr hinzulegen, schließt der View of the Yearvon Carla Bell im »CityView«, in den Mitch gerade noch vertieft ist. Im Aufstehen markiert er auch diese Stelle.
Wie kommt diese Frau nur auf so eine Frage, denkt er und blickt auf St. Paul's. Irgendeiner der alten Merchantbanker der City, dessen Namen ihm längst entfallen ist, hat ihm einmal erzählt, dass man es in der Square Mile geschafft habe, sobald man in einem Büro mit freier Sicht auf St. Paul's residiere. Dass Mitch in einem Büro mit Blick auf das ehrwürdige Gebäude residiert, verdankt er seinem kometenhaften Aufstieg und eiskaltem Kalkül.
Seine Vorstellungen hatten dem Architekten zunächst gar nicht behagt; moderne Handelssäle werden eher in die Breite als in die Höhe angelegt, weil man für die riesigen Handelsabteilungen genügend Fläche braucht. Deshalb logieren die Händler meistens in den unteren Etagen, da dort die Gebäude großflächiger sind als in den oberen. Mitch musste kurz laut werden, bis das ganze Gebäude nach seinen Wünschen ausgerichtet wurde.
Bei der Carolina Bank in London läuft alles nach seinem persönlichen Willen. Erst kurz vor Weihnachten hatte Cindy beobachten können, wie der neue Drogenbeauftragte dies zu hören bekam.
»Willst du mich etwa feuern«, hatte Cindy Mitch durch die offene Türe grinsend sagen hören, als der junge Mann aus der Verwaltung, der gar nicht so recht wusste, wer da vor ihm stand, es wagte, Mitch darauf anzusprechen, dass im Gebäude Rauchverbot herrsche. L'état, c'est moi!, hätte er auch sagen können, dachte Cindy, als Mitch sich genüsslich eine Zigarette ansteckte und den jungen Kerl aus seinem Büro jagte.
In Mitch Lehmans Büro hängt immer der Geruch von kaltem Rauch, und es vermittelt einen kühlen, unbewohnten Eindruck. Weder Bilder noch Fotos zieren Wände oder Schreibtisch; Stapel von Studien über Marktanalysen türmen sich in einer Ecke, Auszeichnungen über erfolgreiche Deals belegen Regale und alle freien Flächen. In diesem Büro gibt es keine teure Sitzgruppe, wie sie sonst in Büros von Managern seiner Kategorie üblich ist; lediglich an der Wand rechts des Eingangs steht ein kleiner Tisch mit vier unbequemen Stühlen. Da man wegen der Klimaanlage kein Fenster öffnen kann, greift Cindy, die dort Ordnung hält, sobald Mitch das Büro verlassen hat, zum altbewährten Raumspray.
»Hast du alles für die Sitzung?«, fragt Cindy, als sich Mitch an ihr vorbei auf den Weg in den Besprechungsraum macht.
»Nicht nötig, Babe. Ich will die Jungs nur ordentlich heiß machen für das neue Jahr, nachdem sie die letzten zwei Wochen auf der faulen Haut gelegen sind.«
Mitch Lehman und Cindy Fitzpatrick funktionieren seit über zwanzig Jahren wie ein altes Ehepaar. Mitch hatCindy an jeden neuen Arbeitsplatz mitgenommen, seit er sie als seine erste Personalassistentin zugeteilt bekommen hatte. Wer zum General will, muss erst einmal an der »Prima Donna«, wie Mitch seine PA nennt, vorbei. Jeder im Handelssaal spricht die Fünfzigjährige mit dem Fransenschnitt und der getigerten Lesebrille respektvoll mit »Chefin« an. Wer ihr Missfallen erregt, lernt den eisigen Blick über den Rand ihrer Brille fürchten. Cindys irische Herkunft verrät der Zungenschlag und die roten Haare, zum Hosenanzug trägt sie flache Schuhe, damit sie Mitch nicht überragt.
Alleine schon wegen Cindys strenger Musterung schaut jeder lieber auf den Boden, wenn er an »the Master's Corner« vorbei muss. Mitch hat sich die ganze Ecke, in der sein Büro, sein Fitnessraum, ein eigener Besprechungsraum und der Vorzimmerbereich mit Cindy untergebracht sind, wie ein Quadrat anordnen lassen. Zudem ist sein Eckbüro um etwa einen Meter durch einen zweiten Boden erhöht – ein Feldherrnhügel mit bester Aussicht. Das bietet dem General die Möglichkeit, jederzeit von seinem Kommandostand aus den gesamten Handel überblicken zu können, da alle Räume verglast sind. Lehman kann an der Körperspannung seiner Leute erkennen, wie der Handel läuft oder ob ein Händler statt zu arbeiten einfach vor sich hin träumt.
Der Handelssaal der Carolina Bank umfasst die Fläche von beinahe drei Fußballfeldern. Nur wenige Stützpfeiler stören Lehmans freie Sicht auf jeden Händler im Saal. In seinem Büro hat er an der großen Glasscheibe ein Teleskop aufstellen lassen, dessen Linse Cindy täglich mit einem Spezialgerät entstauben muss. Das Teleskop erinnert in seiner Messing- und Holzkonstruktion an die Zeit der Seefahrer. Nur das Äußere ist auf alt getrimmt, im Inneren befindet sich modernste optometrische Technik.
Cindy weiß, dass der Boss mit dem Ding seine Leute tatsächlich beobachtet. Bemerkt er einen, der relaxed in seinem Stuhl hängt, ruft er ihn sofort an: »Ich sehe dich«, sagt er nur und lacht, wenn der Angerufene blitzschnell Haltung annimmt. Keine Haltung, die etwas mit Würde zu tun hätte; vielmehr ist es eine Verbiegung, die ein Händler beherrschen muss, um tagein, tagaus in diesen Legebatterien der Kapitalmärkte zu überleben, zu schuften und Umsätze zu generieren.
Nachdem es im Handelssaal während der letzten beiden Wochen fast totenstill gewesen ist, geht es an diesem Tag wieder richtig los. Nur eine Notbesetzung hat seit Weihnachten die Stellung gehalten – die einzigen zwei Wochen, in denen selbst der globale Kapitalmarkt so etwas wie eine Pause einlegt. Ab heute sollen die Ströme wieder fließen und ein weiteres Jahr mit Rekordgewinnen abwerfen. Trading Floors ähneln großen Turbinen in Wasserkraftwerken. Solange genügend Wasser zugeführt wird, produzieren sie unaufhörlich Ströme von Umsätzen. Und Mitch Lehmans Truppe weiß besser als viele andere Kollegen, wie man das Wasser kanalisiert, damit es zu ihnen fließt.
»Arrangier ein Gespräch mit Pearson, Isa soll auch dabei sein«, ordert er in Richtung Cindy, ehe er in den Besprechungsraum hinübereilt. Wie meist springt er die vier Stufen mit einem Satz hinunter, um den einen Meter in die Welt der anderen hinabzusteigen.
»Robert soll diesen View of the Year von der Bell lesen«, ruft er noch über die Schulter. Cindy greift nach dem Blatt, das ihr Boss im Vorbeigehen auf den Tisch geworfen hat. »Business is never usual«, lautet die Überschrift, ihr Daumen verdeckt das Foto, mit dem der Artikel gezeichnet ist. Sie zieht den Daumen weg und trifft auf das Bild einer herben jungen Frau mit langem Haar und murmelte »wenn das mal nicht andere Gründe hat« in sich hinein.
Ihr Blick fällt auf die von Lehman markierten Stellen:
Seit 2003 zeigen Börsenkurse, Kapitalisierungen und Produktinnovationen nur in eine Richtung: gen Norden steil nach oben. Nahezu alle Indizien weisen daraufhin, dass die Märkte bald die alten Höchststände von vor der Internetblase wieder erreichen. Die entscheidenden Fragen lauten: Wann ist der Zyklus zu Ende? Geht die Luft langsam aus oder platzt erneut eine Blase? Schließlich ist und bleibt eines sicher: Nach sieben fetten kommen sieben magere Jahre. Es sind nicht immer sieben, oberes bleibtjedenfalls nicht dauerhaft bei fetten Jahren beziehungsweise Gewinnen.
Cindy stutzt ein wenig und verzieht das Gesicht, als sie den biblischen Vergleich liest. Am meisten wundert sie sich darüber, dass Mitch diese Stelle markiert hat. Seit einer Stunde läuft Lehmans Execution Capacity wieder auf Hochtouren. Der General vibriert vor Energie und kann es kaum erwarten, seinen Obristen die Order für 2007 zu erteilen. Ihm genügt ein Blick zur Seite, bevor er in den Besprechungsraum tritt, um mit Genugtuung zu sehen, dass seine Truppen bereits wieder an der Arbeit sind.
Cindy liest die zweite markierte Stell Die Investmentbanken verdienen Milliarden im Handelsgeschäft. Allerdings hat sich der Gewinnpool in den letzten Jahren verlagert: Nicht mehr die kunstvollen Deals im Fusions- und Übernahmegeschäft speisen die Erträge, sondern vor allem die nicht minder kunstvollen strukturierten Produkte, insbesondere im außerbörslichen Handel unter Banken. Hier wird es zunehmend unübersichtlich, und kaum jemand weiß, wer mit wem wie viel Geschäfte macht.
Cindy blickt nach dieser Stelle auf und schaut in den Handelssaal, den Mitch designed hat. Er ist der größte seiner Art auf der Welt – ein Umstand, auf den ihr Boss ausgesprochen stolz ist. Lehman hatte sich beim Neubau intensiv in die Bauphase eingemischt, um einen möglichst effizienten Handelsraum entstehen zu lassen. Er weiß besser als jeder Architekt, worauf es ankommt, um den Workflow so effizient wie möglich zu gestalten.
Für das geübte Auge ist der Handelssaal in einzelne Sequenzen unterteilt. Es reihen sich lange Tische aneinander, und auf jedem Arbeitsplatz finden zwischen drei bis zehn Bildschirme Platz. Ein Bereich handelt Aktien, ein anderer Anleihen. In einer Ecke sitzen die Rohstoffleute, in einem weiteren Bereich sind die FX-Spezialisten für das Währungsgeschäft platziert, daneben sitzen die Derivativehändler. Zudem sind spezielle Ecken für die Researcher, für die Analysten und die Länderbeobachter eingerichtet worden. In einem etwas abseits liegenden Segment sind die Strukkis untergebracht; bei den Researchern und den Strukkis, die die Analysen und Einschätzungen, auf deren Basis gehandelt wird, vornehmen, geht es ruhiger zu als an den Handelstischen.
Die Prima Donna richtet ihr Augenmerk auf die letzte markierte Stelle: Die Frage ist nur, ob die Finanzingenieure ausreichend gewappnet sind, um das Risiko eines Rückschlags richtigzu managen. Denn: Business is never usual.
Davor heißt es, allerdings nicht von Mitch markiert: Bislang sieht alles so aus, als würde auch 2007 ein Jahr des Business as usual mit steigenden Kursen und Märkten.
Cindy wählt Pearsons Nummer und betrachtet die Händler: Hier herrscht jedenfalls Business as usual, denkt sie. Der Handelssaal ist an einer der langen Fronten verglast, die viel Tageslicht einlässt, weil spezielle Spiegel an den Decken für eine Weiterleitung der Sonnenstrahlen sorgen. An den beiden Kopfenden und der anderen Längsseite befinden sich ebenfalls große Fensterfronten; diese Büros belegen die Obristen.
In den vier Ecken des riesigen Saals sitzen die absoluten Spitzenleute des Handelsbereichs der Bank. Auf Mitchs Seite in der gegenüberliegenden Ecke hat Isabella Davis ihr Zentrum, wodurch sie sich von allen anderen Obristen hervorhebt. Gegenüber, am anderen Kopfende des Handelssaals residieren die Chefs für den Aktien- und Anleihebereich, Peter Sanders und Scott Miller. Statussymbole in Form von Sitzplätzen, vom obersten Chef persönlich zugeteilt, konnte man sich nicht kaufen, sondern nur durch außergewöhnliche Leistungen verdienen.
Cindy erinnert sich, dass Mitch erst vor ein paar Monaten einem Spitzenanalysten, den er mit seinem ureigenen Charme von der Konkurrenz abgeworben hatte, ein elektrisches Keyboard neben seinen Tisch mit den Bildschirmen hat stellen lassen. Das beeindruckte den jungen Analysten mehr als das viele Geld, das Lehman ihm angeboten hatte. Der eine ein Keyboard, der andere einen Porsche als Dienstwagen, Mitch macht es möglich – er verfügt über ein todsicheres Gespür, womit er Menschen ködern und gefügig machen kann.
Natürlich spielt der Analyst, wenn er sich während der Handelszeit einmal entspannen will, mit Kopfhörern. Es ist allerdings auch schon vorgekommen, dass er, wie vor ein paar Wochen in der Adventszeit, am Abend richtig aufgedreht, gespielt und dazu gesungen hat. Die ganze Nacht feierte der Handelssaal, Rauch- und Trinkverbot wurden missachtet und unter den Tischen verbotene Spielchen getrieben.
»Guten Morgen, meine Herren«, ruft Mitch den Obristen zu, als er stampfend an das Kopfende geht und in seinen Sitz fällt. Ihm gegenüber, am anderen Ende des ovalen Tisches, hat Isabella Davis Platz genommen, die auf das »Guten Morgen, meine Herren« die rechte Augenbraue hebt. Als einzige Frau unter den Obristen kennt sie das Spiel – genauso wie das Gehabe der Händler. Auch wenn in den Sälen inzwischen alles mit modernster Technik ausgerüstet ist, bleibt der Ton im Handel männlich-rau. Was dazu führt, dass immer wieder Broschüren verteilt werden müssen, die erläutern, wie man sich Frauen gegenüber zu verhalten hat.
Erst vor einigen Wochen hatten sich die Chefobristen zusammen mit Mitch lustig darüber gemacht, dass die Personalabteilung der Carolina Bank eine Anti-Sexismus-Broschüre erstellt hatte, die in den Handelssälen rund um den Erdball zu großem Gelächter geführt hatte. Denn neben Handlungsanweisungen über den richtigen Umgang miteinander enthielt der politisch korrekte Text auch Beispiele, was denn frauenverachtende Sprüche seien. So mahnten die Texter an, die Händler sollten Kolleginnen nicht als »Baby« oder »Doll« titulieren; sie sollten auch keine sexistischen Bildschirmschoner auf ihren vielen Terminals nutzen, und sie sollten vor allen Dingen ihre dummen Sprüche unterlassen.
Das genaue Gegenteil trat nach der Verteilung der Broschüre ein. Der momentane Lieblingsspruch von Mitchs Händlern, aus eben jenem Text übernommen, lautet: »Baby, you really know how to fill the sweater!« Da viele Sekretärinnen von außerhalb kommen, tragen sie des Öfteren am Morgen noch einen Pullover über ihrem Businessoutfit. Nachdem auch die Frauen mitbekommen hatten, was in der Anti-Sexismus-Broschüre steht, wurde keine mehr in einem Sweater gesichtet.
Isabella Davis hatte für dieses männliche Gebaren nur ein müdes Lächeln übrig, wie sie ohnehin nach außen gelassener scheint als alle anderen Obristen. Die sitzen nun in gespannter Erwartung am Tisch, nachdem der General Platz genommen hat. Nur Isa lässt einen Arm locker über die Lehne baumeln, alle anderen erwarten den Big Boss kerzengrade. Besonders gerade sitzt Jim Klein, der Neue.
Der gesamte Generalstab ist erpicht auf die Anweisungen für das kommende Jahr. Die Obristen führen die verschiedenen Untereinheiten selbstständig, in denen wiederum Fußtruppen für bestimmte Handelstypen agieren: Spezialisten für Aktien, Anleihen, Währungen, Zinsen, Rohstoffe, Gold und eben strukturierte Produkte wie die Holiris. Gerade dieses Geschäft mit Derivaten, mit den abgeleiteten Börsengeschäften aus Aktien, Anleihen und anderen echten Werten, erweist sich seit Jahren als Renner. So auch die Zertifikate, die man inzwischen nicht mehr nur an große Funds verkauft, sondern auch an den kleinen Sparer, der sein Geld einer lokalen Filiale anvertraut hat. Daher auch die verführerischen Namen, nur wissen die kleinen Leute meist nicht, was man ihnen andreht.
Wer es in Mitchs Truppe mit gut dreißig Jahren nicht zu zehn Millionen Dollar Vermögen gebracht hat, ist in seinen Augen ein Loser. Und wer von seinen Obristen als Vierzigjähriger nicht hundert Millionen Dollar Privatvermögen auf dem Konto hat, fliegt schnell aus seiner Truppe. Mit fünfzig arbeitet von diesen Händlern in der Regel kaum jemand mehr. Um den Tisch sitzt nur einer, der diese Altersgrenze gerade erreicht hat: Peter Sanders, der Aktienchef, ist vor wenigen Tagen fünfzig Jahre alt geworden.
Die Obristen der Investmentbanken erweisen sich als eine verschworene Gemeinschaft, die auch privat meist in denselben Gegenden anzutreffen sind. In London bewohnen sie die feinen Stadtteile von Chelsea, Notting Hill und Kensington mit Wochenenddomizilen in Oxfordshire; in New York begegnet man sich in den exklusiven Stadtteilen rund um den Central Park oder in Greenwich Village, von wo aus sie in die Wochenenden mit ihren Familien in den Hamptons auf Long Island aufbrechen.
Auch gefeiert wird häufig gemeinsam. Allerdings sind sowohl Mitch Lehman als auch Isabella Davis nicht oft dabei; beide gelten als Einzelgänger, wenn es sich nicht um die Arbeit handelt. Die anderen Obristen haben es inzwischen aufgegeben, ihren General zu ihren Christmas- oder Beachpartys einzuladen. Im Juni, wenn Mitch und Charlotte Lehman jedoch ihr Sommerfest auf Long Island geben, müssen alle Obristen antanzen. Selbst Isa kann sich diesem Fest nicht entziehen.
Banker haben in den letzten Jahrzehnten mit ihren Millionenboni alles aufgekauft, was zu kaufen war: Bis nach Montauk ganz an der Spitze von Long Island erstrecken sich ihre Villen. Zum akzeptierten Umfeld gehören Anwälte, PR-Agenturen und einige Berater. Und nicht zuletzt die Profiteure am anderen Ende der Konsumkette: die Innendekorateure, Autohändler, Juweliere, Boots- und Flugzeugverkäufer. Sie alle leben gut von Leuten wie Mitch Lehman und seinen Obristen. Relocation Agents, die den Umzug eines Truppenkommandeurs von London und New York arrangieren, müssen oft neben Parkgaragen auch Hangarplätze auf den umliegenden Flughäfen für die Privatjets finden. Zu haben ist alles, was das Herz begehrt.
»Ich will dieses Jahr eine Sechs vorne sehen«, eröffnet Mitch die Sitzung ohne weitere Vorwarnung. Selbst die erfahrenstenObristen können ihre Überraschung kaum verbergen; nach fünf Milliarden Dollar Vorsteuerergebnis für 2006 bedeutet dies satte zwanzig Prozent mehr, und zwar nach einem absoluten Rekordjahr. Lehmans Blick schweift einmal rund um den Tisch, er will die Reaktionen der Männer erfassen. Nach der »Sechs« haben alle noch mehr Haltung angenommen und sitzen noch angespannter in ihren Sesseln. Bei Isa stockt sein Auge unmerklich; sie lehnt nach wie vor entspannt und unbeeindruckt im Sessel.
»Das ist eine Menge Holz, Mitch«, ergreift sogleich Peter Sanders, der kleine dicke Engländer, nach Isa der am höchsten gestellte Offizier in der ungeschriebenen Hierarchie, das Wort. Noch ein, zwei Jahre will er machen und dann aufhören, ehe Mitch ihn irgendwann aussortieren würde.
»Ja und?«, gibt Mitch spitz zurück.
»Wenn die Märkte weiter steigen, können wir das schaffen. Aber werden sie das, Mitch?«, fragt Sanders.
»Was meinst du, Isa? Ach, hast du eigentlich den View ofthe Year gelesen?«, fragt Mitch seinen einzigen »echten Mann«, die daraufhin leicht mit dem Kopf nickt. »Müssen wir nachher noch drüber reden, über den View, Isa«, er pocht mit dem Finger auf den Tisch und geht dann mit allen Fingern in ein Klackern mit den Nägeln über.
»Deine Frage ist uninteressant, Peter«, antwortet die Finanzingenieurin Sanders direkt mit unverhohlener Arroganz, ihrem schützenden Panzer gegen die Männertruppe.
»Warum das, Isa?« Peter Sanders ist irritiert, was man ihm deutlich anhört.
»Wir müssen nur das richtige Hedging machen. Welche Meinungen haben wir zu welchen Märkten, welchen Währungen und welchen Risiken? Dazu brauchen wir unsere Researcher.« Sie schaut auf Ron Stevenson und fährt fort: »Alles andere modellieren wir. Schließlich sind wir Finanzingenieure und keine Journalisten.«
»Wir sind doch kein Hedgefund, Isa, der nur den ganzen Tag wettet«, entgegnet Sanders.
Isa lehnt sich zurück: »Sind wir nicht, aber wir arbeiten so. Wir hedgen auch, Peter.«
»Was willst du damit sagen?«
»Peter, das erzähle ich euch seit Jahren. Ob Märkte steigen oder fallen, ist egal. Wir müssen nur richtig hedgen und unser Risiko weitergeben. Dann verlieren vielleicht andere, aber auf jeden Fall nicht wir. Du hängst nach wie vor zu sehr in der Tradition der alten Händler, die keine modernen Absicherungsstrategien fahren.«
Sanders übergeht die Spitze lieber, sonst mischt sich Mitch am Ende noch ein, den in der Regel nur seine Zahlen interessieren. Auch Sanders will nicht unangenehm auffallen.
»Also, was denkst du, Isa? Ist die Sechs auch bei fallenden Märkten zu schaffen?«, will Mitch wissen. Für langes Geschwafel hat er keine Zeit. Er zuckt schon wieder ganz nervös, erkennt Isa, ihn zieht es zurück zu seinen Börsenterminals, da findet für Lehman das »richtige Leben« statt.
»Die Fundamentaldaten sind alle okay. Wir werden eine Abschwächung bekommen. Vor allem in den USA. Vielleicht erst nächstes Jahr, aber einige Märkte werden bald drehen. Beispielsweise die Immobilienmärkte, Leute. Und darauf können wir uns vorbereiten.«
Isa steht auf und geht an das Flipchart. »Ein Beispiel, was wir machen werden«, sagt sie und schreibt dick und fett HOLIRI auf das Blatt. »Das ist ein neues Produkt für den drehenden Markt, das wir noch kurz vor Jahresende entwickelt haben. Ihr gebt mir eure alten Marktrisiken und wir strukturieren sie um. Wir mischen sie zudem noch mit Kreditrisiken aus der Commercial Bank. Und dann verkaufen wir diese neuen Marktrisiken ›over the counter‹ an die Institutionellen. Später vielleicht auch über Funds an Private.«
Also doch ein Hedgefund, denkt Sanders. Isabella will gerade ansetzen und weitererklären, als Cindy den Raum ohne Anklopfen betritt. Sie geht mit gesenktem Kopf zu Mitch und reicht ihm einen Zettel: »Sofortiger Rückruf bei Bensien.«
Mitch schaut verdutzt; normalerweise bittet man ihn um Rückruf.
»Ich rufe später zurück«, murmelt er Cindy über die Schulter zu.
»Bensien wartet am Apparat«, flüstert Cindy ihm ins Ohr, weil sie weiß, dass es für den General unerträglich ist, vor seinem Team als Befehlsempfänger von Carl Bensien dazustehen. Betont langsam erhebt sich Mitch und trällert: »Entschuldigt mich einen Moment, Gentlemen. Ich will Bensien nicht gleich am ersten Arbeitstag vergraulen. Wieso ist der eigentlich schon auf?«, fragt er laut in die Runde, ehe er in sein Büro stampft.
Der Gegenspieler
»Hey, Charly, ein frohes neues Jahr noch«, grüßt Mitch eine Spur zu freundlich in den Telefonhörer. »Bist du aus dem Bett gefallen? In New York ist es doch erst kurz nach drei Uhr morgens.« Er weiß von Isa, dass sich Carl Bensien über das kumpelhafte Charly ärgert.
»Nein, ich bin in Genf und fliege dann über London zurück nach New York. Mein jüngerer Sohn hatte gestern Geburtstag, da wollte ich noch dabei sein«, tönt es über eine Freisprechanlage.
»Die Bank am ersten Tag ohne Chief Risk Officer? Ô, là, là!«, will Mitch Carl ärgern, lenkt aber rasch ein. »Was gibt's denn so Dringendes?«, gibt er sich konziliant, legt die Füße auf den Tisch und zündet sich eine Zigarette an.
»Na ja, ich will den ersten Tag nutzen, Mitch. Ich habe in London ein paar Stunden Zeit und würde mich gern mit dir und Isa zusammensetzen und über diese Holiris sprechen. Wir könnten im neuen Jahr neu anfangen und Zusammenarbeiten!« Carl würde gerne sehen, wie Mitch auf sein Angebot reagiert, denn der ist darauf garantiert nicht vorbereitet.
»Ziemlich plötzlich, Charly.« Die Füße hat Lehman wieder vom Tisch genommen und lehnt mit beiden Ellbogen auf seinem Schreibtisch.
»Ich weiß, aber wenn Isa und du mir das neue Produkt persönlich erklären, kann ich es vielleicht schneller endgültig genehmigen.« Carl kann Mitch förmlich abwägen sehen.
»Okay. Vielleicht keine schlechte Idee. Wann bist du hier?«
»Ich lande zehn Uhr Ortszeit in City Airport. Sagen wir um elf Uhr? Dann haben wir knapp zwei Stunden Zeit. Das dürfte reichen, oder?«
»Wenn es der Sache dient«, seufzt Mitch und gibt sich geschlagen. »Okay, ich sage Isa Bescheid.«
Mitch ist irritiert. Diese Holiris scheinen Bensien ausgesprochen wichtig zu sein, denkt er beim Auflegen. Als hätte er gewusst, dass Isa gerade über die neuen Dinger gesprochen hat.
»Cindy, bring mir Isa. Und zwar sofort«, brüllt er durch die geschlossene Tür seines Büros. Sekunden später steht Isa in seinem Büro.
»Was ist denn passiert?«
»Dieser Idiot von Bensien kommt um elf Uhr vorbei und will mit dir und mir über die Holiris sprechen. Was soll das, Isa?« Mitch vibriert regelrecht.
»Ich nehme an, dass einige Vorstände im Headquarter nervös werden.«
»Und?« Mitch schaut aus seinem Stuhl zu ihr auf, wie sie breitbeinig vor ihm steht, als bräuchte sie einen sicheren Stand. »Alles okay?«, setzt er nach, als sie nicht gleich antwortet.
»Nun, da steckt eine Menge Risikopotenzial dahinter und Bensien ist kein Dummkopf.«
»Soll heißen?«
»Mach dir keine Sorgen, Mitch. Gerade weil sich das Risiko verändert, habe ich die Holiris aufgelegt. Ich habe die Risiken hübsch auseinandergenommen und wieder anders zusammengeschachtelt. Uns kann nichts passieren! Es ist nur so, dass die Holiris etwas Neues sind, und da macht sich das Risk Management natürlich Gedanken über den Markt und sein entsprechendes Risiko für die Gesamtbank. Ist eigentlich ganz logisch.«
Mitch nimmt wahr, dass Isa äußerst zufrieden über ihre neue Erfindung ist, hinter der, wie sie ihm noch vor Weihnachten erklärte, ein Datensatz steht, der jeder Berechnung der Mondmission zu Ehren gereicht.
»Na, dann setze dich mal hin und erkläre mir, was unser Dr. No Risk für ein Problem mit deinen Holiris hat.« Er kann es nicht leiden, wenn er zu jemandem aufblicken muss.
Mitch winkt Cindy herein. Isa genießt Sonderrechte, sie bekommt sogar Kaffee von Mitchs PA gereicht.
»Stelle dir einen einfachen Wicht vor, der Haus, Auto, Kreditkarte, Universität für die Kinder und den Konsum der Frau finanzieren will. So etwas bieten wir bei unserer Bank alles an. Da kann ich eine gesamthafte Bonitätseinstufung vornehmen.« Isabella nimmt einen Stift und ein Blatt, die auf Mitchs Schreibtisch liegen, malt ein stilisiertes Männchen, zieht mehrere Striche quer durch das Männchen und schreibt die Kreditkategorien daneben.
»Wenn wir diese einzelnen Kreditarten und ihre Ausfallrisiken auseinandernehmen, dann habe ich für jede Kreditart ein eigenes Kreditrisiko und eine entsprechende Eintrittswahrscheinlichkeit für den Ausfall. Ich zerschneide den Menschen«, sagt sie fast triumphierend, weil sie sich immer noch über ihre geniale Idee freuen kann, und zieht die Striche noch ein paar Mal dicker nach, sodass das Männchen wirklich zerschnitten aussieht.
Mitch schaut interessiert zu, während Isa weiterredet: »Wenn ich nun diese einzelnen Risiken und ihre Ausfallwahrscheinlichkeit vom einzelnen Individuum wegnehme, dann kann ich das neu zusammenbasteln.«
»Du bastelst dir einen Menschen?«
»Einen künstlichen Menschen, Mitch: einen Risikonsch.«
»Was?«
»Ja, ja«, lächelt sie ihn direkt an, sodass er wieder einmal an ihre Narben erinnert wird. »So nenne ich das synthetische Ergebnis. Du willst vielleicht dreißig Prozent Immobilien mit nahezu null Ausfallrisiko, dazu zwanzig Prozent Leasing mit hoher Ausfallwahrscheinlichkeit und fünfzig Prozent Kreditkarten mit mittlerer Ausfallwahrscheinlichkeit. Und auf alles darauf packen wir die Wahrscheinlichkeit eines sicheren Arbeitsplatzes, aber vielleicht einer höheren Krebserwartung bei allerdings guter Lebensversicherung.«
»Wie kommst du bloß auf solche Ideen, Isa?«
»Ich überlege mir, wie die Welt aussieht, was wir davon gebrauchen können, wie das mit Marktlagen zusammenpasst und vor allem, wie du damit Geld verdienst.« Die Antwort erhellt Mitchs Gesichtszüge, denn nur das will er hören, Details interessieren ihn nicht.
»Und was machst du mit dem Rest der Risiken? Es bleiben ja noch welche übrig, wenn ich richtig mitrechne.«
»Die guten Risiken ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Die guten packen wir gleich in Collateralized Debt Obligations und hinter die schlechten packen wir noch zusätzlich Credit Default Swaps, damit wir sie auch bei schlechterer Bonität trotz allem verkauft bekommen. Und was wir gar nicht mehr gebrauchen können, kommt in die Tonne. Das verkaufen wir als Ramschpapiere oder mischen es unauffällig bei.«
»Wer will das denn kaufen?«, fragt Mitch fröstelnd und gleichzeitig entzückt über die geniale Kaltblütigkeit seiner Spezialistin, die ihm viel Geld in die Kassen spülen soll.
»Wer will all die anderen Dinger kaufen, die wir gebaut haben? Der Renditehunger ist unersättlich, Mitch. In erster Linie unsere Freunde von den Cayman Islands.«
Dort sind die Funds lediglich registriert; die meisten Hedgefund-Manager arbeiten in London oder New York. Auch wenn sie unterschiedliche Hedging-Strategien haben, ist die Grundidee bei allen gleich: Sie suchen die Chance auf sehr hohe Rendite, die aber auch ein entsprechend hohes Risiko in sich bergen.
»Wieso wollen die denn nicht mehr die bisherigen strukturierten Produkte kaufen?«, fragt Mitch.
»Sie wollen ihr Risiko anders absichern, die Junkies wissen stets sehr genau, wo der beste Stoff zu kriegen ist.«
Im Markt der Kapitalmarktsüchtigen sind die Hedgefunds so etwas wie die Grossisten mit hohem Eigenkonsum – und das auch noch auf Pump gespritzt. Hedgefunds kaufen nicht nur diese risikoreicheren Produkte mit höheren Renditen, sie lassen sich einen Großteil davon auch noch mit Krediten finanzieren. Das ist ein bisschen so, hat Isa ihm einmal vor einiger Zeit einleuchtend erklärt, als würde ein Heroinabhängiger einen Konsumentenkredit für seinen Bedarf bekommen.
Isa lehnt sich vor und schaut ihn mit ihren stahlblauen Augen direkt an. In Perth und beim anschließenden Skifahren in den Alpen hat sie sich eine leichte Bräune zugelegt, die ihre außergewöhnlichen Augen noch stärker zur Geltung bringen.
»Es gibt erste Ausfälle auf dem Subprime-Immobilienmarkt. Das ist nicht weiter gefährlich, Mitch. Aber im Markt für einkommensschwache Hypothekennehmer hat es erste Zwangsversteigerungen gegeben. Das kommt jetzt langsam zum Tragen, und das riechen unsere Hedgejunkies. Deshalb will ich ummodellieren und eben nicht einfach nur zurückfahren. Das müssen wir Bensien erklären.«
»Schlau, verdammt gerissen«, Mitch pfeift anerkennend und lehnt sich wieder in seinem Schreibtischstuhl zurück. Die Hemdknöpfe spannen leicht über dem Bauch. Hat wohl über Weihnachten zwei, drei Kilo zugelegt, taxiert Isabella den Mann, dessen Körper sie noch heute blind ertasten könnte. Aber daran hat sie kein Interesse mehr. Sie will mit ihm nur Geschäftsideenentwickelnkönnen,diesiebeianderenBankern niemals ausprobieren könnte. Und Mitch lässt sie gewähren.
»Danke! Und die Hedgefunds kaufen mir das Ding nach der Einführung ab wie die letzten Erdbeeren. KlassischesFunds-of-Funds-System. Denn Subprime alleine fliegt nicht mehr. Warte es ab!«
»Eins noch: Warum Holiri?«
»Weil wir Risiken von verschiedenen Individuen neu zusammensetzen. Holistic Individual Risk Securities oder Certificate.«
»Aber das ist doch gar nicht nur ein Individuum und auch nicht wirklich ein ganzheitlicher Ansatz. Du bastelst doch nur Dinge kollektiv zusammen.«
»Mitch, wie klänge denn Hocori für Holistic Collective Risk? Holiri klingt süßer.«
»Ist aber falsch.«
»Nein, das ist Marketing für eine neue Struktur, mein Lieber«, antwortet Isa, »denn wir betrachten doch individuelle Risiken gesamthaft.«
»Und was ist nun Bensiens Problem?«, er nippt an seiner ersten Cola des Tages.
»Holiris haben noch keinen Markt, und insofern macht er sich Sorgen um das Marktrisiko des Wertpapiers, hinter dem nun viele kleine Kreditrisiken stehen. Bensien traut der Sache einfach nicht.«
»Klingt aber doch alles einleuchtend.«
»Ist es auch. Deshalb werden wir es auch machen. Bensien hin oder her, Mitch. Du kannst mir vertrauen.«
»Weiß ich doch.«
»Genau gesagt, seit zehn Jahren.«
»Weiß ich auch«, entgegnet er gereizt. Isa merkt, dass es Zeit ist, den General allein zu lassen. Außerdem hat sie noch etwas vor.
»Ich bin noch mal kurz weg. Um halb zehn habe ich einen Termin, bin aber rechtzeitig zurück.« Sie trinkt den Rest ihres Kaffees in einem Zug aus und will gerade gehen, als er noch mal auf den »CityView« zu sprechen kommt.
»Können wir heute Nachmittag noch mit Pearson über diesen View ofthe Year sprechen?«
»Klar.«
Als Isa das Büro verlässt, wundert er sich, dass die Obristen noch immer wartend im Besprechungsraum sitzen.
»An die Arbeit«, ruft er ihnen laut zu. Erst jetzt erheben sie sich von ihren Plätzen. Wer für Mitch arbeitet, verkauft sich ihm mit Leib und Seele, his Masters Voice bestimmt den Tagesablauf und man gibt seine eigene Meinung an der Garderobe ab.
»Cindy«, ruft er seine Prima Donna ins Büro: »Elf Uhr Bensien; danach Telefonat mit Pearson. Beides mit Isa. Heute Abend will ich Camilla. Alleine.«
Ohne zu danken, wendet er sich seinen Terminals zu. Zu lange hat er schon nicht mehr auf die Marktentwicklung geschaut. Das nächste Rekordjahr beginnt gut, denkt Mitch und leert die erste Cola. Mit einem gezielten Wurf trifft er den Abfalleimer an der Türe. Ein Spaß, den er sich seit Jahren erlaubt. Mit den durchschnittlich zehn geleerten Dosen Diet oder Zero Coke am Tag trifft er rund sechs Mal den Eimer. Die anderen vier muss Cindy aufheben, wenn sie an einer herumliegenden Dose vorbeikommt. Auch sie bekommt ihre tägliche Portion Erniedrigung von Mitch.
Lange hält es Mitch nicht an seinen Terminals, nach zwei Minuten hat er die wichtigsten Bewegungen an den Märkten erfasst und springt wieder auf. In Lehman pulsiert es im Takt der Börsenübermittlungen, ein rascher Kontrollblick durch die Glaswand auf »seine« Armee lässt ihn zufrieden grinsen; die einzelnen Bataillone, Kompanien und Züge von Händlern für die verschiedensten Handelsbereiche gestikulieren, rufen sich Zahlen zu, sind über Ausdrucke gebeugt, telefonieren, handeln, dealen. Nur in der Nähe des Eingangsbereichs stehen ein paar junge Fußsoldaten zusammen und unterhalten sich.
Der General tritt an sein Teleskop und nimmt die vier ins Visier. Ohne die Gruppe aus den Augen zu verlieren, greift er zum Hörer und will den Jungs gewaltig Feuer machen, als sich etwas Schwarzes ins Bild schiebt. Lehman sieht den Mann nur von hinten, als einer der faulen Fußsoldaten direkt auf Mitch deutet, der vom Okular zurückzuckt.
»Fuck«, entwischt es Lehman entsetzt und so laut, dass Cindy überrascht aufschaut.
Mitch starrt über seine Konstruktion in den Saal, wo sich vom Eingangsbereich aus ein älterer Pfarrer in schwarzer Soutane auf den Weg in seine Richtung macht.
»Pfarrer Melander«, dröhnt Mitch Lehman, greift nach seinem Jackett und rennt in Richtung Ausgang. »Bin kurz weg«, ruft er der verblüfften Cindy noch zu, während er im Laufen das Jackett überzieht.
»Ein Pfarrer bei uns«, wundert sich die Katholikin Cindy, stellt sich ans Teleskop und nimmt den Mann in Augenschein, der ganz offensichtlich erfreut ihren Boss in die breit geöffneten Arme schließen will.
Alle Blicke im Saal sind auf den General gerichtet, als dieser den Pfarrer erreicht und sich notgedrungen kurz umarmen lässt. Dann nimmt er seinen Gast am Arm und zieht den sich leicht sträubenden alten Mann dem Ausgang entgegen.
Der General hat den Pfarrer ohne weitere Erklärungen aus dem Gebäude gezerrt. Links vom Eingang der Carolina Bank zweigt eine kleine Straße mit Arkaden ab; abends warten dort zwanzig, dreißig vorbestellte und von der Bank bezahlte Taxis, welche die Banker nach Hause bringen. Am Morgen ist hier kaum etwas los, und die Stelle kann auch nicht vom Handelssaal aus eingesehen werden.
»Was wollen Sie hier, Pfarrer«, stößt Lehman endlich hervor, als sie eine ruhige Ecke gefunden haben.
»Du scheinst dich nicht zu freuen, mich zu sehen, mein Sohn.« Der Geistliche steht Mitch mit gefalteten Händen gegenüber, er muss leicht zu ihm aufblicken und tut dies mit zur Seite geneigtem Kopf, während Lehman sichtlich nervös auf und ab wippt.
»Ehrlich gesagt, nein«, entfährt es Mitch, was den Pfarrer erschrocken einen Schritt zurücktreten lässt. Sein ehemaliger Messdiener tigert hin und her, mit den manikürten Händen rauft er sich die Haare.
»Warum tauchen Sie hier einfach unangemeldet auf?«, herrscht Mitch den rundlichen Herrn an, dessen Miene einen traurigen Ausdruck annimmt.
Fünfundzwanzig Jahre müssen es her sein, dass er Pfarrer Melander das letzte Mal gesehen hat; der muss inzwischen weit über siebzig sein, rechnet Lehman. Er dirigiert ihn noch tiefer in den Schatten der Arkaden hinein.
»Was wollen Sie von mir? Habe ich nicht regelmäßig Geld geschickt? Ist es nicht genug?«
»Geld ersetzt nicht alles, Mitch!«
»Geld ist aber mein Business, Pfarrer. Und darin bin ich gut! Sehr gut sogar.«
Er muss Zeit gewinnen und lenkt ein: »Wie haben Sie mich gefunden?«
Seit Mitch den Mann in Schwarz aus dem Blickfeld seiner Leute gezogen hat, ist er ruhiger. Und der alte Gottesmann scheint die unhöfliche Eskorte aus der Bank bereits vergessen zu haben.
»Ich habe dich nie wirklich aus den Augen verloren, mein Sohn. Und seitdem du so häufig in der Presse erscheinst, findet man dich leicht.« Horacio Melander zieht einen Artikel aus seiner Manteltasche und hält ihn Mitch hin: »Walking over water« lautet der Titel über einem halbseitigen Foto von Mitch Lehman, das in seinem Büro aufgenommen wurde. Es war eines der Porträts, die Robert Pearson Ende des letzten Jahres initiiert hatte.
»Die Zeitung hatte der Küster in der Sakristei vergessen, als ich vor ein paar Tagen hier eintraf.«
»Gefällt es Ihnen?« Ganz kann es der General nicht lassen, zu empfänglich ist er für Schmeicheleien.
»Etwas blasphemisch, nicht wahr?«
»Leisten wir nicht alle Gottes Werk? Der eine direkt wie Sie, der andere indirekt wie ich. Ohne uns gäbe es die ganze Kirche nicht. Von der Kirchensteuer bis zur Spende für ein neues Gotteshaus. Ich muss mir nichts vorwerfen, Pfarrer Melander.« Mitch Lehman schaut den Mann nachdenklich an, der seine Schulausbildung finanziert hatte. Ohne ihn wäre ich nichts, schießt es ihm durch den Kopf. Was ihm aber trotzdem nicht das Recht gibt, hier einfach unangemeldet reinzuschneien.
»Gottes Werk ist getragen von Nächstenliebe, nicht vom nächsten Geschäft, Mitch. Ich hatte große Hoffnungen in dich gesetzt, dass aus dir einmal etwas Besonderes wird. Du hast dich damals enorm angestrengt. Aber offensichtlich nur, um rauszukommen.«
»Richtig. Aus dem Drecksloch.«
»Das Drecksloch ist immer noch da, größer als je zuvor. Und nun bin ich zu alt, um dort noch etwas bewirken zu können. Aber du …«, er lässt den Satz in der Luft hängen, was Mitch unbehaglich zur Kenntnis nimmt.
Melander mustert Lehman eindringlich, dann fährt er fort: »Du bist gegangen und nie zurückgekommen. Selbst nicht zur Beerdigung deiner Mutter, Mitch. Du verleugnest deine Familie, Mitch.«
»Ich hatte nie eine Familie. Ich habe mit L. A. abgeschlossen. Und deshalb will ich auch Sie nicht hier sehen, bitte.« Die beiden Männer stehen sich gegenüber, und Mitch ist selbst überrascht, dass er »bitte« sagen konnte.
»Ich verbringe hier meine alten Tage. In St. Francis in Holland Park, einer katholischen Gemeinde. Ganz in deiner Nähe, mein Sohn.«
»Oh Gott!«
»Mitch, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen« – Pfarrer Melanders Stimme nimmt den strengen Ton von früher an.
»Meine Gebote bestehen aus Angebot und Nachfrage. Das sind andere als Ihre. Lassen Sie mich in Ruhe. Aber ich kann Ihnen Geld geben, wenn es das ist, was Sie wollen.« Lehman greift in die Innentasche seines Blazers, doch Pfarrer Melander hält ihn zurück: »Nein, Mitch, darum geht es nicht.«
»Worum dann?«, Mitch reagiert zunehmend gereizter.
»Ich wollte dir nur sagen, dass ich in deiner Nähe bin. Das ist alles. Vielleicht willst du beten oder beichten, mein Sohn«, lächelt Melander.
Auch wenn es ihm unter den Nägeln brennt, spürt er, dass es nicht der passende Moment ist, um seinen ehemaligen Schüler mit der Wahrheit zu konfrontieren. In seinen vielen Jahren als Hirte bedürftiger Schafe hatte er gelernt, auf den richtigen Zeitpunkt zu warten.
»Weder bete noch beichte ich, dafür spende ich. Damit tue ich genug für die Kirche und für die Gemeinschaft«, drängt sich Mitch in seine Gedanken.
»Nein, Mitch, damit beruhigst du nur dein Gewissen, du versuchst, dich damit freizukaufen, aber das funktioniert so nicht«, gibt der Pfarrer zurück. »Du weißt ja nun, wo du mich findest.« Er streckt Mitch die Rechte entgegen, die der General nicht ausschlagen kann.
»Ich werde nicht kommen. Und Sie, kommen Sie auch nicht wieder!«
»Du solltest kommen, Mitch. Und vergiss nicht: Ich bin da, wann immer du mich brauchst.« Horacio Melander bohrt seine Augen beschwörend in die seines einstigen Schützlings, dreht sich um und verschwindet in der kleinen Straße.
Mitch wartet, bis die schwarz gewandte Gestalt außer Sicht ist. »Wieder auferstanden von den Toten«, murmelt er vor sich hin. Und sein Gefühl sagt ihm, dass die Geschichte damit nicht ausgestanden ist, dazu kennt er den hartnäckigen Horacio Melander zu gut.
»Aber nicht mit mir, mein Lieber«, flüstert er. Ein Mitch Lehman lässt nicht zu, dass ihn jemand aus der Bahn drängt. Selbst wenn dieser Jemand einmal alles verkörperte, was auch in seinem Leben eine andere Richtung hätte geben können. In seinem Magen breitet sich ein mulmiges Gefühl aus, er fühlt sich unbehaglich; energisch stampft der General auf den Boden, doch ganz kann er die Geister der Vergangenheit nicht abschütteln.
Isas wahres Gesicht
Als Erstes fällt Isa der bläuliche Ton auf, der in der ganzen Praxis verbreitet ist. Gesichter sehen bei dieser Einstrahlung weicher aus, erkennt sie in einem Spiegel, von dem es allein schon im Eingangsbereich mehrere gibt. Ihre Narben erscheinen ihr weniger hart in diesem Licht. Auch die weißen Kittel der Sprechstundenhilfen wirken nicht so abweisend kühl. Sie ist gespannt auf Dr. Julian Luir, einen Mann, der »Wunder« vollbringen soll, wie sie gehört hat. Dr. Luir springt hinter seinem Schreibtisch auf und geht mit ausgestreckter Hand auf Isabella zu, als sie von der Assistentin in sein Besprechungszimmer geführt wird.
Am beeindruckendsten sind seine schlanken Hände mit den langen Fingern und den gepflegten Nägeln. Er hat einen großen, schlanken Körper, der Jugendlichkeit ausstrahlt; herzlich lacht er über das ebene Gesicht.
»Julian Luir«, grüßt der Arzt und nimmt seine goldene Lesebrille hoch, die er ins schwarze Haar schiebt, in dem erste graue Strähnen durchschimmern. Isa schätzt den Mann auf Ende dreißig. Vor ein paar Monaten ließ er sich in London als Spezialist für plastische Gesichtschirurgie nieder und führte am nahe liegenden Krankenhaus einige spektakuläre Operationen durch. Als Isa darüber in der Wochenendausgabe der »Times« gelesen hatte, hatte sie ihn angerufen und den Termin vereinbart. Selbst gröbste Narben soll Dr. Luir verschwinden lassen können, wie es in der »Times on Sunday« hieß.
»Davis, Isabella Davis«, antwortet sie. Ehe sie weitersprechen kann, hebt der Arzt seine rechte Hand und schiebt, ohne zu fragen, die Haare der linken Gesichtshälfte hinter ihr Ohr; er nimmt seine Brille mit der anderen Hand wieder vor die Augen. Isa erstarrt. Für ihr Empfinden betrachtet er ihre Verbrennungsnarben sehr lange, zu lange, auch wenn es nur Sekunden sind. Das ist sie nicht gewöhnt. Niemand, selbst Mitch nicht, hat je so genau auf ihre Narben geschaut. Sie nimmt ihren Kopf zurück, als sie den Schreck überwunden hat, und die Haare fallen zurück über die Narben.
»Eine schöne Frisur.«
Damit hat Isa nun gar nicht gerechnet.
»Ich bin es nicht gewohnt, dass man mich gleich anfassen will, schon gar nicht an dieser Stelle.«
»Wenn Sie mich das genauer betrachten lassen, kann ich Ihnen sagen, wann Sie einen frechen Kurzhaarschnitt tragen und Ihr wahres Gesicht zeigen können, Mrs Davis. Lassen Sie uns nach nebenan in mein Untersuchungszimmer gehen. Ich will mir das genau anschauen. Dann kann ich Ihnen mehr sagen, aber ich habe schlimmere Verbrennungen behandelt, vor allem bei Kindern. Es gibt inzwischen Methoden, die es zu Ihrer Zeit noch nicht gab.«
»Können Sie damit die Narben wirklich wegmachen?«
»Nach der Untersuchung kann ich genauer sagen, wie ich vorgehen möchte. Ich schätze, dass die Narben mindestens fünfundzwanzig Jahre alt sind.«
»Genau dreiunddreißig, ich war damals zehn. Heißes Öl auf dem Gaskocher.«
»Gehen Sie in den Nebenraum zu meiner Assistentin. Ich komme in wenigen Augenblicken zu Ihnen.« Julian ruft eine junge Dame zu sich, die Isabella den Weg durch die Nebentüre weist.
Der Raum ist ganz in Weiß gehalten, hat weder Bilder noch Fenster. In der Mitte steht ein Stuhl, darüber hängt etwas, das wie ein überdimensionales Vergrößerungsglas aussieht. Die Assistentin bittet Isa, den Halsschmuck abzulegen und den Rollkragenpullover auszuziehen. Danach setzt sie sich in den Stuhl; nur mit BH bekleidet, fröstelt ihr ein wenig, obwohl es angenehm warm ist.
»Das Blau hilft uns bei der Arbeit«, setzt sich der Doktor ohne Umschweife auf einen Hocker neben dem Behandlungsstuhl, als er flugs in den Raum tritt. »Es vermittelt allen ein beruhigendes Gefühl, Mrs Davis«, lächelt er sie mit einem zahnpastaweißen Lächeln an, das glatt aus der Werbung stammen könnte.
»Stimmt«, bemerkt Isabella, die nun in dem Stuhl in die Horizontale gefahren wird. Dr. Luir drückt Isas Gesicht nach rechts, sodass die ganze Narbenvielfalt zu sehen ist.
»So, nun will ich mir das einmal genau anschauen.«
Er nimmt ihre Haare streng zurück und lässt sich einen dicken Clip von seiner Assistentin reichen. Danach zieht er das große Glas herunter und betrachtet jede einzelne Narbe lange und ausführlich. Er drückt mit zwei Fingern an der einen, er kratzt vorsichtig an anderen mit einer Art Löffel. Immer wieder drückt er auf einen Knopf am Rand des Okulars. Es macht »Klick« wie beim Fotografieren.
Nach einer halben Stunde präziser Untersuchung sagt er: »Das bekommen wir hin. Ich weiß schon heute, wie Sie aussehen werden.«
»Das weiß doch niemand«, entfährt es Isabella, die langsam wieder mit der Lehne hochgefahren wird. Luir blickt auf seine Assistentin und nickt ihr kurz zu. Er ist bei dem, was er nun vorhat, gerne allein mit seinen Patienten. Als sich die Türe hinter der Assistentin schließt, drückt er auf einen Kopf an der Steuerung des Stuhls.
»In eineinhalb Jahren werden Sie sehen, dass ich recht habe. Schauen Sie einmal«, sagt er und plötzlich erscheinen zwei Bilder vor ihr an der weißen Wand. Sie zeigen Isa ohne Narben, von vorne und von der Seite. Isabella stößt einen erstickten Schrei aus.
»Das sind Sie, wenn wir fertig sind. Wollen Sie das?« Dr. Luir schaut sie ernst an.
»Pff, ja, äh, ja. Wie haben Sie das gemacht?« Isa bekommt kaum Luft, so aufgewühlt ist sie.
»Das Okular kann die Narben in Breite und Tiefe genau messen und danach die Größe der verbrannten Grundfläche. Wir können berechnen, wie viel Gewebe wir ganz vorsichtig Nanometer für Nanometer mit dem Laser abtragen müssen,wann sich darüber die neue Haut selbst bildet und wo wir mit Kunsthaut nachhelfen müssen.«
Isa starrt immer wieder auf die beiden Bilder an der Wand; sie steht auf und geht auf ihr Gesicht zu, oben herum nur bekleidet mit einem schicken Spitzen-BH. Im Schatten ihrer selbst, vom Beamerlicht geworfen, steht sie neben sich.
»Ich kann das nicht glauben«, flüstert sie und blickt Dr. Luir in die Augen, der sich zu ihr stellt.
»Ich schockiere die Patienten immer sofort mit dem neuen Bild; sie müssen wissen, worauf sie sich einlassen. Es dauert lange. Teilweise schmerzt die Behandlung. Manches Mal müssen Sie gegen die Sonne eine Art Schador tragen. Wollen Sie das alles auf sich nehmen, Mrs Davis?«
»Ist das mein wahres Gesicht, Dr. Luir?« Isabella schaut abwechselnd auf sich und auf den Arzt.
»Ja, so hätten Sie ohne Narben ausgesehen. Der Computer kann das aus den Aufnahmen berechnen. Und so werden Sie aller Voraussicht nach in eineinhalb Jahren aussehen.«
»Wie machen Sie das?«
»Ist mein Handwerk.«
»Unglaublich, dass es so etwas gibt.«
»Was machen Sie eigentlich?«, fragt Luir, während er zurück an den Behandlungsstuhl geht und den Stuhl mit ein paar Knopfdrücken wieder in die Ausgangsposition bringt.
»Ich bin Investmentbankerin.«
»Ah, Händlerin!«
»Nein. Spezialistin für strukturierte Finanzierungen.«
»Oh je, klingt ja sehr kompliziert.«
»Ist es nicht. Ich modelliere nur die Realität der Märkte.«
»Und ich die Haut auf Ihrem Gesicht.«
»Dann sind wir uns ja einig. Wann fangen wir an?« Isabella strahlt.
»Sie wollen also?«
»Sicher. Wann geht es los?«
»Noch diese Woche, wenn das möglich ist.«
»Können wir wöchentliche Termine um halb sieben morgens machen?« Isabella zückt ihren Blackberry aus der Tasche.
»Oh, eine early Bird. Können wir. Ziehen Sie sich doch bitte wieder an und lassen Sie sich die ersten Termine geben.«
»Danke.«
»Ich habe auch ein paar Fragen an Sie«, spricht Julian Luir sie an, während sie den Rollkragenpulli überstreift. Sportlich und durchtrainiert ist seine Patientin, wie er registriert; die dunkelblaue Hose sitzt hauteng, wird erst nach unten breiter, wo die Hosenbeine Schuhe mit mittelgroßen Absätzen bedecken. Ihr Gesicht ist wirklich ihr einziger Makel, und dafür ist sie bei mir richtig, beschließt Julian seine Beobachtungen.
»Um was geht es?«, antwortet Isabella, als ihr Kopf wieder aus dem Kragen auftaucht.
»Ich habe Derivate und Zertifikate gekauft. Das sind doch strukturierte Produkte, oder?«
»Ja, das stimmt. Sie sind der erste Mensch, den ich kennen lerne, der sie wirklich kauft. Ich habe sonst nur mit den Banken und Funds zu tun.« Sie schaut ihn an, während sie die dicke Perlenkette wieder anlegt.
»Oh. War das ein Fehler?«
»Ich mache jedenfalls keine Fehler bei unseren Strukturierungen.«
»Und die anderen?«
Isa schaut ihn fragend an: »Was haben Sie denn gekauft?«
»Knock-outs, Baskets, Turbos. Alles, was mein Banker mir angeboten hat.«
»Welche Adresse?«
»Vor allem Lehman.«
»Guter Name. Kann eigentlich nichts schiefgehen.«
»Bestens. Also dann, wir sehen uns nächste Woche«, reicht Julian ihr die Hand.
»Eine Frage habe ich noch«, nimmt Isa ihren Mut zusammen.
»Bitte.«
»Darf ich so ein Bild haben?«
»Nein, aber Sie sehen es jedes Mal, wenn Sie zur Behandlung hier sind. Im Juni nächsten Jahres können Sie es haben. Dann sind wir fertig und wir brauchen die Computersimulation nicht mehr.«
»Schade, aber da ist wohl nichts zu machen?«
»Sie lassen sich doch auch nicht in die Karten gucken, oder?« Er löst seine Hand und führt sie zum Empfang, wo Isabella schnell die ersten Termine vereinbart.
Du bist der Boss
Isa muss an diesen letzten Satz von Luir denken, als sie wieder im Taxi sitzt. Um diese Zeit, wenn alle im Büro sind, geht es einigermaßen flott durch die Straßen. Recht hat er, selbstverständlich lasse ich mir nicht in die Karten schauen, und von Bensien schon gar nicht. Schließlich bin ich Isabella Davis, die Beste meiner Zunft, nickt sie sich selbst im Spiegel der Trennscheibe zum Fahrer zu.
Isabella Davis ist eine lebende Legende in der City. Kaum jemand arbeitet so hart wie sie. Gerüchte kursieren, sie hätte ihre Nanny mit den jeweils neugeborenen Babys im Taxi vor der Bank Vorfahren lassen, um ihre Kinder in den geräumigen englischen Cabs zu stillen. Als Mitch ihr einen Fahrer mit Limousine für die Stillzeit anbot, hatte sie dankend abgelehnt. Die Taxis wären praktischer, da passte ein ganzer Kinderwagen in den Fond hinein.
Sie ist die einzige Frau, die Mitch Lehman wirklich respektiert. Und sie ist der unangefochtene Star dieser Raketeningenieure, die in den Neunzigerjahren in die Investmentbanken strömten und über mathematische Modelle die kompliziertesten Derivatekonstruktionen, Hedgingstrategien oder Value-at-Risk-Modelle entwarfen.
Isabella Davis hat mit dem alltäglichen Bankgeschäft nichts zu tun. Die einzigen Kunden, mit denen sie in Kontakt kommt, sind institutionelle Investoren, die ein bestimmtes Risiko weggehedged haben möchten. Das beherrscht Isabella besser als jeder andere. Hedgefunds sind ihr zudem die liebsten Kunden, weil sie dort quasi Carte blanche erhält: Es gibt – undgenau das liebt Isa im Gegensatz zu normalen Investmentfunds – kaum Anlageregeln, denn Hedgefunds unterliegen weder einer behördlichen noch einer institutionellen Regulierung und können deshalb kaufen und bestellen, was sie wollen: Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe. Sogar Stimmungen, politische Entwicklung bis hin zu Wetteraussichten – wenn einem der Sinn danach steht. Für diese Investoren hat sie die Holiris kreiert. Und Bensien soll und darf ihr unter keinen Umständen dazwischenfunken.
Der sitzt, braun gebrannt und entspannt, bereits in Mitchs Besprechungsraum und blättert in einige Unterlagen, als Isa in den Handelssaal zurückkehrt. Noch immer ist sie in Aufruhr bei der Vorstellung, ein neues Gesicht zu erhalten. Doch jetzt muss sie sich zusammenreißen, denn Carl Bensien ist nicht irgendwer.
Als Lehman Isabella sieht, schießt er aus seinem Büro und geht direkt mit ihr zu Bensien. Allein ist ihm der Chief Risk Officer nicht ganz geheuer.
»Hallo, Carl«, grüßt Isa freundlich und immer noch ganz beschwingt.
»Hallo, Isabella, ein gutes neues Jahr«, antwortet Bensien und hilft ihr galant aus dem Mantel. »Schönen Urlaub gehabt?«
»Danke, es war großartig, die Kinder –«
»Wollen wir jetzt über Ferien reden«, unterbricht Mitch, der zwar keinen Streit vom Zaum brechen, aber Bensien so schnell wie möglich loswerden will. Außerdem muss er sich wohl oder übel noch in das Russlanddossier einiesen; am nächsten Tag wird Anatoli Breschnew erwartet, jüngster Sohn des früheren KPdSU-Chefs der UdSSR und einer der hoffnungsvollsten jüngeren Öloligarchen, mit dem der General und seine Obristen über ein Rundum-sorglos-Paket verhandeln wollen.
»Also gut, Mitch«, beginnt Carl und schaut lieber gleich in Isas Richtung: »Ich habe mir im Urlaub das Konzept der Holiris noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Natürlich ist es gut, Isa. Aber ich kann beim besten Willen nicht erkennen, wie du den Value at Risk berechnen willst.«
»Du kommst aber wirklich gleich voll zur Sache.« Isabella setzt ihr Pokerface auf, während Cindy Kaffee und Wasser anbietet.
»Wie habt ihr euch das konkret vorgestellt und wie groß soll das Volumen sein?«, fragt Bensien die Finanzingenieurin. »Danke, Mrs Fitzpatrick«, nickt Carl Cindy zu. So etwas hört sie selten hier; Cindy lächelt Carl an und verlässt den Raum, während Isabella mit ihrer Erklärung beginnt.
»Wir haben unser Subprime-Engagement komplett über Ratio Driver ausgelagert. Volumen fünfzehn Milliarden Dollar. Richtig, Carl?«
»Stimmt.« Carl beobachtet die Liquiditätszusagen und Garantien für die eigene Zweckgesellschaft sehr genau, deshalb hat er die Zahlen ständig parat. Über den Ratio Driver will die Bank ihre Rendite hochtreiben, um gegen die anderen Investmentbanken gut performen zu können. Das ist jedenfalls Dons Wunsch.
»Ich würde das Volumen gerne verdoppeln und die zweite Hälfte durch andere Kreditarten aus der Bilanz beimischen, so veredeln wir die einfachen Subprimes. Aus meiner Sicht ist das ein richtig schönes Ersatzgeschäft, das wir dann an die Hedgefunds verkaufen können, um unser Marktrisiko in Ratio Driver insgesamt zurückzufahren. So einfach ist die Idee meiner süßen Holiris.«
Als Carl für ihren Geschmack einen Moment zu lange schweigt, setzt sie noch einmal nach: »Ich habe meinen Risikonsch – so nenne ich den künstlichen Zusammenschnitt des Risikomenschen – derart modelliert, dass er, wenn beispielsweise eine Hypothek fällig wird, die notwendigen Tilgungsmittel aus einer Kreditverbindlichkeit bezieht, die später wiederum über sein entsprechendes Einkommen abgedeckt wird. Dadurch senkt sich das eigentliche Ausfallrisiko der Hypothek, und genau das kann man entsprechend einpreisen.«
»Aber das ist doch zunächst einmal so etwas wie potenzierter Pump«, entgegnet Bensien endlich. »Du kannst doch gar kein entsprechendes Modell gestalten, da dir die Basis für deinen Risikonsch fehlt.« Mitch ist überrascht, wie emotionslos Carl dieser Kunstbegriff über die Lippen geht. Selbst ihm wurde ja etwas unwohl, als er sich den Gedanken des Menschenzerschneidens real vorgestellt hatte.
»Du kannst keinerlei Schwankung berechnen, wenn du keinen echten Menschen nimmst. Wenn deine Basis solch ein kompliziertes Derivat ist, dann wird es schwierig. Und Schwankungen sind nun einmal die Grundlage für das Renditeversprechen, Isa.«
Mitch rutscht im Stuhl hin und her. Wie immer bei Detaildiskussionen wird ihm langweilig. Ihm genügt, wenn er die Grundstruktur kapiert. Den Rest überlässt er Isabella, die weiter auf Carl einredet.
»Okay, Carl. Wenn ich bei einer Kreditart die Preisschwankung kenne, ist es einfach, die Vola zu berechnen.« Isa spricht immer von Vola, wenn es schnell gehen soll und sie eigentlich Volatilität und damit die Schwankungsbreite meint. »Aber da ich die verschiedenen Kreditarten ja alle über eine lange Zeitspanne kenne, kann ich aus den historischen Daten eine implizite Schwankung berechnen. Ist ein komplexes mathematisches Modell, da gebe ich dir durchaus recht, aber es funktioniert.«
Zur Bestätigung ihrer Position rückt sie im Stuhl etwas vor und stützt sich auf den Armlehnen ab.
»Bei den Holiris werden die Risiken so zusammengestellt«, erklärt sie und schaut zur Abwechslung in Richtung Mitch, »dass sie ganz verschieden auf Menschen verteilt sind. Das Haus des einen, die Karten des anderen, das Einkommen von einer dritten Person und das geleaste Auto mit hoher Endfälligkeit von einer weiteren realen Person. Dann ist es nur noch ein fiktiver potenzierter Pump«, hebt sie leicht ihre Stimme und konzentriert sich wieder auf Carl, »dessen Ausfall schlicht und ergreifend auf Wahrscheinlichkeiten beruht«.
»Langsam, Isa. Du und ich wissen, dass es nicht so einfach ist«, grenzt Carl Mitch aus dem Gespräch aus. »Wenn man einen solchen Holiri strukturiert, muss man den Hypothekenmarkt, die Zinsentwicklung für Konsumentenkredite, das Obligo für Kreditkarten wie die Möglichkeit des Arbeitsplatzverlustes und die Kündigungsfrist miteinbeziehen. Wenn man dann auch noch ein Währungsrisiko berücksichtigen muss, wird die Sache zu kompliziert, um sie in einem Modell zu strukturieren. Isa, du kannst 'ne Menge strukturieren, das weiß ich, aber das erscheint mir alles zu wenig plausibel, um zu funktionieren.«
Carl steht auf und läuft um den Tisch in Richtung Flipchart, auf dem von der Morgensitzung noch dick HOLIRI steht.
»Du scheinst ja schon beim internen Marketing zu sein«, sagt Carl.
Verdammt, denkt Isabella, lächelt aber weiterhin charmant.
»In Summa, Isa, konstruierst du ein Derivat, das das Zinsrisiko am kurzen Ende für die Kreditrisiken sowie am langen Ende für die Hypothekarzinsen unter Berücksichtigung einer bestimmten Einkommenshöhe bei möglichem Verlust des Arbeitsplatzes in Abhängigkeit einer Kündigungsfrist so gestaltet, dass zudem ein Investor aus dem Euroraum das zusätzliche Währungsrisiko gegen den Dollar auch noch abgesichert hat.«
»Richtig, Carl, besser hätte ich das nicht erklären können«, lächelt sie ihn weiter an.
»Und welche Wahrscheinlichkeitsverteilung nimmst du an?« Carl mustert nun auch Mitch, der seinem Blick ausweicht, denn hier kann er nicht mehr richtig folgen.
»Normalverteilung, weil am Ende alles normalverteilt ist, Carl. Alles schwankt gleichmäßig um einen Mittelwert.«
»Wenn das mal stimmt, Isa, denn ein Ausfall könnte eine Kettenreaktion auslösen. Und dann wäre es alles andere als normalverteilt.«
»Das sichere ich ja durch Default Swaps ab. Zumindest bei allen Junior-Tranchen ohne Rating.« Nun setzt sie ein süffisantes Lächeln auf.
Carl stutzt erneut; das war eine plausible Absicherung.
»Bei wem?«
»Dem Größten im Bunde.«
»Okay. Nun Mitch, wie viel wollt ihr denn begeben?« Carl dreht sich zum Kapitalmarktchef um.
»Dreißig Milliarden Dollar. Sagte Isa ja bereits. Einfach durch Beimischung verdoppeln! Und natürlich nur über Ratio Driver. Da bleibt alles transparent für dich, Carl. Und wir machen einen Haufen Geld für die Bank und damit auch für die Boni.«
Transparenz, das hatte Mitch gelernt, ist ein Zauberwort für Risk Manager. Und wie beim Weiterverscherbeln der gebrauchten Autos wusste er mit traumwandlerischer Sicherheit, wann er eines dieser Buzzwords ins Spiel bringen musste.
Der Hinweis auf den Bonus lockt Carl nur ein müdes Lächeln hervor, damit kann man ihn nicht ködern. Aber über das Volumen ist er entsetzt: »Das ist mir definitiv zu viel, auch wenn es nicht in der Bilanz der Carolina steht. Ich will runter von unserem Subprime-Engagement.«
»Aber die Margen sind erstklassig«, beharrt Mitch.
»Sicher, weil das Risiko vergleichsweise hoch ist«, auch Carl wird lauter.
»Was machen wir jetzt?«, fragt Mitch in die Runde der drei.
»Ich hätte gerne eine vollständige Dokumentation, Isa. Ich will das nachrechnen können. Und ich will das ganze Ding durch einen Stresstest laufen lassen, dessen Parameter ich bestimme. Danach sehen wir weiter. Bislang kannst du mit den fünf Milliarden arbeiten, die ich euch vor Weihnachten genehmigt habe. Hälfte Subprime, Hälfte andere Kredite. Nicht fünf plus fünf, Isa.«
»Okay«, gibt diese klein bei. Für heute hatte jede weitere Diskussion keinen Sinn mehr.
»Wann willst du stressen?«, fragt Mitch in Richtung Carl.
»Überraschung – sonst ist es ja kein Stress. Apropos Stress, ich will stressfrei nach Heathrow und verabschiede mich.«
Carl nimmt seinen Mantel, drückt beiden kurz die Hand und geht, nicht ohne auch Cindy Fitzpatrick die Hand zu reichen.
»Kommen wir damit klar, Isa?«, fragt Mitch, als er mit Isa nun alleine in seinem Besprechungsraum sitzt.
»Sicher, lass mich mal machen. Ich stelle ihm zusammen, was er wissen muss.«
»Er will alles.«
»Er bekommt, was er braucht, Mitch, aber er muss nicht jede Verschachtelung kennen. Das ist mein Betriebsgeheimnis.«
»Ich verlasse mich auf dich.«
»Das kannst du. Seit zehn Jahren«, antwortet sie schnippisch. Hin und wieder kann sie nicht anders und muss ihn an die alte Geschichte erinnern, obwohl Isabella genau weiß, dass Mitch das gar nicht behagt.
Damals hatte Lehman als junger Managing-Direktor in New York Mist gebaut, seine verfehlte Strategie hätte Carolina ein paar hundert Millionen Dollar gekostet, doch das konnte Isa in letzter Sekunde verhindern. Nachts, als er nicht mehr weiter wusste, hatte er Isa aus dem Bett geklingelt. Obwohl sie sich Ewigkeiten nicht gesehen hatten, war sie sofort gekommen, mit Jeans und Pullover – wie in alten Zeiten. Seine ehemalige Geliebte zerlegte die ganze Nacht Mitchs riskante Trades, nahm sie auseinander und setzte sie wieder zusammen, bis man das eigentlich zu hohe und auf der Bilanz lastende Risiko hübsch portioniert wieder in denMarkt geben konnte. »You saved my ass«, hatte Mitch sich mit einer teuren dicken Perlenkette bedankt.
Als Mitchs Hilferuf sie erreichte, stand Isabella Davis noch im Sold einer anderen Bank, doch nachdem sie seine faulen Trades umgeschichtet und das Problem gelöst hatte, machte Mitch ihr sofort ein Angebot. Stanley Ashton, Mitchs damaliger Chef und Förderer, war schnell überzeugt. Seit Mitch zuvor ein paar Jahre mit und für ihn in London als sein Stabschef gearbeitet hatte, war Stanley ein großer Fan von Mitchs Fähigkeiten, und wenn der jemanden empfahl, wie diese verschlossene Finanzspezialistin, dann stimmte Ashton gern zu.
Isabella verließ ihren alten Schreibtisch mit fliegenden Fahnen und arbeitete fortan für Mitch Lehman. Mit ihm war sie vor gut fünf Jahren auch nach London übersiedelt, nachdem Mitch die Leitung des ganzen Handelsbereichs von Stanley Ashton übernommen hatte. Jim Davis und damals drei Kinder mussten mit, genauso wie Charlotte Lehman und ihre beiden Kinder.
Dabei war Isas Karriere nach der Trennung von Mitch zielstrebig nach oben gegangen; nach fünf Jahren Praxis bei einer Bank wechselte sie zunächst zurück an die Uni, um einen Master in Physik und Mathematik anzuhängen. Mit dieser Ausbildung gehörte sie an der Wall Street der Neunzigerjahre zu den am höchsten gehandelten Topshots. Isa lernte schnell, dass Bistros keine Gaststätten waren, sondern dass »Bistro« für eines der ersten und berühmtesten strukturierten Zertifikate stand: Broad Index Secured Trust Offering. Und sie lernte, solche Konstrukte zu bauen, zu verbriefen und weiter zu verbriefen, zu verschachteln und mit hübschen Namen zu belegen: Bistro oder Holiri, Hauptsache ein paar weiche Vokale.
Mitch geht die Erinnerung an die alten Zeiten mit zunehmender Wiederholung auf die Nerven; schnell wechselt er das Thema. »Lass uns noch kurz mit Pearson über diesen View of the Year reden, Isa.«
»Kein Problem. Ich habe dieser Bell an der Weihnachtsfeier ohnehin versprochen, sie demnächst einmal zu treffen.«
»Gute Idee. Machen wir es doch anders: Pearson soll für nächste Woche einen Termin mit dir und ihr machen. Ich komme dann dazu«, entgegnet Mitch.
»Was hast denn du für ein Interesse an ihr?«, fragt sie den General, nun doch neugierig geworden; eigentlich hält er doch nichts von Journalisten.
»Ich will die mal kennen lernen. Kann uns auf Dauer ja vielleicht nützlich sein.« Ihm hatte Pearsons neuste Errungenschaft gefallen, als er sie an der Weihnachtsfeier auffangen musste. Ihr Bild im »CityView« hatte ihn erst dazu gebracht, den View zu lesen.
»Wenn du meinst. Du bist der Boss.«
»Rufst du Robert an? Irgendwann in der kommenden Woche, am besten gegen Abend.«
»Mache ich. Und jetzt kümmere ich mich um die Unterlagen für Bensien. Ich will schließlich keinen Stress beim Stresstest«, fügt sie im Rausgehen an.
»Bist du morgen bei diesem Breschnew dabei?«, ruft er ihr noch hinterher.
»Yes, Sir«, winkt Isa, ohne sich umzudrehen.
Cindy kommt gerade durch die offene Türe in sein Büro und reicht ihm eine rote Mappe: Informationen zu Anatoli Breschnew, CEO der RUSSOIL Corp.
Breschnew kommt
Zwanzig Schritte braucht Mitch Lehman für die Strecke; mehrmals marschiert der General auf und ab. Nur als Test, wie er betont, doch Isabella erkennt an seiner ganzen Haltung, wie sehr er diesen Auftritt genießt: den Gang über den roten Teppich! Um neun Uhr dreißig hat er seinen kompletten Stab vor dem Eingang der Bank versammelt, um dasArrangement persönlich zu kontrollieren und abzunehmen. Bei solchen Sachen ist er total detailversessen.
Wie eine rote Zunge erstreckt sich der Läufer aus der großen Eingangstüre der Londoner Carolina Bank über den Asphalt bis an den Rand des Bordsteins. Drei Meter breit und rund fünfzehn Meter lang ist das gute Stück, das Lehman von einem der Kinos am Leicester Square hat ausborgen lassen. Im Normalfall schreiten die Stars der Filmbranche über diesen Laufsteg. Von James Bond bis Harry Potter sollen schon alle über diesen Teppich gelaufen sein, hat man Mitch erzählt. Eine schöne Geschichte, die er sich merken und in das Gespräch heute Mittag einfließen lassen wird, wenn es passt.
Rechts und links vom Teppich hat Mitch Absperrungen mit roten Bändern und messingfarbenen Ständern aufstellen lassen. Und sollte es am Mittag doch noch anfangen zu regnen, stehen sechs helfende Hände mit großen Schirmen bereit. Darauf prangt: Carolina Bank. Certified by Customers Success. Die Idee ist einfach klasse, das müssen auch die Obristen zugeben, die mit Mitch draußen proben. Wer steht wo, wer grüßt wann – der General überlässt nichts dem Zufall. Der erste Eindruck zählt – you never get a second chance to make a first impression –, so jedenfalls sieht es Mitch Lehman und damit alle seine angetretenen Topshots.
»Okay, Mike«, ruft er dem Hausmeister zu. »Alles wegpacken. Um elf Uhr fünfzig rollt ihr wieder aus«, er geht in Richtung Türe, die ihm bereits aufgehalten wird. Seine Obristen setzen sich gerade in Bewegung, als er mitten im Schritt haltmacht. Alle stoppen. Mit seinem langen Wintermantel und dem hochgeschlagenen Kragen einem Feldherren ähnlicher denn je, geht Lehman auf den zierlichen Hausmeister zu, schaut ihn von oben herab zwingend in die Augen, zieht betont langsam eine Hand hervor und tippt ihm mit dem rechten Zeigefinger auf die Brust: »Und du bist mir persönlich verantwortlich, dass niemand über den Teppich läuft, falls wir hier warten müssen. Klar?«
Ohne die Antwort des verdatterten Mannes abzuwarten, kehrt er wieder um und stapft ins Gebäude; Isabella ist erleichtert, die zierlichen Pumps schützen ihre Füße nicht vor Kälte. Doch das ganze Tamtam ist es auch ihr wert, denn in Kürze steht Big Money vor der Tür. Und dafür muss man etwas bieten, was andere nicht auf Lager haben.
Bei jeder Investmentbank wird man dem Gast erzählen, dass man die besten Rohstoffexperten hat, dass man jedes Bridge Financing stemmen kann, wenn mal ein paar Monate überbrückt werden müssen, oder dass man über die besten Trader mit der höchsten Execution Capacity verfügt. Anatoli Breschnew wird das von jedem der Topbanker hören, die er in diesen Tagen aufsuchen wird, doch nur bei der Carolina Bank wird der jüngste Sohn des ehemaligen kommunistischen Staatschefs behandelt wie ein Staatsgast.
Wenn es ums Geld geht, macht Mitch Lehman nahezu alles. Kurz entschlossen hat er die Floskel des Red-Carpet-Treatment einfach wörtlich genommen. Verblüfft stellt Isabella fest, wie kreativ Mitch sein kann, wenn es ums Geschäft geht. Genauso überrascht ist sie immer wieder, dass er kaum eine Zeile der Unterlagen liest, die seine Experten für solche Meetings Zusammentragen. Sie wird ihn jetzt also noch persönlich instruieren müssen, damit er einigermaßen vorbereitet ist, wenn Breschnew und sein Gefolge in gut zwei Stunden auftauchen werden, um mit ihnen über Core Banking zu reden.
Im Mantel folgt Isabella ihrem Boss direkt in sein Büro, Kaffee für sie und Diet Coke für ihn stehen bereit. Auf dem Besprechungstisch liegt die rote Mappe, unberührt wie Isa erkennt, da noch alle Blätter ganz glatt in den Klarsichthüllen liegen. Während Mitch raucht, gibt Isabella ihm alle Informationen, die Lehman wissen muss, um Breschnew zu überzeugen, dass die Carolina Bank die einzig wahre Adresse für RUSSOIL ist.
Kurz vor der Ankunft des hohen Gastes kommen die beiden wieder aus Lehmans Büro, nachdem Cindy die entsprechende Information der Fahrzeugkolonne erhalten hat. Der General hatte Breschnew drei schwere Limousinen an den City Airport geschickt, zwei Bentleys und einen Rolls-Royce. Mit einem Blick erkennt er, dass alles passt: Seine sechs wichtigsten Obristen stehen aufgereiht wie Kabinettsmitglieder vor der Absperrung in der Mitte.
Isabella, noch Mitchs »just Business« im Ohr, folgt ihm an die Straße und ärgert sich immer noch darüber, dass Mitch sich aber auch gar nichts über die politische Dimension von RUSSOIL in Russland und über Breschnews Verbindungen zur parlamentarischen Opposition erklären lassen wollte. Nicht, dass es sie inhaltlich interessierte, doch Isa wusste, dass es für die Geschäftsanbahnug mit Breschnew wichtig war. Und damit ist es das auch für sie. Sie behält ihren General fest im Blick, steht – wie befohlen – guteinen Meter hinter ihm, als der Gast ankommt. Hoffentlich geht das alles gut, seufzt sie, als der Rolls mit Mitchs Fahrer genau vor dem roten Teppich hält, ein Bentley stoppt vorne, einer dahinter.
Zunächst öffnet sich die Beifahrertür, aus der ein Bodyguard aussteigt; mit geübtem Blick sondiert er die Umgebung, dann erst öffnet er den hinteren Verschlag. Breschnew steigt ziemlich rasch aus dem Auto. Ganz das Gegenteil eines russischen Bären, beobachtet Isa von hinten und seitlich an Mitchs Schulter vorbei, die modernen Oligarchen sehen aus, als hätten sie in Oxford oder Harvard studiert. Feines italienisches Tuch trägt der hohe Gast, dazu braune Schuhe. Ein Unding in der City, aber der Kunde ist schließlich König, denkt Isa.
Die kantigen Züge des Vaters sind auch im Gesicht des Chefs von RUSSOIL zu sehen, aber insgesamt ist er viel schlanker, durchtrainierter als der seinerzeitige Generalsekretär der KPdSU. Isabella schätzt den marktwirtschaftlich orientierten Breschnew auf gut vierzig Jahre.
»Willkommen bei der Carolina Bank, Gospodin Breschnew.« Mitch setzt sein strahlendstes Lächeln auf, geht den fehlenden Schritt auf Breschnew zu und reicht ihm die Hand.
»Danke, Mr Lehman«, grüßt der Russe zurück. »Was für ein Empfang«, zeigt sich Breschnew beeindruckt, als er den roten Teppich sieht.
»Zuletzt hat James Bond darauf gestanden.« Mitch setzt gleich die schöne Geschichte ein, seine Idee hat die gewünschte Wirkung bei seinem Gast gezeigt. Isa merkt am leichten Zucken seines Beins, wie sehr sich Lehman darüber freut.
»Na, hoffentlich hat 007 nicht wieder ein paar Russen gejagt«, kommt es schlagfertig in bestem Englisch von Breschnew zurück, während sich eine zweite Person neben ihn gesellt, die nach ihm aus dem großen Fond des Rolls ausgestiegen ist.
»Sicher nicht, Mr Breschnew, die Zeiten sind doch vorbei.«
»Notfalls hätte ich auch einen erprobten Kampfgefährten dabei. Darf ich vorstellen«, Breschnew zeigt auf die kleine Gestalt neben sich. »Wladimir Godunow, meine rechte Hand und ehemaliger Oberst der russischen Armee.«
»Erfreut, willkommen Oberst Godunow«, Mitch reicht Godunow die Hand und dreht sich dabei leicht zur Seite, dass sich der Blick zu Isabella Davis öffnet. »Und das ist meine rechte Hand: Isabella Davis, die beste Finanzingenieurin, die Sie auf diesem Planeten finden können.«
Während Isa freundlich auf Breschnew zugeht, um ihn und Godunow zu begrüßen, verziehen einige Obristen die Miene über Isas Sonderbehandlung. Nur selten lobt Mitch sie in der Öffentlichkeit, doch hier passte es ihm offensichtlich gut in die Gesprächstaktik.
»Waren Sie nicht einmal General, Mr Breschnew?«
»Stimmt, Mrs Davis, aber das war in den alten Zeiten. Es freut mich, Sie kennen zu lernen«, fühlt sich Breschnew geschmeichelt.
Mitch führt Breschnew zu den wartenden Obristen, mit Isabella und Godunow im Schlepptau. Nachdem alle vorgestellt sind, zieht das Gefolge ins Gebäude, die Türen zum Eingang werden ihnen weit offen gehalten. Der erste Aufzug steht parat – für Mitch, Breschnew, Isa, Godunow und die Bodyguards des Oligarchen reserviert.
»Wollen Sie einen Blick in den Handelssaal werfen?«, fragt Mitch, der auch dafür seine Regieanweisungen gegeben hat: Emsig soll es sein, geordnete Hektik vermitteln.
»Nein, danke«, antwortet Breschnew zu Mitchs Überraschung. »Wir kennen das alles, wir kennen Ihre Bank, Ihre Leute und Ihre Stärken.«
»Dann wissen Sie, dass wir die Besten sind. Den Rest können wir beim Essen besprechen.«
»Genau, Mr Lehman. Das, was wir nicht wissen.«
»Wie darf ich Sie verstehen?«
»Nun, mich interessiert, was Sie über Russland denken. Und besonders das, was Sie und Ihre Spezialisten tun können, damit wir eine Wirtschaftsnation mit einer freiheitlichen Demokratie werden.« Bingo, schießt es Isabella durch den Kopf. Sie wünscht sich nichts mehr, als jetzt an einem anderen Ort zu sein. Breschnew hat den Finger genau dort hingelegt, wovon Mitch keinerlei Ahnung hat. Die Schuld daran wird er auf sie und die anderen Obristen schieben, außer, sie kann seinen und damit auch ihren Kopf aus der Schlinge ziehen.
Die Tischordnung im besten Speisesaal der Bank sieht vor, dass Mitch und Isa Breschnew zwischen sich haben, auf der anderen Seite von Isabella sitzt Godunow, daneben Sanders. Das bietet ihr die Möglichkeit, während des Mittagessens immer wieder das Gespräch an sich zu ziehen – meist bis zur Selbstverleugnung eingeleitet mit einem »Wie Mr Lehman mir erklärt hat« – und zwischen Breschnew und Godunow hin und her zu parlieren. Godunow gefällt es, merkt Isabella, dass er gut eingebunden ist und Breschnew, der mit flinken Augen alles genau beobachtet, scheint ihm zu vertrauen.
Auch Sanders und Klein liefern interessante Beiträge. Aktienchef Peter Sanders hatte Geschichte studiert und war gut über das alte Russland im Bilde. Und zum Glück, was niemand wusste, hatte der neue Derivatechef Jim Klein ein paarSemester Russisch in der Schule gehabt. Jim hieß ursprünglich Hans und stammte aus Ostdeutschland. Da er jedoch erst gestern hier angefangen hatte, hatte er noch keine Gelegenheit gehabt, seinen neuen Kollegen etwas von seiner Vergangenheit zu erzählen.
Mitch hat Fleisch auffahren lassen, bestes Bison. Denn Fisch ist sicher nichts für Leute, die mit Kaviar groß geworden sind, hat er die Küche über Cindy angewiesen. Die Russen greifen interessanterweise nicht zum Wein, einem Mouton Rothschild 1983, sondern bleiben beim Wasser. Es scheint ihnen alles geschmeckt zu haben, stellt Isabella fest. Tomatenconsommé, klassischer gemischter Salat, das Bison mit leichtem Kartoffel-Lauch-Gratin – alle haben zugegriffen. Je länger das Gespräch dauert, desto sicherer ist sich Isabella, dass Breschnew und vor allem Godunow Vertrauen zu ihnen fassen.
»Sagen Sie, Mr Lehman«, ergreift Wladimir Godunow beim Kaffee noch einmal das Wort: »Sind Sie eigentlich schon einmal in Russland gewesen?«
»Nein«, Mitch stellt überrascht seine Tasse ab, »warum fragen Sie?«
Isabella und die anderen werden merklich unruhig, weil sie den leicht gereizten Ton in seiner Stimme kennen.
»Nun, Sie wollen doch mit uns ins Geschäft kommen.«
»Dafür muss ich doch nicht das Land kennen. Das machen meine Leute, Mr Godunow.«
»Warum waren Sie eigentlich noch nie da«, steigt Breschnew ein, der – wie Isa sofort begreift – Fragen des Öfteren mit Godunow zusammen stellt.
»Ich habe bisher noch kein Business in Russland gemacht, aber das wollen wir ja gerade ändern.«
»Fahren Sie nur dahin, wo Sie Business machen, Mr Lehman?« Godunow beugt sich vor, um an Isa und Breschnew vorbei Mitch direkt anzuschauen.
»Ich mache nichts anderes als Business. Jeden Tag, sieben mal vierundzwanzig Stunden lang«, versucht Mitch es lächelnd mit einem Scherz.
»Dann sollten wir uns das nächste Mal vielleicht in Moskau treffen«, erhebt sich Anatoli Breschnew. »Aber bringen Sie bitte Ihre Leute mit, vor allem Mrs Davis.«
Mitchs Lachen gefriert.
Die beiden Russen haben alles gehört, was sie hören wollten. Isabella und Mitch lassen ihre Mäntel liegen, da auch die Gäste ohne wärmende Kleidung aus dem Auto gestiegen waren, und begleiten sie nach unten und über den roten Teppich wieder zum Rolls.
»Sie hören von uns«, wendet sich Breschnew, der sich genauso wie Godunow keine Notizen gemacht hat, als Letztes an Mitch, nachdem Godunow und er sich freundlich von Isabella verabschiedet haben.
»Wir müssen«, drängt Godunow zur Eile und reicht Mitch ebenfalls dankend die Hand.
Als die Wagenkolonne um die Ecke biegt und aus dem Blickfeld verschwunden ist, tritt Mitch beim Zurücklaufen ins Gebäude wutentbrannt gegen einen der Messingständer, die zur Absperrung dienen.
»Was will denn dieser Idiot?«, giftet er Isabella an, die neben ihm wieder in Richtung Aufzug trippelt.
»Er will einen Partner, Mitch, nicht einfach nur eine Bank.«
»Ja und? Was soll denn der Quatsch! Seit wann machen wir einen auf Partnerschaft, Isa? Damit ist doch kein Geld zu verdienen.«
»Meinst du!«
»Was?« Fast rennt Mitch einen jungen Trader um, der seinen Weg kreuzt.
»Ich bastele ihm das, was er will, und wenn er was mit Verantwortung will, dann bekommt er das auch, wir wollen doch den Deal, nicht wahr?« Sie bleibt mitten im Gang stehen und grinst den verdutzten General triumphierend an.
»Ich strukturiere ihm als Eintrittsgeschenk ein Derivat, das an jedes verkaufte Barrel Öl einen Bildungsdollar hängt, Mitch«, sie strahlt über ihre geniale Idee. »Das ist dein roter Teppich.«
»Und wie soll das gehen?«
»Very simpel: Ich ziehe beispielsweise Verlage, Universitäten und Unternehmen so in eine Wette, dass sie jeden Bildungs-Öldollar matchen und daraus zwei werden. Dafür bekommen sie eine Option auf das Verlegen von Schulbüchern, den Bau von Universitäten und auf öffentliche Ausschreibungen.«
»DAS ist genial.«
»Breschnew gibt einen Dollar aus seiner RUSSOIL-Marge, der Westen den anderen. Damit ist das Volumen verdoppelt. Und Breschnew hat nur fünfzig Cent bezahlt.«
»Und was ist die Wette?«
»Je mehr Öl Breschnew verkauft, desto mehr Geld fließt in die Bildung. Läuft am Ende die Wirtschaft besser, wird mehr investiert und im Westen mehr verdient.«
»Und wenn es nicht funktioniert?«
»Ist die Wette verloren.« Isabella zuckt die Schultern. »Aber wir haben Breschnew gezeigt, dass wir gesellschaftliche Verantwortung als Bank strukturieren können. Und er ist der große Wohltäter im russischen Volk.«
»Aber die Wohltätersache ist doch Unsinn«, sagt Mitch leise.
»Sicher.«
»Hast du einen Namen dafür?«, begeistert sich Mitch langsam.
»Mhm. Vielleicht ›Öl für die Bildung‹?«
»Super. Wie lange brauchst du?«
»Zwei Tage. Ich muss ja auch noch die Holiri-Dokumentation für Bensien machen.«
»Großartig.« Schlagartig ist Mitchs Laune wieder besser, er stupst Isa kumpelhaft in den Arm und geht in sein Büro, während Isa in die andere Richtung steuert.
»Sag mir, wann ich Breschnew anrufen kann«, ruft er ihr noch hinterher.
Der War Room
»Tim, was hältst du davon, wenn wir die Dokumente am Wochenende einmal gemeinsam durchgehen?« Carl Bensien und sein Assistent befinden sich auf dem Weg in den War Room, den sie durch eine Verbindungstüre von seinem Büro aus bequem erreichen können.
»Einverstanden«, antwortet Tim nach kurzem Zögern. »Ich wollte zwar noch mal zum Skifahren, aber ich konnte mich ja über Weihnachten genügend austoben.«
Carl stutzt, vage erinnert er sich an die Mail, die er an Heiligabend aus Zermatt an Tim geschrieben hatte, und dreht sich zu ihm: »Ich habe noch eine bessere Idee: Wir fliegen nach Vermont, laufen ein paar Stunden Ski und nehmen alles mit: Laptop, die OTC-Analyse und Isabellas Zahlen über die Holiris, das wird dann unser Après-Ski-Programm.«
»Na, das nenne ich wirklich ein Triple A, Chef.«
»Du bist selbstverständlich eingeladen. Ich lasse uns zwei Zimmer in einer Lodge reservieren. Wir nehmen einen Heli und starten, sobald die Holiri-Unterlagen aus London eingetroffen sind.«
Die Trennscheibe ist ausnahmsweise eingefärbt, wie Tim im Vorbeigehen bemerkt hat. Wenn die Einsicht aus dem War Room verhindert werden soll, kann Carl Bensien in seinem Büro auf Knopfdruck die Temperatur in der Scheibe reduzieren oder erhöhen, die Kristalle verändern ihre Konsistenz und das Glas verfärbt sich anthrazitgrau.
Das macht der Chief Risk Officer nur, wenn er wichtige Dinge zu besprechen hat, bei denen er nicht nur nicht gehört, sondern auch nicht gesehen werden will. So ein Telefonat musste Carl eben wohl geführt haben. Familie, hatte Denise erklärt, als sie Tim im Sekretariat warten ließ. Zeit für den Assistenten, fünf Minuten Luft zu holen; denn seit der Rückkehr des Chefs laufen die letzten Vorbereitungen für den großen Stresstest mit dem neuen System auf Hochtouren. Außerdem steht Tim gerne ein paar Minuten zum Plaudern bei Carls gleichaltrigen Sekretärin – ein Bild von einem blonden All-American-Girl, die ihn bisher jedes Mal abblitzen ließ, wollte er mit ihr ins Gespräch kommen.
Ein Blick genügt Carl auf dem Weg zu seinem Platz im War Room, um eine freudige Anspannung bei seiner Mannschaft zu erkennen. Wie ein Schatten folgt Tim seinem Chef an den erhöhten halbrunden Kommandostand mit unzähligen Terminals, von dem aus Bensien jeden seiner fünfzig Topspezialisten sehen kann. Carl hielt diese Erhöhung zunächst für unnötigen Firlefanz, aber die Designer hatten ihn überzeugt, dass er ansonsten bei jedem Manöverschritt aufstehen müsste, wenn er die einzelnen Bereiche genauer beobachten wollte.
Vor dem Kommandostand gruppieren sich die Tische mit den einzelnen Einheiten seiner Leute, die die jeweiligen Regionen betrachten: Asien, Europa, The Americas, die Emerging Markets und Middle East, die jeweils eigene Risk Cluster repräsentieren. Quer durch die Reihen zieht sich im Halbrund ein ebenfalls halbrunder lang gezogener Tisch, an dem die Integratoren sitzen. Sie registrieren einzelne Veränderungen in den Regionen und auf den verschiedenen Basis- oder Derivatmärkten und analysieren, welche Auswirkungen bestimmte Produkte auf andere Regionen haben können.
Carl muss gerade daran denken, dass Tim das gesamte Ensemble als eine überdimensionale Fischgräte bezeichnet hat, als er um den Kommandostand herumkommt und sich mitten hineinstellt, da er noch einmal die Parameter für den neuen Stresstest durchgehen will.
Nur die von Bensien persönlich ausgesuchten und zum Schweigen verpflichteten fünfzig Topleute kennen das neue Simulationsmodell. Wann er mit dem globalen Stressmanöver losschlagen wird, wissen nur die Mitglieder des Risikoausschusses der Bank, der gestern Abend hinter verschlossenen Türen getagt und den Plan nach heftigen Diskussionen abgesegnet hatte.
Unter Carls linkem Arm klemmt der geheime Schlachtplan: DICTAtor steht in dicken, handgeschriebenen Buchstaben auf der roten Mappe. Hinter diesem Code verbirgt sich ein Simulationsprogramm, mit dem er und sein Team das gesamte Risk Exposure der Bank bis an die Belastungsgrenzen und darüber hinaus schieben wollen: Dollar down, Interest Rates up, Commodities jumping high – aus den Anfangsbuchstaben D, I und C dieser drei einzelnen Marktsimulationen hat Carl den ersten Teil des Codes gebildet. Der zweite steht für einen so noch nie da gewesenen Angriff auf das weltweite Finanzsystem: TA – Terror Attack.
Ein letztes Mal wirft er einen prüfenden Blick in seine Mappe, dann schließt er die Augen und geht noch einmal wie ein Skifahrer in den letzten Sekunden vor dem Start die Strecke durch. In dem brillant ausgetüftelten Simulationsmodell entspricht jede Minute einer Stunde in Echtzeit. Carl und seine Mannschaft können in vierundzwanzig Minuten einen globalen Kapitalmarkttag komplett durchspielen, für eine ganze Arbeitswoche genügen hundertzwanzig Testminuten.
»Ein volles Quartal simulieren wir in vierundzwanzig Stunden, Tim, das ist wirklich klasse«, brummt Bensien zufrieden in sich hinein. Fehlt nur noch ein letzter Check der Parameter mit seinem Assistenten, nachdem er an allen Tischen vorbeigegangen ist und sich das jeweilige »bereit« geholt hat. In solchen Momenten kann Carl Bensien die erstklassige Offiziersschule, die in der Schweiz nach wie vor ein Großteil der Elite des Landes seiner Jahrgänge durchlaufen hat, nicht verleugnen: präzise der Ton, ernst die Mimik, knapp die Gestik, ganz der verantwortungsbewusste Hauptmann, der seine Truppe auf die vor ihr liegende Aufgabe einschwört.
Als Risk Assistent hatte Tim in der Vorbereitungsphase viele Details mit vorsichtigem Taktieren herausfinden und klären müssen. Zwar wissen die verantwortlichen Chefhändler rund um den Erdball, dass immer wieder unangekündigte Stresstests durchgeführt werden, aber keiner kennt das neueModell. Selbst Mitch Lehmans Mannschaft wird in der kommenden Woche nichts anderes übrig bleiben, als an der Übung teilzunehmen. Einer Anordnung des Risikoausschusses kann sich selbst der General nicht entziehen.
»Auch wenn es eine ernste Sache ist, Tim: Das wird ein Vergnügen, wenn wir die Dynamik der Simulation starten«, Bensien blinzelt über seine Lesebrille seinen Assistenten an.
An diesem System hat er monatelang getüftelt, jetzt ist es perfekt. Das hat am gestrigen Abend auch der Risikoausschuss anerkennend gelobt, auch wenn ihnen die Stressdauer sehr ambitioniert vorkommt, was Kramer noch einmal darin bestätigt hat, dass Carl der richtige Mann an der richtigen Stelle ist, selbst wenn er sich dafür jeweils Ärger mit Lehman einhandelt.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Neuausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2013
- ISBN (eBook)
- 9783942822053
- DOI
- 10.3239/9783942822053
- Dateigröße
- 5.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2013 (März)
- Schlagworte
- bad banker markus will ebook hey thriller lehmann hedgefonds finanzthriller bank finanzen