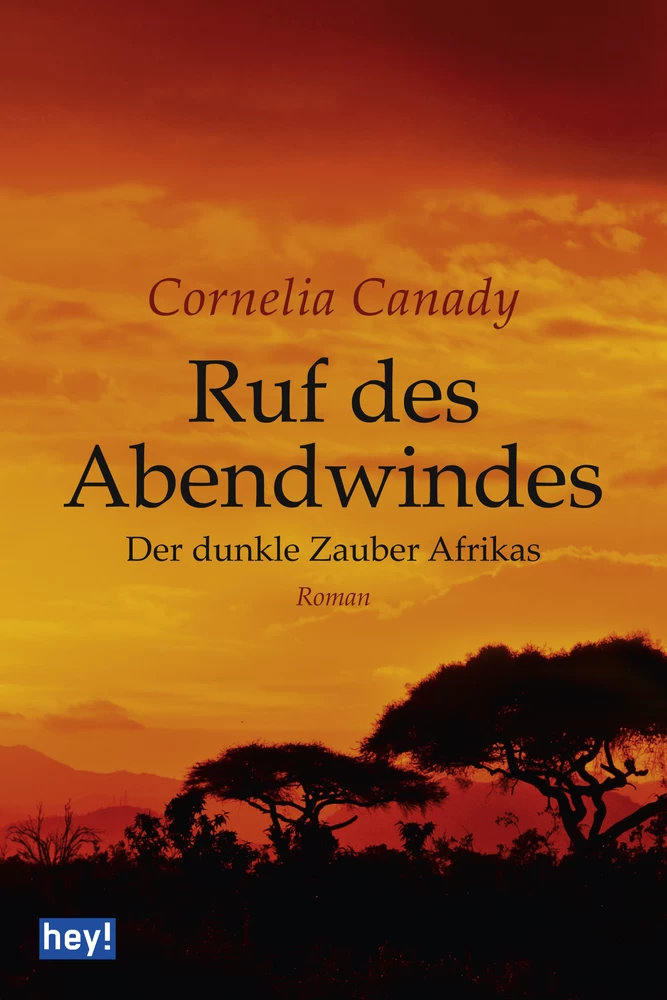Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abschied von Maria
Der Flug der Amsel
Vier Stadtmusikanten aus Afrika
Himmelfahrt fand später statt
Ein Phantom aus dem Internet
Der Duft des Frangipani-Baumes
Der Brief
Rückkehr nach Afrika
Bangui, sagt die Liebe
Inch Allah
Les quatre bestioles: die vier Viecher
Bangui, der alte Traum
Der Schmetterlingsverkäufer
Ein verdammt schwerer Anfang
Maison Kakerlake
Der Zauber des Limbali-Baumes
Ein magisches Ritual
Merkwürdiges Zusammentreffen
Heimkehr mit Hindernissen
Zwischen den Welten
Eine herbe Enttäuschung
Der fliegende Pick-up
Die Fahrt zum Dschungel und die Begegnung mit Wachtposten-Waldi
Fahrt mit Hindernissen
Mokele Mbembe
Mitternacht in Bayanga
Eine unangenehme Begegnung
Die Lodge im Urwald
Eine Jagd mit überraschendem Ausgang
Die sterbende Pygmäin
Die Qual des stummen Basenji
Maison kûkurû
Die Schlange
Der Millionär
Dschungelalltag
Die ersten Touristen
Wenn nachts der Mullah ruft
Beginn der Regenzeit
Das Fest
Icham
Meine Familie
Epilog
Abschied von Maria
Allmählich fügten sich verschwommene Konturen zu einem Bild zusammen: Ein rundes Gesicht unter einer weißen Haube schwebte über mir und musterte mich mit einem eingefrorenen Lächeln. Ich nahm Geräusche wahr, Stimmen, ein unerträgliches Rauschen. Plötzlich schlug mich jemand flach auf die Wangen.
»Frau von Laue… aufwachen!«
Ich zuckte zusammen. Ich lag in einem Bett mit Gittergestell, in einem weiß gekalkten, karg möblierten Zimmer, und die schwach nach Medizin und Mittagessen riechende Frau war mir fremd. Beunruhigt fragte ich sie: »Was ist denn los?«, und dabei schnürte eine böse Ahnung mir die Kehle zu.
Die Frau im hellen Kittel beugte sich zu mir herunter und richtete etwas an meinem Arm, sodass ein stechender Schmerz ihn durchfuhr. So stechend wie der Schmerz kamen meine Erinnerungen zurück. Mein Baby, Maria, ungeborene Tochter meiner großen Liebe! Unwillkürlich tastete ich über meinen Bauch, den ich prall und rund in Erinnerung hatte. Was ich spürte, war ein flacher, eingefallener Ballon, in dem es zog und wie Feuer brannte.
»Mariaaaaa! Wo ist mein Baby?«, schrie ich die Schwester an. »Wo ist mein Baby?« Ich krallte mich in ihren Arm.
»Ist ja gut, Frau von Laue.« Sanft entzog sie sich meiner Umklammerung. »Sie hatten einen Autounfall.«
»Was habt ihr mit meiner Tochter gemacht? Wo habt ihr sie hingebracht?«, schrie ich.
»Sie haben Ihre Tochter verloren. Das ist sehr, sehr traurig, aber Sie werden darüber hinwegkommen. Bei allem Unglück hatten Sie einen Schutzengel. Sie haben innere Verletzungen, die bald wieder ausheilen werden, Sie können weitere Kinder bekommen.«
»Das ist nicht wahr!«, wehrte ich verzweifelt ab und grub meine Hände ins Gesicht, bis es schmerzte. »Wo ist mein Baby?«, wiederholte ich böse und eindringlich. Ich hasste diese Person, die mich einzulullen versuchte. Suchend sah ich mich im Zimmer um nach Hinweisen auf Maria. Aber da war nichts.
»Ihr habt sie umgebracht!«, rief ich verzweifelt.
Und dann schrie ich. Als die Schwester mich in die Arme nehmen wollte, stieß ich sie so grob zurück, dass sie taumelte. In der Tür erschien ein Mann in weißem Kittel.
»Ich habe es ihr gerade erklärt«, entschuldigte sich die Schwester.
»Schon gut, Schwester Erika, lassen Sie uns bitte einen Moment allein!« Der Mann hatte eine beruhigende Stimme. Er sah mich besorgt an und berührte sacht meine Schulter. »Ich bin Ihr Arzt, Frau von Laue. Leider gab es keine Rettung mehr für Ihre kleine Tochter, wir haben alles versucht. Es ist sehr schnell gegangen, sie musste sich nicht quälen!«
Während er tröstend meine Hand hielt, zerbrach ich in tausend Stücke.
»Wir hatten Glück, dass wir Sie durchgebracht haben! Sie haben einen Milzriss und starke innere Blutungen.« Der Arzt fühlte meinen Puls. Dann verschwand er.
Ich war wie betäubt. Eine gütige Wolke umhüllte meine Seele. Ich wollte nur noch sterben, wollte zu meinem Kind, das so plötzlich aus meinem Bauch gerissen worden war. Maria! Plötzlich sah ich sie ganz deutlich vor mir. Sie sah mich liebevoll an und breitete ihre Ärmchen nach mir aus. Ihr Blick war ganz aufmerksam, und sie verstand jedes Wort, als ich anfing, mit ihr zu sprechen.
Meine schöne, kleine Tochter, weißt du noch, was wir alles vorhatten? Wir wollten zusammen nach Afrika zurück, in das Land des trockenen Harmattan-Windes und des geheimnisvollen Oubangui-Flusses, in das Land, das mein Zuhause ist und das auch deines werden sollte. Vielleicht bist du jetzt schon dort.
Vielleicht bestaunst du schon die Vielfalt der Blüten und der Früchte, der Tiere. Siehst du deinen Vater? Tahim, meine große Liebe… Icham heißt er noch, das heißt Josef auf Arabisch, deshalb nenn ich dich Maria, weil ihr zusammengehört, so wie auch ich zu ihm und dir gehöre! Aber das habe ich dir ja schon erzählt. Du weißt ja schon so vieles von deinem Vater, und er weiß nichts von dir - nicht, dass du schon die Hitze Afrikas kennst und auch die Krankheiten, dass du schon Malaria hattest, dass du die Angst vor dem großen Urwald kennst und auch den Gesang der Pygmäen, wenn sie von der Jagd zurückkommen, den Schrei des Kronenadlers und das heisere Bellen der Gorillas …
Er weiß nur, dass du unser größter Wunsch warst, der sich formte aus Schweißperlen, Spermien und Seufzern leidenschaftlicher Umarmungen, als wir uns im Dschungelhaus am Oubangui liebten. Wie ähnlich du ihm siehst, meine kleine Tochter. Du hast seine samtige, olivfarbene Haut, seinen sinnlichen Mund mit den festen Lippen, die bei jedem Kuss so weich und verzehrend wurden. Noch kann ich nicht erkennen, ob du meine grün schillernden Augen hast oder seine schwarzen, voll orientalischer Unergründbarkeit.
Erinnerst du dich, wie wir nach Europa zurückmussten, weil meine Zeit in Afrika abgelaufen war, und in der kleinen Wohnung in München landeten? Oft habe ich dir afrikanische Musik vorgespielt. Du hast sie genauso geliebt wie ich, du hast gestrampelt zu dem Zouk: Oti entre OK … on sort KO oder Francos Rumba aus Zaire: Mpata Ezangi… ma femme et son chauffeur… und zusammen sind wir herumgewirbelt, sodass ich dich mit beiden Händen umschlingen musste, damit mein dicker Bauch nicht allein davonflöge.
Weißt du noch, wie wir tief im Dschungel nach einer erfolgreichen Antilopenjagd mit meinen kleinen Pygmäenfreunden im Lager zusammensaßen, die am Feuer ihre Kinder wiegten? Da warst du acht Wochen alt. Reihum wurden Märchen erzählt, zum Beispiel vom Mango- und dem Zitronenbäumchen: Mángò - ndímò.wà.kpôkpô. Das ging so:
Der Wind blies eines Tages so stark, dass er alles aufwirbelte und mit sich nahm. Dabei war auch ein kleiner Samen des Zitronenbaumes. Weil der Wind von weither kam und abends müde war, legte er alles ab, und das Körnchen fiel genau unter einen Mangobaum. Als dies der Mangobaum sah, war er nicht zufrieden und wollte, dass der Samen wieder verschwände. Aber der blieb und wuchs.
Die Trockenzeit kam, und aus dem Samen wuchs ein kleines Bäumchen. Dann kam die Regenzeit, und damit kamen auch die Raupen. Sie fraßen den kleinen Zitronenbaum fast kahl. Da rief er verzweifelt nach dem Chef der Raupen und beklagte sich, dass sie doch besser den großen Mangobaum fressen sollten, weil er böse mit ihm war. So zogen die Raupen in den großen Mangobaum und begannen ihn zu fressen.
Eines Tages kam der Wind zurück und blies so stark wie nie. Der große Mangobaum, der schon oft unter dem Wind gelitten hatte, konnte ihm nicht wie früher widerstehen, denn er war von den Raupen ziemlich zerstört. Noch einmal blies der mächtige Wind, und da zerbrach der Mangobaum und stürzte zu Boden. Er fiel auf den kleinen Zitronenbaum unter ihm und alle beide waren verloren.
Mich machte die Geschichte damals sehr traurig, obwohl sie ja nur ein Gleichnis war, ein altes Märchen der Waldmenschen, das der weise Pygmäenhäuptling Majeke seinen Enkelkindern erzählte. Verluste machten mich immer traurig.
Ahnte ich damals, dass auch wir uns trennen müssten, meine geliebte Tochter? Wo blieb meine Liebe nun, die doch so groß war? Wo konnte ich sie leben? Meine Liebe zu dir, zu Tahim, zu Afrika? Wie sollte ich leben ohne dich, mein Kind? Hatte mir doch die Trennung von deinem Vater bereits das Herz zerrissen.
Welch unsägliches Glück hattest du mir geschenkt, geliebte Tochter, als du langsam in mir wuchsest, welch ungeheurer Trost inmitten meiner Verzweiflung darüber, dass ich Afrika verlassen, mich von Tahim trennen musste. Nie würde ich diese Verzweiflung vergessen, als ich meine Holzkisten packte und dann vom Flugzeug aus wie ein Schlosshund heulend ein letztes Mal auf die Zentralafrikanische Republik hinuntersah - und nie das Glück, das ich gleichwohl durch dich erfuhr. Du wurdest zu meiner einzigen Hoffnung, für dich lohnte es sich zu leben. Ich wollte dir die Augen öffnen für die Schönheiten der Welt und dir Kraft geben für dein kleines Leben.
Der Flug der Amsel
In Ollis schöner Altbauwohnung erholte ich mich langsam von den Strapazen. Allmählich heilten die körperlichen Wunden. Was nicht heilte, war die Wunde meines Verlustes. Immer wieder drehten sich meine Gedanken im Kreis, jeden Morgen wachte ich schweißgebadet aus Albträumen auf. Mami half mir sehr in dieser Zeit. Aufmerksam und feinfühlig war sie immer für mich da. Dabei litt sie darunter, dass ich mich abgekapselt hatte und sie kaum besuchte, obwohl sie in der Nähe wohnte. Ich aber wollte allein sein.
Erstaunlicherweise war Ngonga, mein kleines Nilpferd, ein großer Trost. Dieses hübsche Hippo aus Acajou-Holz, stolz aufgerichtet, schmuck im geschnitzten Anzug und fest auf beiden Hinterfüßen stehend, hatte ich vor fünf Jahren auf dem Markt in Bangui erstanden, und seither war es mein ständiger Begleiter. Seinen Namen hatte es von meinen Pygmäenfreunden, Majeke und seiner kleinen Tochter Esakola, erhalten. »Ngonga« bedeutet in ihrer Sprache, dem Aka-Dialekt, »Nilpferd«, und es hatte sich unzählige Male als geradezu magischer Glücksbringer erwiesen. Einmal hatte Ngonga sogar für einen rettenden großen Regen gesorgt, der die trockenen Bachläufe endlich wieder füllte, Fische hineinzauberte und die Jagd am nächsten Tag zu einem großen Erfolg machte. Auch jetzt wirkte er beruhigend auf mich. Er stellte die einzige Verbindung zu meiner glücklichen Zeit in Afrika dar, zu dem Menschen, der die eine große Liebe meines Lebens war.
Zum Glück wurde ich von meinem Kummer durch die Notwendigkeit abgelenkt, mir eine Arbeit zu suchen. Mein eigenwilliger Lebensstil machte es mir nicht gerade leicht, etwas Passendes zu finden. Ich hatte kleinbürgerliches Spießertum immer schon gehasst und neigte dazu, mit allem zu brechen, was mir öfter als zweimal gegen den Strich ging, wozu auch meine zwei weit zurückliegenden Ehen gehörten.
Bei meiner Arbeitssuche zeigte sich, dass ich mit meinen 37 Jahren und einem nicht sehr geradlinigen Lebenslauf gar nicht so leicht zu vermitteln war. Dabei hatte ich keine hohen Ansprüche. Ich hätte sogar einen Job als Nachtportier angenommen. Immerhin sprach ich drei Sprachen fließend. Irgendwas musste sich doch finden lassen. Meine Geldvorräte neigten sich dem Ende zu, und ich brauchte dringend eine eigene Wohnung. Olli würde bald von einem Auslandsaufenthalt zurückkommen. Spätestens dann musste ich umziehen, denn ich brauchte Ruhe. Außerdem hätte ich es nicht ertragen, ständig seiner kleinen Tochter zu begegnen.
Frustriert beschloss ich, mein letztes Geld in ein Flugticket nach Moskau zu investieren, wo ich meinem Vater einen Besuch abstatten wollte. Seit ich vor fast sechs Monaten aus Afrika zurückgekommen war, hatte ich abgesehen von einem Brief keinen Kontakt mehr zu ihm, und er fehlte mir sehr. Von ihm hatte ich meinen Wagemut geerbt, er hatte mir immer vorgelebt, dass alles möglich ist, wenn man es will. Mein Vater war ein Mensch, der jeden Tag intensiv erlebte und mit seiner Spontaneität andere Menschen an den Rand der Verzweiflung trieb. Er machte, was er wollte, und erreichte tatsächlich alles, wenn nicht mit Humor, dann mit seinem Charme. Er hatte sein Leben immer so gelebt, ob in Armut, Reichtum, Einsamkeit oder in vier Ehen mit neun Kindern. Oh, wie sehnte ich mich danach, in seine wunderschönen, spöttischen grünen Augen zu sehen, in sein strenges, dunkles Gesicht mit dem südamerikanischen Flair.
Zuvor hatte ich noch ein Vorstellungsgespräch. Zwei langweilige Typen in grauen Anzügen hielten mich für überqualifiziert und zögerten, mir eine Stelle anzubieten, aber ich konnte sie überzeugen, dass sie genau das Richtige für mich war. Bei allem Kummer hatte ich mein verführerisches Lächeln noch nicht verlernt. Und so erhielt auch ich, ganz der Vater, was ich mir wünschte.
Mit einem riesigen Sonnenblumenstrauß und einer Flasche Schampus tauchte ich bei Mami auf, um mit ihr meinen Erfolg zu feiern. Dünn war sie geworden, zart und zerbrechlich. Ich gab ihr einen zärtlichen Kuss auf die Wange. Der vertraute Geruch nach Bratwurst und Zigaretten in ihrer behaglichen Küche brachte etwas Verlässliches in mein unstetes Zigeunerleben. Das tat mir unendlich gut, und dankbar lächelte ich Mami zu.
»Ich habe einen Job.«
»Na, siehst du, meine Liebe, es geht wieder aufwärts! Du bist jung und musst weiterkommen!«
Wir stießen an, und dann umarmte ich sie zärtlich. Tränen liefen mir über die Wangen, während wir uns schweigend umschlungen hielten. Sie schaukelte mich sanft hin und her und gab mir den Trost, den nur eine Mutter geben kann.
Dabei brauchte sie ihn selbst, denn sie war, obwohl sie dies nicht zeigte, sehr krank. Sie hatte Darmkrebs, und die breitflächigen, lilafarbenen Flecken an den Beinen waren Raucherbeinsymptome. Trotzdem qualmte sie wie ein Schlot und brachte mich damit zur Verzweiflung. Immer wieder ermahnte ich sie, damit aufzuhören und mehr zu essen, natürlich ohne Erfolg.
Während wir gemütlich beisammensaßen, rief mein Bruder Thomas an. Er wohnte im Ruhrgebiet, und ich sah ihn nicht oft. Freudig überrascht erfuhr ich, dass er in München war, ebenso wie mein in Hamburg lebender Bruder. Beide Brüder gemeinsam unterwegs, und auch noch zusammen in München, war sonderbar. Ja, sonderbar. Hätte ich gemusst, mit welcher Botschaft sie wenig später in Mamis Wohnung auftauchten, wäre ich ihnen nicht so froh entgegengelaufen. Beim Anblick ihrer bedrückten Gesichter erstarb mein Lachen.
»Du musst stark sein, Schwesterherz. Manchmal kommt alles auf einmal!«, sagte Thomas leise und mit Tränen in den Augen, während er mich in seinen Armen festhielt.
Ich wollte nichts hören - und wusste es doch schon, bevor er es mir sagte: Vater war gestorben.
Hörte das Leid nie mehr auf? Wie viel konnte ein Mensch ertragen, und woran ging er zugrunde, wenn er es nicht mehr schaffte? In der folgenden Zeit erlebte ich meinen Schmerz in immer neuen Wellen, die mich erfassten und in abgrundtiefe Verzweiflung rissen. Warum das ganze Unglück? Hatte es mit mir zu tun, dass meine Liebsten mich für immer verließen? Was haftete mir an, dass der Tod diejenigen traf, die mir am nächsten waren? Ständig quälten mich Fragen. Was wäre gewesen, wenn …? Ich war tief in eine Innenwelt abgetaucht und nahm wenig wahr von dem, was um mich herum passierte.
Als ich eines Tages die kräftige Oktobersonne auf mir spürte, erwachte ich zu neuem Leben. Kraft stieg in mir auf und die Gier, aus dem Unglück emporzutauchen. Beschwörend drückte ich Ngonga an mich und gab ihm einen Kuss auf die Nase. »Du weißt, was zu tun ist, mon cher fétiche. Aide-moi!«
Ich reinigte die Wohnung, und dann nahm ich ein Bad, um den Reinigungsprozess an mir fortzusetzen. Dabei stiegen mir Erinnerungen an meine Kindheit, an meinen Vater und seine Beerdigung empor, die ich erstmals mit Wehmut ertragen konnte. Die Pastorin hatte eine wunderbare Rede unter einer hellgrün zitternden Birke gehalten, und beim letzten Amen flog laut trällernd eine Amsel aus den Zweigen in die untergehende Abendsonne. Ich war nach wie vor fest davon überzeugt, dass sie die Seele meines Vaters stahl, als diese auf dem Weg in den ewigen Frieden war, und mit ihr davonflog. So würde mein geliebter Vater in meiner Nähe bleiben, Amseln gab es schließlich überall, und ich würde ihn eines Tages Wiedersehen. Nicht als Schatten der Verstorbenen wie bei Sartre … er würde mit seinem Charisma und seiner Unverfrorenheit in mir weiterleben! Das hatte ich ihm in jenem Augenblick versprochen.
Mein rituelles Reinigungsbad war der erste wichtige Schritt in ein neues Leben. Als ich in den Spiegel sah, nahm ich Anzeichen meiner früheren Schönheit wahr. Für wen aber wollte ich schon schön sein, wenn nicht für Tahim, meine große Liebe in Afrika, in Bangui? Eine neue konnte es nach dieser nicht geben, nicht in dieser Intensität und Leidenschaft, und etwas anderes wollte ich nicht. Mein Blick glitt an meinem Körper hinunter, der sich nach einer zärtlichen Umarmung und heftiger Liebe sehnte, fiel automatisch auf meinen Bauch, der wieder straff und flach war, und schon trieb es mir die Tränen in die Augen. Würde ich denn nie vergessen können? Tahim, Afrika, Maria, Vater! Verluste, die mir so wehtaten, dass ich jede Sekunde hätte schreien können … Ich musste da durch, irgendwie …
Vier Stadtmusikanten aus Afrika
Zeppelinstraße hieß meine neue Heimat, wo ich ein schönes Appartement mit Terrasse und Blick über die glitzernde Isar am Deutschen Museum gefunden hatte. »Yeahhhh!«, rief ich Ngonga zu und stellte ihn auf das Fensterbrett, damit er den schönen Ausblick aus unserer Wohnung genießen konnte.
»Yippiehhh!«, schrie ich ihm noch einmal zu, damit er es auch wirklich hörte, bei so einem Holztier wusste man schließlich nie. Ganz offensichtlich hatte er bei unserer letzten Wohnungsbesichtigung als Glücksbringer ganze Arbeit geleistet. Und nicht nur als Wohnungsbeschaffer. Denn neuerdings gab es einen Mann in meinem Leben, Veit, wenn auch nur als Internetbekanntschaft.
Inzwischen waren auch meine fünf riesigen Überseekisten von der Zentralafrikanischen Republik nach Deutschland gelangt, und ich wühlte darin nach afrikanischen Kleinodien. Voll wehmütiger Freude umgab ich mich mit exotischen Düften. Tausend Erinnerungen stiegen in mir auf, als ich Kiste um Kiste begutachtete.
So erhielt Ngonga einige Gefährten: Elefant Duli, aus einem großen Stück Sapelliholz handgeschnitzt; Ngúâ, das knuffig-eckige Waldschwein aus dem Lobaye-Gebiet, und schließlich noch Línzí, Hüterin des Schatzes und des Hauses, die kleine bunte Tonschlange. Diese vier afrikanischen Mitglieder unserer Reisegemeinde, unzertrennlich wie die Bremer Stadtmusikanten, trugen Pygmäennamen. Meine kleinen Pygmäenfreunde hatten sie mir verraten, und ich hatte sie nicht vergessen. Nun standen die Tiere auf einem Münchner Fensterbrett und starrten gebannt hinaus. Was würden sie hier wohl erleben?
Mehr wollte ich aus meinen Kisten nicht auspacken, ich war noch nicht bereit, allzu viel Afrika und damit schmerzende Erinnerungen zuzulassen. Lediglich den schönen Stoff in den warmen Farben der Savanne zog ich heraus. Der passte wunderbar auf mein neues Bett, das ich mir in Einzelteilen hatte liefern lassen und mühsam zusammengebaut hatte. Und dann erlaubte ich noch dem kleinen Intarsientisch, den ich in Bangui selbst gebaut hatte, mitsamt den dazugehörigen Bischofsstühlen, meinem Zimmer eine exotische Behaglichkeit zu verleihen.
Mein zuverlässiger Freund Olli brachte mir weitere Möbel und Geschirr. »Damit du wenigstens das Nötigste hast und mein Keller endlich leer wird!«
Auch als Endfünfziger sah er fantastisch aus und strahlte eine Kombination aus südländischem Charme und bayrischer Ruhe aus. Ich kannte alle seine Wehs und Achs, das letzte namens Hildegun, und er kannte alle meine Höhen und Tiefen.
»Da in der Tüte sind ein paar Scheiben Lachs, Baguette und eine Flasche Taittinger, damit deine neue Wohnung stilvoll eingeweiht wird!« Sein Lächeln wurde noch breiter. »Besteck, Servietten und Klopapier sind natürlich auch dabei. An solche gewöhnlichen Dinge hast du sicherlich nicht gedacht …«
Ich umarmte Olli liebevoll. »Du bist ein echter Schatz. Ich vergess dir das nie! Ohne deine Wohnung wäre ich noch verlorener gewesen, als ich schon war. Komm, lass uns feiern.«
Schon knallte der Korken einer gut geschüttelten Champagnerflasche auf dem Balkon, und es schäumte wild über Gläser, Balustrade und Bürgersteig. »Auf das, was wir lieben!«
Mir wurden wieder die Augen feucht. Auf das, was wir lieben … Ich hatte es nicht in der Gewalt. Die Trauer sprang mich an wie ein hungriger Hund. Olli nahm mich in die Arme und drückte mich stumm an sich. Er hielt mich lange fest und verabschiedete sich erst von mir, als es mir wieder besser ging.
Ich holte Ngonga von der Fensterbank. Gemeinsam sahen wir auf das gegenüberliegende, geheimnisvoll glitzernde Wasser der Isar und leerten den restlichen Taittinger. Wie aus einer anderen Welt schrillte das Telefon.
»Ja, hallo?«, brüllte ich erschrocken ins falsche Ende.
Veit aus der Schweiz war am Telefon, meine Internetbekanntschaft, mit der ich wunderbare Mails ausgetauscht hatte. Wir hatten die gleichen Gedanken, Sehnsüchte und Wünsche, präzise analysiert, in treffende Worte gefasst, teilweise sogar in Gedichte … Seine Briefe waren mir unter die Haut gegangen, und ich dachte immer mehr an ihn als Mann, soweit das möglich war bei meiner Sehnsucht nach Tahim. Begierig nahm ich seine tiefe, warme Stimme in schweizerischem Singsang auf, denn wir hörten uns zum ersten Mal.
»Du hast eine wunderbare Stimme, ganz mädchenhaft und trotzdem sehr aufregend, Julia!« Das tat mir unendlich gut, und ich musste lächeln.
»Du gefällst mir auch, schön, dass wir uns endlich mal hören. Wo bist du jetzt?«
»Noch in Idaho. Aber ich komme demnächst nach Europa, liebe Julia. Wollen wir uns nicht treffen, was meinst du?«
Eine tiefe Freude erfasste mich. Konnte es möglich sein, dass ein anderer Mann als Tahim mich interessierte? »Gute Idee! Ich bin gespannt auf dich, Veit, in Fleisch und Blut.«
Mehr fiel mir nicht ein. Ich hätte ihm noch vieles sagen wollen, aber am Telefon war das schwieriger als per Mail. Übers Internet konnte man sehr offen seine persönlichsten Gedanken mitteilen und trotzdem in sicherer Anonymität bleiben. Außerdem war mir plötzlich klar, dass ich doch nur einen liebte und ewig lieben würde. Großer Gott, armer Veit!
»Ich möchte dich so gern bald kennenlernen! Falls das auf Gegenseitigkeit beruht, fliege ich über München, und dann sehen wir weiter, okay?«
Leiser Aufruhr erhob sich in mir. Es war schön, dass sich jemand wieder ernsthaft für mich interessierte, wo ich mich doch so unattraktiv und überflüssig fühlte. Und dieser Mensch übernahm Entscheidungen. Das war mir völlig fremd geworden.
»Gut, Veit, ich freue mich sehr! Es wird echt spannend werden!«
Ein tiefes Lachen am anderen Ende des Hörers und des Großen Teichs wärmte mein Herz. »Das kannst du laut sagen, liebe Julia.«
Himmelfahrt fand später statt
So schnell kommt er also wieder, der Tod, und wird zum quälenden Gast. Ich erhielt den Anruf einer Krankenhausärztin: »Ihrer Mutter geht es sehr schlecht, sie wird das Wochenende wohl nicht überleben.« Ich kannte ja inzwischen den leidvollen Ablauf des Sterbens und Abschiednehmens, aber trotz wiederkehrender Übung konnte und wollte ich mich nicht daran gewöhnen. Mit Blumen, Pralinen, Obst, Säften, aufheiternden Büchern, Vitaminen und sogar obskuren Homöopathika raste ich zum Krankenhaus und ertappte mich unterwegs bei dem Gedanken, wie es nach Mamis Tod weitergehen würde. Wie wollte sie beerdigt werden? Nichts wusste ich darüber. Ich hatte diese so wichtige Frage immer verdrängt, hatte es obszön gefunden, mit ihr darüber zu sprechen.
Und so war ich völlig überrumpelt, als es nun so weit war. Von der Ärztin erfuhr ich, dass Mami Metastasen hatte, zusätzlichen Lungen- und Leberkrebs. »Na ja, Sie wissen ja, wie das ist.«
Nein, verdammt, ich wusste durchaus nicht, »wie das ist«, die Schmerzen, die Angst, der nahende Tod. Ich war wie gelähmt. Der Schrecken im Krankenzimmer, wo sie in einem Mief aus Urin, Kot und Kaffee fast zum Skelett zusammengeschrumpft lag, mit gelblich-starren, an gefrorene Hühnerkrallen erinnernden Händen. Nichts mehr von meiner süßen Mami, nichts von dem lebhaften und schönen Menschen, der mich so lange begleitet hatte.
»Wenn du wüsstest, wie hässlich du aussehen kannst mit den großen Ohren, würdest du sofort aufwachen und nach Spiegel und Bürste greifen!«, flüsterte ich ihr ins Ohr und zog ganz sanft daran. Die blutroten Lippen, die sich schief und dünn wie eine frische Narbe in der fahlen Haut abzeichneten, verzogen sich auf einmal, und ein zaghaftes Lachen huschte über Mamis Gesicht. Glücklich küsste ich die blasse Stirn, immer und immer wieder, bis sich die Falten glätteten und einem weichen Ausdruck Platz machten.
Die folgenden Stunden waren eine Qual. Sie bäumte sich auf, stöhnte und schrie, ein verzweifelter Kampf gegen den Tod. Ich versuchte sie zu beruhigen, streichelte sie, redete ihr zu, hielt zärtlich ihre Hände. Sie beruhigte sich etwas, aber die Krämpfe kamen in immer kürzeren Abständen. Ich bat die Schwestern häufiger um Morphium, sodass sie alle vier Stunden eine neue Spritze erhielt. Während ich Stunde um Stunde an ihrem Bett wachte und ihren Kampf miterlebte, nahm ich traurig Abschied. Ich quälte mich mit Selbstvorwürfen. So vieles hatte ich versäumt, meiner Mutter zu sagen und zu geben. Und nun war es zu spät. Ich fühlte mich plötzlich uralt. Manchmal regte Mami sich und öffnete blicklos die Augen, doch ihr Kampf war zäh und dauerte an. Und so beschloss ich, Mamis Freundin Meike zu benachrichtigen. Vielleicht konnte sie noch rechtzeitig hier sein, um Abschied zu nehmen.
Am nächsten Tag stand die alte Dame vor meiner Tür, sehr süß und fraulich und ordentlich, mit kleinem Fuchskragen am blauen Schneiderkostüm und passenden Pumps. Sie hatte die lange Reise von Rügen sofort angetreten. Traurig flogen wir uns in die Arme. Es tat so gut, dass sie da war. Jetzt erst merkte ich, dass ich keine Kraft mehr hatte, und brach zusammen. Ich weinte an Meikes Brust wie erst einmal in meinem Leben zuvor, als Tahim mir mit eiskalter Miene eröffnete, dass es keinen Sinn mehr hätte mit uns, und mich nach Europa zurückgeschickt hatte. Ich schrie meinen Schmerz hinaus, bis ich völlig erschöpft war.
Meike blieb eine Woche, in der sie nicht nur Tag für Tag stundenlang an Mamis Bett saß und sich von ihrer Freundin verabschiedete, sondern auch die nötigen praktischen Dinge in die Hand nahm. Sie sprach mit einem Bestatter und kümmerte sich auch um die Wohnungsauflösung. Mir ging das zu weit. Ich empfand es als Verrat, Mamis Wohnung aufzulösen, während sie noch im Krankenhaus um ihr Leben kämpfte. Meike überzeugte mich, dass ich für diese Dinge keine Zeit mehr haben würde, wenn ich erst meine neue Arbeitsstelle angetreten hätte, und so räumten wir einen Großteil der Wohnung leer.
Mit Mami ging es zu Ende. Sie kämpfte um ihr Leben, gegen Erstickungsanfälle, gegen Schmerzen. Stundenlang saß ich bei ihr, hielt sie fest und redete leise auf sie ein. Sie beruhigte sich zwischendurch, doch die Anfälle kamen häufiger. Sie bekam nun alle zwei Stunden Morphium. Doch dann geschah etwas Merkwürdiges: Mami erholte sich zusehends, was den Ärzten ein Rätsel war und auch mich zutiefst verwirrte. Ich besann mich auf meine afrikanischen Erfahrungen: Alles hat seine Stunde, alles seine Zeit …
Drei Tage nach der nicht stattgefundenen Himmelfahrt brachte ich Mami auf Anraten der Ärzte auf einer Trage in ihre Wohnung zurück. Ihren entgeisterten Blick, als sie die halb leeren Zimmer sah, sollte ich nie vergessen. Stotternd suchte ich nach einer Erklärung, aber sie winkte ab.
»Ich weiß, meine Kleene«, beschwichtigte sie mich mit schwacher Stimme, »Meike hat dir gut geholfen!«
Doch trotz dieser Peinlichkeit war ich froh, dass sie noch einmal zu Hause war. Plötzlich lächelte Mami und sagte etwas Unverständliches. Ich blickte sie fragend an, sie wiederholte, aber ich kapierte immer noch nicht. Da wurde sie ungeduldig und spuckte verärgert ein einziges Wort aus: »Bier!«
Ich musste lachen und beeilte mich, ihren Wunsch zu erfüllen. Gemeinsam süffelten wir das Bier in kleinen Schlucken, während ich sanft ihren knochendürren Körper massierte.
Schließlich schlief Mami mit entspannten Zügen ein, und ich saß noch lange bei ihr. Auch mich erfüllte Ruhe, ich erinnerte mich an unsere gemeinsamen Abenteuer und Erlebnisse und küsste sie sacht zum Abschied. In dieser Nacht starb Mami in Frieden.
Ein Phantom aus dem Internet
Weihnachten und die ersten Januarwochen waren trostlos, trotzdem bemühte ich mich um Normalität. Täglich saß ich in einem feschen taubenblauen Kostüm in der kleinen, sterilen Empfangsloge des Patentamtes und gab freundlich Auskunft in allen möglichen Sprachen. Dieser Job war öde, deckte aber meine finanziellen Bedürfnisse, und ich war alles in allem dankbar.
Schlimm waren die Abende und Nächte. Tahim konnte ich nicht vergessen, obwohl ich es ehrlich versuchte. Schließlich hielt ich es nicht mehr aus, griff spontan zum Hörer und wählte die mir immer noch wohlbekannte Nummer. Mein Herz übertönte dröhnend das Freizeichen, dann vernahm ich die Stimme des Geliebten am anderen Ende der Welt, in Afrika. Schlagartig hatte ich alle Kessheit verloren.
»Allo?« Seine Stimme klang so unpersönlich, dass mir nur ein zaghaftes »Salut, Tahim« gelang.
»Ah, Julia…«, kam es zögernd zurück. Schwang nicht auch Freude in seiner Stimme?
»Tu vas bien?«, fragte ich leise weiter und hoffte insgeheim, die wunderbarsten Dinge zu hören.
Stattdessen hörte ich ein neutrales: »Oui, ça va très bien, merci!«
»Ich kann dich nicht vergessen, Tahim«, platzte ich heraus.
Es war mir egal, wie er das fand. Ich konnte nicht anders, er sollte wissen, wie sehr er mir fehlte. Ich wollte ihm alles erzählen, von den Tränen der Sehnsucht in der Nacht, von meiner verdammten Einsamkeit, dass unser Kind gestorben war und ich die wichtigsten Menschen meines Lebens verloren hatte. »Ich würde dich so gerne wiedersehen. Meinst du nicht, wir könnten es noch mal versuchen und uns treffen, vielleicht in Paris?«
Am anderen Ende blieb es still. Bis auf das leichte Pfeifen in der Leitung eines Interkontinentalgespräches war nichts zu hören, und ich biss mir ungeduldig auf die Lippe. Dann aber kam es umso heftiger:
»Julia, wenn eine Tür zugeschlagen ist, ist sie zu. Aber lass uns gute Freunde bleiben.«
Genau das wollte ich hören, konstatierte ich verbiestert. Es schien, dass Afrika nun vollends hinter dem Horizont versank. Wann würde ich das endlich begreifen? Könnte ich doch loslassen, Afrika, Tahim.
Dieses Gespräch war ein herber Rückschlag. Ich wurde immer melancholischer, verbrachte meine Wochenenden mit Selbstzweifeln und Trauer. Ich lag auf meinem schönen Brokatbett und weinte, inmitten von Kerzenschein und südöstlichen Düften, die mich an meinen Liebsten erinnerten. Nach wie vor löste er in mir die stärksten Gefühle aus. Bei ihm hatte ich Liebe, Sicherheit und Geborgenheit gefunden, etwas, das ich in meinem unsteten Leben vermisste.
Oft stand ich auch auf dem Balkon zwischen nordischer Zwergthuja und bayrischem Margeritenstrauch und blickte sehnsüchtig den Wolken nach, in Richtung Bangui. Unwillkürlich kam mir dabei der Schimpansen-Lockruf in den Sinn. Er fing traurig leise an und steigerte sich in kürzer werdenden Intervallen zu lauten hohen Rufen: »Uuuuhhh-uuuuhhh-uu-uhh-uuhhh-uhhhhh-uhhhhhhh …« Oft hatte ich im Urwald diese Laute gehört und so lange nachgeahmt, bis die Affenfamilie nicht mehr floh, sondern interessiert hocken blieb. Damals hatte ich mich glücklich gefühlt, eingeschlossen in den Lauf der Natur. Hier jedoch, in der Münchner Au, sprangen nach meinem traurig-sehnsüchtigen Lockruf die Nachbarfenster auf, ein Mann sah ängstlich herüber, und ein knutschendes Pärchen an der Litfasssäule erstarrte zu Stein. Na ja, am Schluss werden die Schimpansenrufe mit weit geblähtem Brustkorb und ordentlichem Luftvolumen ausgestoßen und erreichen eine beträchtliche Lautstärke und Tragweite …
Konnte diese offenbar unerfüllbare Sehnsucht nicht endlich aufhören und eine neue beginnen? Gab es nicht verdammt noch mal auch andere Männer, die mich wieder zum Leben erwecken konnten? Veit? Unser geplantes Rendezvous hatte ich nach Mamis akuter Erkrankung abgesagt. Aber allmählich hatte ich wieder Lust, ins Netz zu gehen, und tatsächlich erhielt ich zwei Mails von ihm, die mich fesselten.
In den nächsten Tagen und Wochen intensivierte sich die Mail-Freundschaft zwischen mir und dem Schweizer Banker, der mit seiner Ausdrucksweise und seinem humorvollen Charme mein Herz berührte. Zum ersten Mal seit langer Zeit konnte ich wieder einem Mann meine Gefühle mitteilen. Schließlich tauschten wir Fotos aus und verabredeten ein persönliches Treffen in München.
Sein Foto zeigte verheißungsvoll einen großen, sympathischen Jungen mit erstauntem, neugierigem Ausdruck in blauen Augen. Obwohl ich ja mehr auf orientalische Prinzen stand, hatte ich mich ein bisschen in ihn verliebt. Vor unserem Treffen war ich aufgeregt wie ein durchgeknalltes Frettchen. Ich machte mich schön zurecht und kaufte mir zur Ermunterung noch ein paar Ohrringe, Beduinenschmuck mit Türkisen, auffällig und sehr eigenwillig. Sie sollten als gutes Omen mein erstes Date begleiten, und als ich sie anlegte, klopfte mein Puls so stark unter den Ohren, dass der Schmuck in leichten Schwingungen auf und ab wippte.
Kurz vor dem Treffen klingelte mein Handy. »Hallo, liebe Julia«, hörte ich seine Stimme wunderbar und sinnlich an meinem Ohr, »ich bin bereits am Viktualienmarkt und finde unser Lokal nicht!«
Ich musste lächeln über den lustigen knackigen Schweizer Akzent. »Kein Problem, lieber Veit, ich bin praktisch hinter dir und fange dich sofort ein! A tout de suite!«
Ich war tatsächlich sehr aufgeregt und freute mich wahnsinnig, dass so etwas wieder möglich war, während ich den bunten Markt durchquerte. Zwischen all den Menschen fiel mir eine sportliche Gestalt auf, die sich schlank und biegsam nach Frauen umdrehte. Das musste Veit sein. Flinter ihm angekommen, legte ich die Hand sanft auf seine Schulter. »Veit? Der Veit?«
Langsam drehte sich der Mann um. Ich erkannte eine leichte Ähnlichkeit mit dem Foto, aber dieser Mann hier sah verbittert aus mit seinem schmalen zusammengekniffenen Mund und den misstrauisch blickenden Augen, sodass ich enttäuscht war. Er sah mich durchdringend und erstaunt an.
»Ja! Veit! Und du bist Julia!«
Kein Lächeln huschte über sein Gesicht, nichts Verbindliches. Im Gegenteil, er wandte sich starr von mir ab, als wäre ich der Teufel persönlich! Dabei war ich unauffällig, hatte mir nicht einmal die Lippen geschminkt. Ehrlich gesagt sah ich heute zum ersten Mal seit langer Zeit verdammt gut aus, das wusste ich. Und die Ohrringe konnten es doch nicht sein …
»Die Fahrt von Zürich war nicht zu anstrengend?«, fragte ich blöd. Ich brauchte etwas Zeit, um meine Ernüchterung zu verbergen.
»Nein, ganz moderat.« Die warme Stimme und der lustige Akzent passten so gar nicht zu den zusammengekniffenen Lippen. »Ich habe ein paar Geschenke für dich im Auto. Dass wir das nicht vergessen!« Sein winziges Lächeln schaffte es nicht über die Mundwinkel hinaus, während er offenbar bereits die Heimfahrt avisierte.
Und ich hatte morgens das Bett frisch bezogen und die Küche aufgeräumt, Lachs nachgekauft und eine Flasche Champagner in den Kühlschrank gelegt, vorsichtshalber … Na ja, ich versuchte mir lächelnd einzureden, dass mich schwierige Situationen und unnahbare Männer immer schon gereizt hatten, und so versuchte ich das Beste aus der Situation zu machen.
Veit blickte befremdet auf meine spitzen Schuhe. »Kannst du darin laufen?«, fragte er skeptisch.
Kurzum, wir kamen aus dem Bereich merkwürdigen Smalltalks nicht heraus, und auch als wir im Bistro waren, verlief die Unterhaltung seltsam. Er sprach von seinem Haus, seinen Kindern und dass er niemand Fremden in seinem Bad mochte … Verzweifelt suchte ich zwischen den Zeilen nach der Zartheit, die seine Mails charakterisierten. Aber da war nichts. Als wir beim Thema Haustiere angelangt waren und Veit bemerkte, Papageien seien doch wohl gefährlich, reichte es mir. Ich griff nach meiner Jacke und stand auf.
»Das ganze Leben ist gefährlich!« Mit diesen Worten umarmte ich den erstaunten Veit, gab ihm einen sanften Kuss auf die schlaffe Wange und verließ eilig das Lokal.
Puhhhhhh! Meine Schritte wurden schneller, als ich über den Viktualienmarkt lief. An einem nach Nelken und Zimt duftenden Glühweinstand schloss ich die misslungene Erfahrung, ein Phantom per Internet einzufangen, ab. Nach dem ersten Glas musste ich schon lachen, und es schüttelte mich bei der Vorstellung, dass mein Treffen mit Veit anders ausgegangen wäre. Ich wollte nicht schon wieder in einer rosa Schmetterlingswolke gefangen sein und meine traurig erkämpfte Freiheit und Selbstständigkeit gegen demütigendes Warten am Telefon eintauschen, auf kleine Zeichen der Liebe hoffen und Geld verpulvern für Faltencreme, Parfüm, Lachs, Ohrringe und neue Handtücher!
Froh begann ich die winterliche Atmosphäre zu genießen. Der Markt bekam in der aufziehenden frostigen Dämmerung etwas Heimeliges. Bunte Lichter gingen an, verfrorene rote Nasen blickten aus grauen Schals hervor, der Atem der Verkäufer an den Gemüseständen dampfte über Orangen, roten Äpfeln und Krisselkohl. Morgen würde der Fasching beginnen, und dann wäre Veit schon Vergangenheit. Aber heute war noch nicht vorbei, denn wie sich herausstellen sollte, hatte Ngonga seine afrikanischen Zauberkräfte voll eingesetzt …
Der Duft des Frangipani-Baumes
Auf dem Weg nach Hause wünschte ich mir, dass sich mein Leben ändern würde. So machte es nicht allzu viel Freude, obwohl ich mir Mühe gab, aber meine Ansprüche, die nicht nur materieller Art waren, wurden nicht erfüllt. Mein Misserfolg mit Veit zeigte, dass es für Tahim keinen Ersatz gab, und meine Sehnsucht nach Afrika hatte nicht nachgelassen. Wann immer ich Fotos, Briefe oder andere Erinnerungsstücke ansah, schnürte mir Trauer die Kehle zu.
Täglich träumte ich mich nach Afrika zurück und nahm dabei den Duft der sattrosa blühenden Frangipani-Bäume wahr, spürte die dumpfe, feuchte Hitze, sah das vertraute Bangui und den geheimnisvollen Urwald vor mir und spürte Tahim … Gab es keinen Afrika-Memoriam-Verein, der einen Vorstand suchte? Ein Anti-Irgendwas-Projekt mit Neigung zu Eingriffen?
Und dann überfielen mich aus heiterem Himmel Erinnerungen und Bilder an die große Liebe meines Lebens: Tahim in all seiner exotischen Attraktion. Seine geheimnisvollen, dunklen Augen, die mich stets in orientalische Fantasien entführten: zu bunten Diwanen, auf denen wir uns stürmisch liebten; zu endlosem Wüstensand, durch den er mit mir auf einem Rappen zu einer fernen Oase galoppierte, irgendwo in seiner syrischen Heimat. Vor mir erschienen seine markanten Gesichtszüge, seine warme, olivfarbene Haut, die ich zentimeterweise mit Zärtlichkeiten bedeckte, seine festen männlichen Hände, die mich hielten, wenn ich verzagt war. Verzagt war ich häufiger gewesen, etwa wenn er nicht begriff, dass mich sein Geld nicht interessierte und ich nur seine Liebe wollte. Das begann gleich am Tag unserer ersten Begegnung, den ich plötzlich wie in einem Film wieder an mir vorbeiziehen sah.
Damals begoss ich gerade die wohl überstandene Rückkehr meiner ersten Expedition in den Regenwald. Der deutsche Botschafter Hans Schnell hatte mich an diesem Abend auf einen Drink in die schummrige Kneipe »Chez Marianne« eingeladen, in der sich obskure Gestalten aus allen Schichten der Geschäftswelt von Bangui einfanden. Herr Schnell hatte dünne blonde Haare und sah sehr deutsch aus. Er erinnerte an Schrebergarten und Butterbrote und liebte Sätze wie »Es geht hier ums Prinzip!« Er gehörte zu den Typen, die stolz darauf waren, den Plural von Cappuccino zu kennen … und er war bereits zu 77 Prozent mit edlen Tropfen abgefüllt, als er mich über die örtlichen Gefahren informierte:
»Afrika ist in jeder Beziehung ein heißes Pflaster, Julia. Die Menschen hier glauben, mit Geld alles kaufen zu können. Neulich wollte der nigerianische Außenminister die deutsche Botschaft kaufen!« Er bellte los vor Freude, schlug sich begeistert auf die Schenkel und fuhr dann leutselig fort: »…und die meisten erreichen es auch!«
Plötzlich hielt er inne und blickte gebannt zum Eingang, wo in diesem Moment ein mittelgroßer, orientalisch anmutender Mann mit sehr männlichen, scharf geschnittenen Gesichtszügen erschien, der mit durchdringendem Blick die Anwesenden musterte, als wäre er auf Beutezug …
Andächtig kommentierte Schnell den Neuankömmling: »Dieser Mann da ist der Reichtum schlechthin. Monsieur Tahim Sadar, ein Syrer, der seit 40 Jahren hier im Land ist. Was er anfasst, wird zu klingender Münze.« Er neigte sich dicht zu mir und sprach leise und eindringlich auf mein rechtes Auge ein, so als ob ich dort besser hörte. Stattdessen wurde ich fast blind von seiner Alkoholfahne. »Was er haben will, kauft er einfach!«
Mein Gelächter zerstörte den Bann seiner geraunten Botschaft. »Aber Herr Schnell! Ich glaube nicht, dass alles käuflich ist. Ich lasse gerne meine ›Steinesammlung‹ von ihm anfassen, damit sie reichlich klingelt, aber meine Liebe könnte er mit seiner Einstellung nicht kaufen!«
Fasziniert beobachtete ich, wie Monsieur Sadar zielstrebig auf mich zukam, während er auf Huldigungen von dunkelhäutigen wie weißen Anwesenden mit freundlichem Grüßen reagierte. Trotz seiner kommunikativen Gesten schien er mir eindeutig auf der Jagd: Er hatte Hunger, dieser Raubvogel. Aber ich sah auch andere Zeichen in seinem Blick: Melancholie und Sehnsucht. Dieser Mann war ein einsamer Jäger, was mich ungeheuer anzog. Und plötzlich stand er vor mir, raubte mir fast den Atem, als er mir so charmant wie unverschämt in die Augen sah. Meine Haut begann zu glühen, und ich glaubte, leises Knistern zu hören.
Das war der Beginn unserer großen Liebe. Tahim wurde mein Wetter, meine Tageszeit und mein täglicher Sonntagmorgen. Und Afrika wurde mein neuer Alltag. Wir waren so glücklich, dass wir Tag und Stunde vergaßen und bald zum Tagesgespräch Banguis wurden: der unbeugsame, unnahbare Millionär, der plötzlich alles stehen und liegen ließ für die schöne deutsche Lady. Seine Sehnsucht nach Zärtlichkeit und Liebe konnte ich auf viele Weisen stillen, aber mein Wunsch nach Unabhängigkeit von seinem Reichtum blieb unbeachtet. Was immer ich haben wollte, war bereits bezahlt oder wurde mir von Tahim geschenkt. Das engte mich stark ein, und es war ein mühsamer Weg, ihm begreiflich zu machen, wie wichtig mir meine Unabhängigkeit war.
Diese Liebe und meine neue Heimat in Afrika waren für mich das größte Glück, das mir je im Leben widerfuhr. So schön, wie es begann, so fürchterlich und sinnlos war das Ende. Tahims Eifersucht wuchs auf fruchtbarem orientalischem Boden. Er begegnete jedem Mann in meiner Umgebung mit grenzenlosem Misstrauen. Eines Tages brachte mich ein Verwalter vom Jagdlager der Pygmäen aus dem Dschungel zurück, da ich unter Malariaanfällen litt. Tahim entwickelte eine rasende Eifersucht auf den Mann, der mir doch nur freundlich geholfen hatte, und es kam zum endgültigen Bruch. Trotz all meiner verzweifelten Versuche, unsere Liebe zu retten, blieb Tahim hart. Er löste sich von mir und wollte sogar, dass ich nach Europa zurückginge.
Ich blieb noch einige Wochen und hoffte inständig, dass es noch eine Chance für uns gäbe, um die ich heftig kämpfte. Denn ohne Tahim und jenseits von Afrika erschien mir mein Leben sinnlos. Und so war es ja auch gekommen. Seit ich wieder in Europa war, seit ich meine Tochter und dann noch die Eltern verloren hatte, empfand ich mein Leben als sinnlos.
Die Erinnerungen trieben mir die Tränen in die Augen, und ich fragte mich, wie ich je wieder glücklich werden könnte, nachdem ich das eine große Glück gefunden und verloren hatte. Konnte ein solches Glück ein zweites Mal auftauchen? Würde ich - gegen jede Wahrscheinlichkeit - doch noch mal nach Afrika kommen? Vielleicht käme es ja eines Tages, das ersehnte Telegramm, das mich zurückholen würde: » Chérie, je t’aime toujours. Reviens! Tahim. «
Plötzlich klopfte mein Puls laut in den Ohren, im ganzen Kopf pulsierte es heftig, und auf einmal war ich sicher, dass etwas geschehen würde. Irgendetwas rührte sich und wartete auf mich! Übermütig rief ich laut: »Oui! J’arrive!«, und lief schneller.
Ein vorbeiradelnder junger Mann drehte sich grinsend zu mir um und rief: »Okay! Bis später, Süße.«
Der Brief
Zu Hause angekommen, öffnete ich - eilig, hellseherisch - den Briefkasten. Ein Brief des World Wildlife Fund in Frankfurt fiel mir entgegen, und ich ahnte: Dies war die Wende. Ging endlich mein Wunsch nach Veränderung, nach einer neuen Zukunft in Erfüllung? Ich drehte den Brief in den Händen und wollte ihn vor lauter Vorfreude nicht öffnen. Ich raste in meine Wohnung, schleuderte meinen Mantel in eine Ecke und stellte Ngonga in die Mitte des orientalischen Messingtisches.
»Du hast dich also auch gelangweilt!« Übermütig gab ich ihm einen Kuss auf das dicke Holzmaul, schenkte mir ein Glas Pastis ein, ohne Wasser, nur mit einem Stück Eis, und nahm einen königlichen Schluck, der mir brennend die Kehle hinablief. Dann setzte ich mich in den Sessel und schaute erwartungsvoll den Brief an: Er sollte sich jetzt vorlesen! Ich wollte meine Vorfreude genießen, mich in freudiger Geduld üben und zählte bis 22. Dann hielt ich es nicht länger aus und riss das Kuvert auf, wobei mir das Blut in den Halsadern pochte.
Sehr geehrte Frau von Laue,
in der Hoffnung, dass es Ihnen gut geht, wende ich mich mit einem großen Anliegen an Sie. Ich glaube, dass Sie, mit Ihrem Organisationstalent, Ihrer Durchsetzungskraft und den Beziehungen zu Ihren einflussreichen zentralafrikanischen Freunden genau die richtige Ansprechpartnerin sind.
Es ist ja nun fast drei Jahre her, dass wir uns in Bangui getroffen haben, und mit Begeisterung erinnere ich mich an unsere lebhaften Gespräche über Ihre vielen hochinteressanten Expeditionen 1980 zu den Pygmäen, die ja zu dieser Zeit noch auf Steinzeitstufe lebten. Ihr Engagement für den Erhalt des Regenwaldes hat mich sehr beeindruckt. Sie wollten damals ein Areal pachten, um den Wald vor Raubbau und illegalem Einschlag der Holzgesellschaften zu schützen und Ihren Pygmäenfreunden so ein unantastbares Gebiet zu sichern. Das bewunderten wir sehr, zumal Sie Ihre Unternehmung im Alleingang durchführen wollten. Umso mehr bedauerten wir natürlich, dass Ihnen Monsieur Tahim Sadar als der größte Holzkonzernbesitzer bei dem Landerwerb zuvorkam.
Lassen Sie mich also zur Sache kommen: Als Leiter des Fachbereichs »Tropische Wälder« sehe ich mich nun in der Lage, Ihnen Ihrem früheren Engagement in der Zentralafrikanischen Republik entsprechend folgendes Angebot zu unterbreiten: Bei der Erweiterung unseres neuen Trinationalen Schutzparks »Dzanga-Sangha« im Länderdreieck ZAR (der Bayanga-Region), Kamerun und Kongo ergibt sich die Gelegenheit, ein naturnahes Touristenprojekt einzurichten. Mit den Einnahmen durch den Besuch des Nationalparks konnten die laufenden Projektkosten gedeckt werden (Gehälter für 40 Ranger, die den Park vor Wilderern schützen, Waffen, Wagen usw. wie auch die langfristige Pacht des Nationalparks). Wir würden uns freuen, wenn Sie an diesem Projekt Interesse hätten und den Wiederaufbau der Lodges und deren Leitung übernehmen könnten. Damit gelänge uns sicherlich eine Neubelebung des zentralafrikanischen Öko-Tourismus. Finanziell und werbetechnisch würde Ihnen ein Reiseunternehmer aus Nürnberg, Herr Würstel, zur Seite stehen, der sehr an einer Zusammenarbeit mit Ihnen interessiert ist. Ihnen würde es obliegen, einen nationalen Geschäftsmann beizubringen.
Als touristische Attraktionen ließen sich im Nationalpark folgende Programme ausbauen: Pygmäenprogramme: Jagd, Heilpflanzenkunde usw.
Bitte nehmen Sie baldmöglichst Kontakt auf mit… usw. …
Ich hatte während des Lesens die Luft angehalten und ließ sie nun mit einem Pfiff hinaus. »Mon Dieu!«
Vor Freude tanzte ich durchs Zimmer, drückte Ngonga an mich, und zusammen wirbelten wir über das Parkett. Das Leben war schön, mannomannomann, wunderbar, und ich hatte es mir verdient, voll verdient.
Ohne lange zu fackeln, würde ich mitten hineinspringen in diese Chance, die mir all das bot, was ich mir seit meiner Kindheit erträumte: Seit ich zurückdenken konnte, war es mein frühester Traum, Urwaldforscherin zu werden. Dreißig Jahre später sollte der Traum nun Wirklichkeit werden.
Endlich konnte ich die Erfahrungen von immerhin sieben Jahren umsetzen, die ich bei meinem ersten Afrikaaufenthalt gemacht hatte: Ich hatte den Urwald kennengelernt, Pygmäen, Elefanten, Schlangen, Raubtiere und auch Höllenangst. Zwar war ich keine Forscherin im Sinne von Studium und Feldforschung, aber ich hatte meine ganz eigene Forschung betrieben und sie als Fotografin in meinen Bildbänden festgehalten. Ich hatte diverse Expeditionen zu den Aka-Pygmäen gemacht, hatte Ängste und Freude im Urwald erlebt und allmählich das Vertrauen und die Freundschaft der Urwaldmenschen gewonnen.
Meine Gedanken kehrten zurück zu Ibengy Mbounsola, dem Jagdlager meiner kleinen Freunde, das tief im unzugänglichen innersten Regenwald lag. Hier war ich von ihnen vielen exotischen Prüfungen unterzogen und schließlich in ihre Gemeinschaft aufgenommen worden. Gemeinsam verfolgten wir skrupellose Wilderer auf Elefantenjagd und räucherten sie schließlich aus. In den mineralhaltigen Bais hatten wir manchmal bis zu 60 Elefantenfamilien beobachtet, die Njokou, wie die Pygmäen ihre hochgeehrten Waldelefanten nannten, und die eleganten, weiß gestreiften, fast ausgerotteten Sitatunga-Antilopen, die Mbliyas. Wir waren von Rotbüffeln gejagt worden, bis auf die Bäume, und mit der Armbrust auf Affenjagd gegangen. Wir hatten in selbst angelegten Kanälen Welsen und anderen Fischen aufgelauert. Im Laufe der Jahre waren wir Freunde geworden, und die kleinen Waldmenschen hatten mir ihr Wissen über die Schätze des Regenwaldes geschenkt.
Außerdem brachten sie mich dem eigentlichen Sinn des Lebens wieder nahe: die Natur zu achten, den gegenwärtigen Tag zu leben, die Familie zu respektieren und Traditionen einzuhalten. Ich schätzte die Lebensart der Pygmäen, denn der elementare Sinn des Lebens entsprach meinem Wesen. Ich ehrte ihren weisen Waldgott Zèngi, der ihnen stets mit Rat zur Seite stand, und ebenso die Geister, die Menschen unsichtbar machen konnten, gute Jagd versprachen, Kinder schützten, Tiere verkörperten … und so war ich schließlich initiiert worden.
Dabei wurden mir mit einem Bambusmesser glücksbringende Zeichen tief in die Haut der Oberarme geschnitten und die Wunden anschließend mit frischer Asche bestäubt. Im Laufe der Zeit entwickelten sie sich zu schwülstigen Narben. Ich erlebte Geburten und Todesfälle, lernte den Aka-Dialekt, hörte den Märchenerzählern zu und lernte die Tänze. Die Pygmäen - knapp 1,45 Meter groß - lachten sich halb tot, wenn ich - zirka 1,70 Meter -, die »große weiße Mama Tschulia«, begeistert neben ihnen mit breiten Füßen und wackelndem Po im Sand herumfegte. Ich war verliebt in ihren schwarzen Humor, der noch krasser war als meiner.
Einmal kamen meine Freunde Mungo, Maseke und Bosso von einer langen Jagd zurück, bei der sie in die Nähe einer Bantusiedlung gekommen waren. Unterwegs hatten sie ein buntes Tuch gefunden, offensichtlich ein Halstuch, und brachten es triumphierend mit ins Lager. Mungo sagte schmunzelnd, mit einem verstohlenen Seitenblick zu mir: »Der Rest von einem neuen Besucher.«
Ja, ich war glücklich, während ich an all dies dachte. Ich konnte wieder nach Hause, endlich!
Dem Brief lag sogar ein Vertrag bei. Ich versuchte mit kühlem Kopf alle Konsequenzen zu durchdenken und schrieb sofort alles auf, was zu erledigen war. Dabei nahm ich mit einem Blick aus dem Fenster auf fünf der schönsten Kirchen Münchens, die seit ein paar Monaten mir gehörten, bereits Abschied. Bei meiner Planung ging ich zielstrebig und effizient vor, und bald hatte mein Projekt klare Formen angenommen. Was noch unklar war, würde sich fügen.
Zu den ungeklärten Dingen gehörte Tahims Meinung zu meiner Rückkehr. Keineswegs durfte ich ihn mit meinem plötzlichen Auftauchen in Bangui überrumpeln. Er sollte wissen, dass ich ihn immer noch in mein Leben einbezog. Außerdem brauchte ich seinen Rat und seinen Schutz. Als allein stehende Frau in Afrika war man auf Freunde und Beschützer angewiesen, oder man ging in jener ausgeprägten Macho-Männerwelt unter, wurde übergangen, schließlich als Außenseiter der Gesellschaft verachtet und dann vergessen.
Ich musste Tahim noch mal anrufen. Sicherheitshalber erklärte ich erst dem Spiegel, was ich ihm am Telefon erzählen wollte, unterstrich mein Anliegen mit lebhaften Gesten und verbesserte immer wieder mein Französisch. Schließlich schminkte ich mich und fuhr mir durch die Haare, ja, das sah gut aus, was mir da mit grünen Augen und schwarzen Haaren aufgeregt entgegenstrahlte. Noch ein paar duftende Tropfen von meinem afrikanischen Duft »Mille« aus dem Kühlschrank, wo er die dürren Monate seit meiner Abreise aus Bangui überlebt hatte, und endlich fühlte ich mich gewappnet.
Wieder raste mein Herz. Was würde er sagen, würde er guter Stimmung sein, war er überhaupt da? Es klingelte von weither. Ich sah den Mann meines Lebens vor mir, einige tausend Kilometer entfernt, bei 42 Grad im Schatten. Kein Wunder, dass mir heiß wurde, ich knöpfte den Pulli auf.
»Bonjour, ici Sadar!« Mir wurden die Knie weich, und die Stimme versagte, als ich Tahim hörte. Ich presste das Ohr ganz dicht an den Hörer und räusperte mich. »Salut, Tahim, comment ça va?«, begann ich banal. Unsere Stimmen überschnitten sich mit dem Echo.
»Merci, Julia, grâce à Dieu!«
Wieder nahm mir seine tiefe, etwas herrische Stimme fast den Mut, aber ich musste da durch, und zwar schnell, bevor er das Gespräch abschnitt. »Ich möchte gern deine Meinung hören in einer wichtigen Angelegenheit.«
Es kam keine Antwort. Mir wurde noch heißer, und wie in Trance zog ich mir das T-Shirt über den Kopf.
»Alors, ich habe ein Angebot, nach Bayanga zu kommen, um dort die Lodges im Urwald zu übernehmen. Das ist immerhin ein ganz einzigartiges Naturschutzgebiet und das drittgrößte der Erde. Es gehört noch zum gewaltigen Kongo-Becken, wo der Sangha River vorbeifließt. Das wäre doch eine tolle Sache für die RCA. Was denkst du?« Dabei hatte ich mir den BH aufgehakt und nestelte nun nervös an den Trägern.
»Hier neue Geschäfte anzufangen ist schwer. Wir hatten inzwischen Aufstände im Land, wie du ja vielleicht gehört hast«, kam es zögernd vom anderen Ende. Tahim machte nie spontane Zu- oder Absagen. Außerdem war er in vielen Dingen von einem orientalischen Fatalismus, der in völligem Gegensatz zu meiner Spontaneität stand und mich früher häufig zur Verzweiflung getrieben hatte.
»Ja, aber es ist die einzige Chance, den großen Nationalpark mit Tourismuseinnahmen zu unterstützen. Wirst du mir helfen? Bitte, Tahim, ich brauche deine Freundschaft! Und vielleicht kannst du ja mit einsteigen … Sie wollen einen nationalen Teilhaber. Es würde ja reichen, wenn du ehrenhalber dabei bist!« Beschwörend starrte ich das Telefon an, während ich eine Haarsträhne so fest zwirbelte, dass es schmerzte. In der folgenden Pause stand ich Ängste aus. Wenn er dagegen war und ich trotzdem fahren würde, hätte ich den schwierigsten Stand meines Lebens. »Bon, on verra! Wann willst du kommen?«
Ich stieß einen Stoßseufzer aus und schleuderte triumphierend meinen BH weit von mir. »Merci, Tabim, merci. T’es génial et je t’adore. Ich werde in spätestens zwei Wochen in Bangui sein. Bis dahin faxe ich dir noch Genaueres.« Langsam versagte meine Stimme, und fast flüsternd hauchte ich: »Merci, Tabim, et à très bientôt! Je t’embrasse …«
Damit war der Slip gefallen, während ich mir die Lippen blutig biss, um nicht zu sagen, wie sehr ich ihn liebte, wie groß meine Sehnsucht nach ihm war.
»A bientôt, Julia, je t’embrasse!«
Klick, es wurde aufgelegt, Ende! Und ich stand nackt im Zimmer, den Telefonhörer wie ein heiliges Relikt unserer Beziehung in den Händen.
Jaaaaaa!! Dann legte ich Offenbach auf, und tanzend sang ich lauthals mit Bocelli die sehnsuchtsvolle Barkarole:
Le temps fuit et sans retour
Emporte nos tendresses
Loin de cet heureux séjour;
Le temps fuit sans retour.
Zéphyrs embrassés,
Versez-nous vos caresses;
Zéphyrs embrassés,
Donnez-nous vos baisers.
Ah!
Meine Stimme schwankte, vor Lachen, vor Weinen, als ich den traurigen, verheißungsvollen Text weitersang, von der fliehenden Zeit, die unsere Zärtlichkeiten fortträgt, fern der glücklichen Tage, der schönen Liebesnacht, süßer als der Tag, oh, Lächeln unserer Träume … Nacht der Liebe.
Belle nuit, 6 nuit d’amour,
Sourie à nos ivresses;
Nuit plus douce que le jour,
O belle nuit d’amour!
Ab, sourie à nos ivresses,
Nuit d’amour, 6 nuit d’amour!
Ah!
Aaaabhhhhhhhh!
Dabei sammelte ich meine Wäsche ein. Nur ein paar Worte von Tahim hatten noch gefehlt, und der natürlichste Striptease meines Lebens wäre vom spontansten Orgasmus gekrönt worden!
Aber Schluss damit! Erst mal sollte ich jetzt Geschäftsfrau sein, dann eine Abenteurerin, dann erst eine Frau. Sonst würde es nie was mit meinem neuen Leben.
Unternehmungslustig nahm ich alles Nötige in Angriff, bereitete die Untervermietung meiner Wohnung vor und machte mich, aufgekratzt wie ein warmer Frühlingsacker, auf den Weg zu meinem zweiten Wohnzimmer auf dem Viktualienmarkt, dem »Poseidon«.
Bei einem Schluck Burgunderwein begrüßte ich ein paar Stammgäste, die für mich viel mehr waren: Mitwisser intimer Beichten, Verschwörer politischer Empörungen und einfach Freunde, die den kleinen Sehnsüchten die Stange hielten. Schließlich hatten sie alle ein Recht darauf, mit mir das Ende meines jetzigen Münchner Lebensabschnitts zu feiern, und es wurde ein wehmütiger Abschied, der allerdings auch eine bittere Pille enthielt.
Meine Freundin Bettie, die mich seit langem kannte, war mit meinen Plänen nicht einverstanden: »Auch wenn du mich für verrückt hältst, ich finde deine Entscheidung falsch. Ich weiß, es hat wenig Sinn, dass ich versuche, dir etwas auszureden. Aber zurück nach Afrika zu gehen, zu Tahim, ist falsch. Du wirst dort vor die Hunde gehen, unnötig alte Wunden aufreißen. Tu es nicht, Julia.«
Ich war fast erschüttert, dass sie meine Riesenfreude nicht teilte, und eine Weile saßen wir verstimmt beisammen. Hatte sie Recht, oder gönnte sie mir meine Freude nicht?
»Julia geht wieder nach Afrika!«, schallte es durch den Raum, und alle Freunde diskutierten heftig über meine Entscheidung.
Bettie aber stand auf und sagte nur: »Meine Liebe, du wolltest meine Meinung zu dem Thema hören, die hast du bekommen. Aber du wirst einen Teufel darauf geben, du wirst natürlich trotzdem fahren, sonst wärest du nicht meine Freundin Julia!«
Damit gab sie mir einen dicken Kuss, den ich erwiderte. Die Gäste um uns herum klatschten Beifall, und ich bekam vor Rührung feuchte Augen.
»Ach, Bettie«, flüsterte ich, »ich kann doch nur gewinnen, das eine oder das andere, vielleicht sogar beides.«
Von Olli bekam ich Unterstützung. »Das Bestechende an Julia ist, sie schafft es. Immer
wieder …«
»Na ja, ich glaube eben an den Sinn jeder Strecke einer Reise«, lautete mein Kommentar dazu.
Und in lautstarkem Chor zitierten wir gemeinsam meinen Leitspruch:
»Die Gabe, seines Glückes Schmied zu sein, Hat nur der Bauer, nicht das Schwein.«
Und nach genau diesem Motto versuchte ich in den nächsten Tagen einen Kredit zu bekommen, den ich für den Start meines Afrika-Unternehmens brauchte. Ohne Reserven war es fast aussichtslos.
Aber als ich bei der dritten Bank einen Termin vereinbarte, erklang in meinem Kopf eine bekannte Stimme: »Mach was draus, liebe Julia.«
»Ngonga, bist du das?«
»Oui! C’est moi, ton fétiche!«, erklang es aus dem breiten Hippo-Maul meines Glücksbringers.
Und siehe da, afrikanische Kräfte überzeugten die deutschen Bankfritzen, und ich bekam meinen Kredit.
Nun musste ich nur noch was Gutes daraus machen, immerhin hatte ich mir jetzt einen ordentlichen Berg Schulden aufgehalst.
Rückkehr nach Afrika
Als am 17. März nachts um halb drei mein Wecker klingelte, überkam mich ein merkwürdiges Gefühl, begleitet von heftigem Pulsschlag: Es war der Impuls zur Flucht, einer ganz normalen Flucht vor meinem ganz normalen Wahnsinn … Wenn ich nun nicht flöge? Ich hätte weniger Schulden und weniger Ängste, dass irgendjemand irgendwann noch Nein sagen könnte. Wenn ich nun einfach liegen bliebe? Zaudernd drückte ich mich tiefer in das weiche Kissen. Noch könnte ich meine Entscheidungen für ein neues, riskantes Leben rückgängig machen und ein geregeltes Leben in Deutschland führen.
Doch - und jetzt sprang ich aus den Federn - genau diesen immer gleichen, überschaubaren Alltag wollte ich nicht! Ich hatte mich bereits gehäutet und mir fest vorgenommen, alle Altlasten und Dramen hinter mir zu lassen. Keine Sekunde wollte ich mehr verschwenden. Es galt, endlich das Glück zu packen.
Ich zog mich an, kontrollierte noch mal mein Gepäck und bestellte ein Taxi. Ein letztes Mal sah ich mich in meiner kleinen Wohnung um, deren Weitervermietung Bettie übernehmen wollte, und nahm Abschied von den chinesischen Körben, Mamis Sekretär, italienischem Geschirr und alten Landschaftsbildern. Da hörte ich plötzlich leise, aber deutlich Chor und Orchester … La Paloma. Ganz sicher kam die Musik nicht aus meinem Radio oder vom Nachbarn! Kukurukukuuuuhh, Paloma. Das kannte ich doch! Das letzte Mal hatte ich den Refrain vor rund fünf Jahren im Urwald gehört! Auch mit Orchester und Chor!
»Ja doch, ich komme schon!«, antwortete ich auf den inneren Ruf.
Eilig packte ich meine übrige Reisegesellschaft auf dem Handtrolley zusammen: Ngonga rollte ich in ein Taschentuch und schützte seine kleinen, spitzen Ohren, Ngúâ kam ins Portemonnaie, und Línzí, die kleine Viper, fand eine Nische in der Kosmetiktasche. Schwer hingen Taschen und Koffer an meinen Seiten, als ich sorgfältig die Haustür hinter meinem geregelten Leben verschloss. Ja doch, ich kam!
Abflughalle München, dann Paris, dann die fast helle Nacht über dem Atlasgebirge, das in schimmerndes Gold und morgendliches Lila gehüllt seine unvergänglichen Gipfel und klaffenden Schluchten zeigte. Der Anflug auf N’Djamena in die aufgehende Sonne über dem afrikanischen Kontinent. Der Anblick kroch mir so tief unter die Haut, dass sich meine Haarwurzeln zu einem vibrierenden Pelz zusammenzogen und Gänsehaut mir die Arme hochschlich. Mein Wiedersehen würde göttlich sein, alles würde ich erreichen können nach diesen schönen Augenblicken. Wie könnte ich je wieder verzagen!
Wie immer setzte die Maschine holprig auf der Piste im Tschad auf, und fast im gleichen Augenblick schnellte die Temperatur im Flieger auf mindestens 35 Grad und stieg noch weiter an. Mir war alles recht, sogar die dicke schwarze Lady, die einen gelb-roten Boubou, das lange Kleid der Afrikanerinnen, um ihren wogenden Busen und die dicken gespreizten Schenkel gewickelt hatte und sich mit Parfüm einsprühte, sodass ich vorübergehend in Nebel getaucht war.
» Ça va?«, fragte sie in dem breiten Französisch der Afrikaner und schenkte mir ein freundliches Lächeln, das perlweiße Zähne im tiefrot geschminkten Mund entblößte.
»Oui, Madame, tout va tres, très bien!«
Ich lächelte zurück, während sie den restlichen Rotwein trank und ihre Sachen zusammenpackte, sodass ich nun gänzlich unter Chiffontüchern, einer rosa Strickjacke, einer großen, geplatzten Printemps-Geschenketüte und einer alten, prall mit Cremes, Lockenwicklern und einer Spielzeugeisenbahn gefüllten Ledertasche begraben wurde. Mir war alles recht …
Noch mal umsteigen. Mit jeder Flugmeile, die mich Bangui näher brachte, klopfte mein Herz lauter. Beschwörend streichelte ich Ngonga: Lass es bitte gut werden! Und wie damals sah ich aus dem Fenster, erinnerte mich daran, wie Tahims blaue Limousine in rasender Geschwindigkeit über das Rollfeld fuhr und meinen Blicken entschwand; hörte seine letzten Worte: »Ich habe mir noch etwas überlegt.« Ich hatte nie erfahren, was das war und ob mein Schicksal einen anderen Verlauf genommen hätte, wäre er rechtzeitig zurückgekommen, bevor mein Flieger abhob.
Ich sah Tahim vor mir, seine unergründlichen dunklen Augen, die mich mit orientalischer Melancholie anblickten. Mon amour, so stark wie mein Leben, so stark war meine Liebe zu dir, nichts könnte sie je zum Erlöschen bringen, und sie würde sich erfüllen, irgendwann …
Der Urwald tat sich unter mir auf, die früheren Trassen hatten sich inzwischen in einen breiten, hellen Kahlschlag verwandelt. Das satte tiefe Grün des Primärwaldes war in dem blassen Teppich nur noch selten zu sehen. Ein trauriges Bild, das ich lange vorausgesagt hatte und das niemand wahrhaben wollte. Ich hörte noch die Worte von Laurence, meinem besten Freund in Bangui: »Aber Julia, deine Sorge ist völlig unbegründet, hier wächst alles wieder nach!«
Nichts wuchs nach, das war klar, denn jahrhundertealter Regenwald mit all seinen Tieren und den zahllosen Wundern der Natur konnte, wenn die Menschen ihn nicht in Frieden ließen, weder sein Gleichgewicht erhalten noch sich in kurzer Zeit von deren Sünden regenerieren. Trauer mischte sich wieder in mein Glück. Wir lebten doch in engster Abhängigkeit von der Natur!
Der Anflug auf Bangui begann. Der Oubangui schlängelte sich träge glitzernd durch die Stadt. Ich sah die ärmlichen Baracken am Flughafenviertel, die Rollbahn mit ihren schwarzen Gummispuren, dann die aufstiebenden Nashornvögel. Gepäck rutschte durch den Gang. Bangui-Mpoko, Heimat.
Als ich unter der fahlen Sonne, die sogar schon am frühen Morgen sengend war, die Gangway hinunterschritt, erinnerte ich mich schmerzlich, mit welcher Verzweiflung ich vor fast zwei Jahren die gleiche Strecke in anderer Richtung zurückgelegt und dieses Land verlassen hatte. Mit diesem Abschied war eine düstere Zeit für mich angebrochen.
Der Schwarm der glücksbringenden Nashornvögel ließ sich in den hohen gelben Grasbüscheln nieder, und die sechs verdorrten Palmen fächerten trist gen Osten. Das hässliche Flughafengebäude, flachbrüstig und bröselig, versprach nur wenig Kühlung gegen die sengende Hitze, geschweige denn Linderung gegen die fast 87 Prozent Luftfeuchtigkeit. Die rosaroten Träume, die ich aus meiner alten Heimat Afrika mitgenommen hatte, lösten sich hier plötzlich in graue Wirklichkeit auf, und ich nahm - live - ein stinknormales, ziemlich verrottetes Bangui in seiner kaputten Umgebung wahr. Aber ich wollte dieser Stimmung nicht nachgeben, ich würde mein Afrika wiederfinden, das war sicher!
Bunt gekleidete Menschen auf der Zuschauerempore freuten sich, winkten unter lauten Rufen Verwandten oder Freunden zu, und schon stand ich inmitten eines abenteuerlichen Stroms an Reisenden vor den drei Abfertigungsschaltern. Englische, französische und Sango-Sprachfetzen vermischten sich. Um mich herum beobachtete ich freudige Gesten, Männer in Kaki-Uniformen und Frauen in bunten Boubous.
Erwartungsvoll musterte ich die Menschengruppe in der Halle hinter der Absperrung. Unter den vielen schwarzen und wenigen weißen Gesichtern erkannte ich einige und freute mich, wir winkten uns zu. Es tat verdammt gut, hier bekannte Gesichter wiederzusehen.
Ich suchte weiter, hoffnungsvoll, obwohl mir meine innere Stimme sagte, es sei umsonst. Tahim würde nicht da sein! Ich versuchte meine Enttäuschung zu beherrschen, doch gelang es mir nicht so recht; noch dazu drängte sich gerade dicht neben mir eine junge weiße Frau mit einem süßen olivhäutigen Baby auf dem Arm vorbei. Es hätte Maria sein können, das gleiche Alter, und meine Tochter hätte sicher die gleiche Hautfarbe…
»Julia, ce n’est pas vrai!«, rief plötzlich eine tiefe Frauenstimme neben mir und riss mich aus meinen trüben Gedanken. Schon wurde ich herumgewirbelt und landete in den Armen von Félicité, meiner alten Freundin. Sie war wunderschön in ihrer dunklen Sanftheit mit den ausgefallenen, zuluartig hochgesteckten Zöpfchen, die sicher in stundenlanger Feinarbeit von ihren Cousinen gefertigt worden waren. In dem orangegold glitzernden langen Kaftan sah sie umwerfend aus!
»T’es belle comme la reine de Saba«, begrüßte ich sie bewegt, und dann kreischten wir vor Freude, sodass die Zöllner aufmerksam wurden. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden.
»Et toi, chérie, tu reviens?« Tausend Fragen standen in ihren großen dunklen Augen. Ihre erotischen, fast violetten, innen hellrosafarbenen Lippen blieben erwartungsvoll geöffnet. Die pralle dunkle Haut glänzte - diese Sinnlichkeit, gelebt und offenbart wie hier, das hatte ich besonders vermisst…
»Oui, chérie, je suis revenue!«, bestätigte ich mit einer Selbstverständlichkeit, die keine Fragen offenließ, und meine Freundin erwiderte mit dem Langmut einer afrikanischen Mama und weisem Nicken:
»C’est bon!«
Wir küssten uns herzlich nach hiesiger Sitte, zweimal rechts, zweimal links und noch zweimal rechts.
»Wo ist Tahim?« Sie schob mich ein wenig von sich weg, damit sie mir besser in die Augen sehen konnte. Doch als ich sie beschämt niederschlug, winkte sie beruhigend ab. »Ça va s’arranger, ma chère Julia! Es kommt alles in Ordnung.«
Da lärmten auch schon die Kofferträger in der Menge und bahnten sich einen Weg zu mir. »Madame Sadar, wir nehmen Ihr Gepäck.« Und schon hatten sie mein Ticket geschnappt. Gott sei Dank war Jérôme dabei, ein alter Kumpel aus früherer Zeit. Zu ihm hatte ich - im Gegensatz zu den anderen dunklen Gestalten - Vertrauen.
»Dieser Idiot von Tahim!«, fuhr Félicité unbeeindruckt fort. »Fast jeder hier in Bangui kennt dich und weiß, dass du diesen Mann liebst. Du bist schön. Was will er denn noch?« Mit einer eleganten Geste winkte sie ab und schob sich unwirsch den Boubou über die Schulter.
Plötzlich standen neben mir Mallo, Tahims dicker Chauffeur in seinem viel zu engen Sonntagsanzug, und Jacki, portugiesisches Faktotum, das für Tahims Familie sein Leben geben würde.
»Madame Julia!« Beide strahlten über das ganze Gesicht und streckten mir die dunklen Hände zur Begrüßung entgegen. »Le patron nous a envoyés!«
Und da jubelte ich innerlich, endlich beschützt und willkommen. Er hatte also an mich gedacht.
Ich verabschiedete mich von Félicité, versprach, mich am Wochenende zu melden, und schob dann Mallo zum langen Zolltisch. »Vite, Mallo, la valise!« Gerade sah ich, wie mein Gepäck dort unter lauten Rufen von einer Horde aus inzwischen mindestens 15 Kofferträgern aufgeteilt werden sollte. Alle witterten ihre große Chance, denn inzwischen hatte sich herumgesprochen, dass ich die Frau des Patron Sadar war, des reichsten und mächtigsten Mannes des Landes. Dass meine Beziehung zu ihm der Vergangenheit angehörte, interessierte hier offensichtlich niemanden.
»Nzoni! Mû na mbi âsandûku nî!«, hörte ich die strenge Stimme von Félicité.
Und wie von Zauberhand berührt, beruhigte sich die zerlumpte Meute der Träger. Sie hatte den armen Mallo schon dermaßen in die Zange genommen, dass er schwitzend und fluchend hilflos zwischen ihnen herumpaddelte. Der Streit legte sich, und die Koffer wurden dem muskulösen Jacki ausgehändigt. Ich gab dem Ältesten 3000 CFA, umgerechnet 4,50 Euro, was eine Menge Geld war, und forderte ihn auf, mit den anderen zu teilen.
Dann winkte ich dankend Félicité zu, die gerade auf Sango eine gut gekleidete schwarze Reisegruppe begrüßte. Dass sie für den Präsidenten Patassé arbeitete, wusste jeder, und so erntete sie nicht nur aufgrund ihrer bescheidenen, wenngleich klaren und bestimmten Art überall Respekt. Sango sprach ich leider kaum, obwohl diese Umgangssprache leicht zu lernen war und mit nur 360 Vokabeln aus einem Gemisch aus Bantu, Banda und einigen französischen Brocken bestand.
Endlich saß ich nass geschwitzt, doch glücklich und aufgeregt neben Mallo im Rover, und schon ging es los. Fast wie in früheren Zeiten, dachte ich mit leichter Wehmut. Und dann stieg in mir, ungefragt und ohne der pragmatischen Stimme in mir Gehör zu schenken, mein allgegenwärtiger Optimismus empor und sagte mir, dass es wieder wie früher werden würde. Hätte ich diesen Optimismus scheibchenweise verkaufen können, ich wäre steinreich geworden, denn er war unerschöpflich. Dabei wusste ich nicht einmal, wo ich wohnen sollte!
Bangui, sagt die Liebe
»Mallo, ich bin sehr glücklich, wieder hier zu sein. Wie geht es euch, deiner Familie und den Kindern? Deiner schönen Frau?«, fragte ich meinen Freund und Vertrauten früherer Zeiten, während ich gierig die an mir vorbeiziehenden Bilder und fruchtig-süßlichen wie herben Düfte von Bangui in mich aufnahm. Zu lange hatte ich dies alles entbehren müssen, und sollte meine Reise hier und jetzt enden, ich wäre glücklich, so glücklich wie schon lange nicht mehr.
»Ach, Madame, seit dem letzten großen Aufstand … Er fing genau eine Woche an, nachdem Sie nach Hause geflogen waren …«
Ich zuckte zusammen. Nach Hause!
»Mallo, wie kannst du so einen Unsinn reden. Hast du vergessen, dass ich hier zu Hause bin?«, unterbrach ich ihn.
Er nickte mir freundlich zu und fuhr fort: »…da ging der große Aufstand los, an dem wir noch bis heute leiden. Meine Cousins sind auf offener Straße erschossen worden, als sie nach der Arbeit zu ihren Familien wollten. Es war für uns alle sehr schlimm!«
Wir fuhren gerade durch das Cartier Fou, wo kein Stein mehr auf dem anderen stand. Hütten waren eingestürzt, Häuser verkohlt, und die Menschen starrten desinteressiert vor sich hin. Dieser Anblick war die Bestätigung von Mallos Bericht. Welche Schrecken mussten sich hier ereignet haben! Das Cartier Fou, das »verrückte Viertel«, hatte ich als das schwärzeste und aggressivste Viertel in Bangui in Erinnerung. Hier waren Leben und Tod eng beieinander, immer begleitet von allgegenwärtiger, lauter Zouk-Musik aus Ghettoblastern. Zwischen den fantasievoll zusammengebauten Baracken hatten sich regelmäßig kriminelle, geile, ausgelassene Szenen abgespielt, es war ein armes Viertel gewesen, aber immer quirlig.
Es kam noch schlimmer. Wir fuhren über Straßen, die aufgerissenen Schotterhaufen glichen und mit ihren unpassierbaren Kratern zu lebensgefährlichen Slalomfahrten zwangen. Wir gelangten zum Markt, den die Leute Kilomètre Cinq oder kurz 5 kilos nannten, da er sich über fünf Kilometer hinzog. Wie die meisten afrikanischen Märkte zeichnete er sich durch bunte Vielfalt aus. Alles, was man in Europa fortwerfen, heimlich vergraben oder schnellstens verschenken würde, lag hier in der glühenden Sonne zum Verkauf: alte Tabletten, Salben, milchige Tinkturen, abgemagerte, verletzte Hühner, blutige Hammelköpfe mit milchig verdrehten Augen, rote und blonde Haarteile, Gebisse, Brillen in riesigen Bergen, die viele schwarze Hände zerwühlten. Manches stank zum Erbarmen, wie die aufgehängten Meerkatzen, die leblos an dünner Schnur im leichten Wind schaukelten, Berge schwarz geräucherter Raupen, dicht neben den Dreckpfützen der staubigen und lebhaft befahrenen Schotterstraße …
Die kleine Regenzeit, die auch Mangoregen genannt wurde, da sie die Mangoblüte vorantrieb, hatte bereits eingesetzt, und so waren die Straßen voller Schlammlöcher und die normalerweise grünen Straßenbüsche von einer grauen Dreckschicht bedeckt. Hinter einer Kurve erkannte ich endlich auch ein wenig von dem anderen, dem Schönen, Geilen, Bunten und Duftenden, wieder. Hier wurden die Früchte der so üppigen Natur zum Kauf angeboten: Ananas, Mandarinen, Koresole, Bananen in allen Größen und Farben, Mangos, frische Gemüse und Kräuter, saftige knallrote Tomaten neben grellgrünem Basilikum, Gurken, Bohnen, geröstete Maiskolben, rote und gelbe Gewürzberge … Ich entdeckte das teuflische piment rouge et jaune, das hier zu jedem afrikanischen Gericht gehörte, in runden, blank gescheuerten Blechschüsseln, liebevoll nebeneinander aufgestapelt, immer fünf Stück zusammengeschnürt. Auf dem Münchener Viktualienmarkt hatte ich ein Heidengeld dafür bezahlt. Wunderschön gemusterte Stoffe hingen in ein oder zwei Meter breiten Bahnen aus und zeigten Papageien in allen Farben, Strelizienblüten, sogar Präsidentenköpfe und die Mutter Maria.
»Der Patron ist älter geworden!« Mallo lachte zu mir herüber, dass die weißen Zähne in seinem gutmütigen runden Gesicht aufblitzten.
»Das sind wir alle.« Ich lächelte ihn an und betrachtete belustigt seine kleinen nilpferdähnlichen Nackenrollen, die sich wie ein Teil des graubraunen Anzugs über den schmalen Kragen rollten.
Ich versuchte mich von der beklemmenden Tatsache abzulenken, dass mich nur noch Minuten vom schicksalhaften Wiedersehen mit Tahim trennten, und betrachtete die Umgebung. Gerade bogen wir in die Avenue Boganda ein, die ehemalige Prachtstraße Banguis. Früher war sie gesäumt von üppigen rot blühenden Flamboyant-Bäumen, eleganten Villen, gepflegten Grünanlagen und mächtigen Geschäftsgebäuden. In der Mitte befand sich eine sechsspurige Avenue, wo Kaiser Bokassa 1977 mit Glanz und Gloria Paraden abgehalten hatte, doch nun bot sie ein Bild des Grauens.
Eine zerschossene Stadt tat sich in lähmender Traurigkeit vor mir auf. Mauern waren aufgerissen, die Villen dahinter eingestürzt. Ich erkannte verwüstete Grundstücke und ausgebrannte Baracken. Die großen Gebäude offenbarten heftige Granateinschüsse. Sämtliche Fensterscheiben waren bis in die obersten Etagen zersplittert, und Gardinen wehten wie Totenhemden durch die Rahmen. An der Place de la République hatte fast jedes Geschäft Einschüsse oder war mit Brandmalen verunstaltet. Türen waren mit großen Brettern oder Eisenstangen verrammelt, die Fenster einfach zugemauert. Umgestürzte Bäume mit verwelktem Laub verstärkten den morbiden Eindruck einer ausgebluteten Stadt. Was für ein fürchterliches, ernüchterndes Bild!
Obwohl der letzte Putsch schon viele Monate zurücklag, sah es hier aus, als wäre er gestern erst gewesen. Sogar die Kinderbanden schienen verändert, nicht mehr so lebhaft und aggressiv wie früher; noch verdreckter und zerlumpter als zuvor. Lustlos und ausgemergelt hingen sie an einem Maschendraht und verfolgten mit stumpfem Blick das dürftige Straßengeschehen. Es gab kaum etwas Traurigeres als unglückliche Kinder, und ich kam mir schäbig vor, als ich in ihre großen, vorwurfsvollen Augen sah und auf die verhungerten kleinen Körper, während ich satt und zufrieden in einem dicken Auto mit Chauffeur an ihnen vorbeifuhr.
»Mallo, arrête!« Ich bat Mallo anzuhalten und holte einen 5000-CFA-Schein hervor. »Frag sie, wer der Anführer ist!« Mallo beugte sich aus dem Fenster und rief: »Ìrí tì mo zo wa?«
Der dreckigste Knirps mit einem spitzbübischen Gesicht und einer frischen Narbe über die ganze Stirn rannte vor und die Meute folgte grölend. »Irìtì mb'ì Paul!«
Mallo gab ihm den Schein. »Gä hio è gue fadèsô!«
Paul sah dankbar zu mir herüber, und ich winkte ihm zu. »Balaô, ami Mallo, sag ihm noch, dass er auf mich aufpassen soll, wenn ich in der Stadt bin, okay?«
Mallo grinste und übersetzte es dem Burschen. Der nickte mir verschwörerisch zu und hob die schmutzige Faust zur Bestätigung. Schon war er von den anderen kleinen Banditen umringt. Da würde es jetzt rundgehen, und ich fühlte mich ein kleines bisschen besser. Ich würde mich dieser Kinderbande annehmen und sie irgendwie beschäftigen, sodass sie von der Straße kämen und zu essen hätten.
Manche von ihnen verkauften sich für ein paar lausige Sous an Marktfrauen, oder sie stahlen unter Lebensgefahr Lebensmittel aus den von scharfen Hunden bewachten Lagerhallen. Ihr Nachtlager war der Rinnstein, auch in der Regenzeit.
Mallo unterbrach meine trüben Gedanken. »Hier ist tagelang geplündert worden, die beschädigten Waren von ›Dias Frères‹ lagen überall auf den Straßen herum. Alle haben sich um die Beute geschlagen!«, bemerkte er leise und deutete auf den verbrannten Supermarkt der portugiesischen Brüder.
Mir lief es kalt den Rücken hinunter. »Mon Dieu, Mallo! Quelle horreur! Wie müsst ihr gelitten haben!«
Leise und eindringlich entgegnete er: »Mais Madame, ce n’est pas encore fini!«
Noch nicht zu Ende? Ich hoffte sehr, dass der Krieg nicht wieder ausbrach, weniger weil ich Angst hatte, sondern weil er nicht in meine Vorstellung von diesem schönen Land passte. Trotz der Ruinen und trostlosen Straßen war ich sicher, dass »mein« Afrika da war, dass es sich irgendwo hinter den zerschossenen Häusern versteckte, in der von brennender Sonne beschienenen Erde, im satten Grün des Dschungels, in der Fröhlichkeit der Menschen, ihren wunderschönen Körpern, dem herausfordernden Kopfputz afrikanischer Frauen, ihren farbenprächtigen Boubous, den unerschöpflichen Meeren aus Blüten aller Farben, den sinnlichsten süßen Düften und dem allgegenwärtigen kecken Kinderlachen sowie dem unweigerlich folgenden Gezeter der Mütter.
Inch Allah
Knirschend fuhren wir auf den sandigen Platz vor den flachen Bürogebäuden, einem lang gezogenen Gebäudekomplex, dessen schlichte Bescheidenheit auch auf den zweiten Blick nicht erkennen ließ, dass hier alle politischen und landeswichtigen Fäden des Patron Sadar zusammenliefen. Hier war die Zeit stehen geblieben, und ich hatte das beruhigende Gefühl, dass die Gegenwart lückenlos an die Vergangenheit anknüpfte und ich mit ihr. Eine Strophe aus einem Gedicht von Hebbel ging mir durch den Kopf:
Die Nachtigall, sie war entfernt,
Der Frühling lockt sie wieder;
Was Neues hat sie nicht gelernt,
Singt alte, liebe Lieder…
Als hätte sie sich nie bewegt, stand da die gleiche blaue Limousine, die in meiner Erinnerung unauslöschlich mit Tahim verknüpft war. Daneben parkte, von rotem Sand der Savanne bedeckt, der Rover für die Besuche in seinen Holzkonzessionen und Schreinereien am Rande des Urwalds im Lobaye-Gebiet. Unverändert befand sich die Bank an dem einzigen Schattenplatz vor der weißen Mauer, und darauf döste Muhamed, derselbe Sentinel (wie man die Wachleute hier nannte), der anscheinend noch an derselben Djeleba nähte wie damals. Lächelnd kletterte ich aus dem Pick-up und legte das Gewand, das ihm aus der Hand geglitten war, auf die Lehne der Bank.
»Bala mo míngi!«, schrie der Chauffeur herüber, und der Wächter schreckte auf und blinzelte mich aus verschlafenen
Augen an. Dann verklärte sich sein Gesicht, und freudig sprang er auf.
»Salam alaikum.« Er strahlte mich an und drückte mir die Hand. Ich war gerührt und stolz, dass ich hier noch gegenwärtig und geachtet war.
»Alaikum salam, Muhamed«, antwortete ich lachend, und mein Blick wanderte zum Ende des Gebäudes. Dort drüben verbarg sich hinter der zugezogenen Gardine des letzten Fensters das Reich des großen Manitus. Mir wurde plötzlich schlecht. Es war so weit. Er fand statt, der Moment aller königlichen Momente. Mein Wiedersehen mit Tahim hatte ich mir seit Monaten täglich vorgestellt, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Nun zögerte ich diesen Moment hinaus.
Im Vorzimmer begrüßte ich Martine, Tahims französische Sekretärin, die mit altjüngferlichem Charme und in aufopfernder Treue zu ihm hielt.
»Mais Julia, quel plaisir!« Sie drückte mich an ihren vollen Busen, als wäre ich nie fort gewesen, und schielte dann zur dicken, lederbeschlagenen Tür. »II est là!«
»Merci, Martine, à tout à l’heure!« Nun konnte ich es nicht mehr abwarten. Eilig löste ich mich von ihr, atmete tief ein und öffnete die schwere Tür zum Heiligtum.
Mein Blick fiel auf die geliebte Gestalt, die am Schreibtisch saß, und plötzlich überwältigte mich die Erinnerung an unsere Leidenschaft.
Ich bekam weiche Knie beim Anblick der exotisch dunklen Schönheit von Tahims Gesicht, das sich mir zuwandte. Seine kräftige Gestalt im blütenweißen, kurzärmeligen Hemd, das seine muskulösen Arme freigab; die nackten schönen Füße, die aus der dunklen Hose hervorsahen und in luftigen Sandalen steckten - plötzlich spürte ich das Streicheln seiner Hände auf meiner Haut, die starken Arme, die mich hielten …
Doch meine Fantasie und die Wirklichkeit waren zwei Paar Stiefel. Er begrüßte mich mit einem kühlen »Ahhh!«, als wäre ich gerade von einem Einkaufsbummel zurückgekommen, und wandte sich wieder seinen Papieren zu. Innerhalb einer Sekunde verwandelte sich meine lodernde Leidenschaft in eine Eissäule.
Ich zwang mich, mir nichts anmerken zu lassen. Langsam ging ich auf ihn zu und legte leicht meinen Arm auf seine breite Schulter. Noch vor einem Moment hätte ich alles darum gegeben, seinen Hals zärtlich zu streicheln und zu küssen. Aber nun spürte ich einen Abstand zwischen uns, der größer war als die Entfernung zwischen München und Bangui.
»Schön, dich wiederzusehen, Tahim. Geht es dir gut?«, begrüßte ich ihn geschäftsmäßig.
»Oui, oui, oui! Ca va!«Der Seitenblick, der mich aus seinen dunklen Augen traf, durchbohrte mich wie eine heiße Nadel. »War der Flug angenehm?«, erkundigte er sich unverbindlich und blickte wieder in seine Papiere.
»Ja, danke!«
Wie aus Versehen streichelte ich ihm flüchtig über den Nacken, ich konnte nicht anders. Zärtlich sah ich auf seine dunklen Locken, die nun von grauen Strähnen durchzogen und an den Schläfen weiß geworden waren. Die buschigen Augenbrauen glänzten immer noch kohlrabenschwarz über den halb geschlossenen Augenlidern. Die kühne Nase stand wie ein syrisches Wahrzeichen über den sinnlichen Lippen.
Tahim sah mich zum ersten Mal genauer an und betrachtete mich von Kopf bis Fuß. Erinnerte er sich ebenfalls an unsere heißen Nächte, an die Liebe, die ja doch ewig halten sollte? Begehrte er mich noch? Seinen Augen war nicht die geringste Regung zu entnehmen, und ich wurde unsicher. Er hatte wirklich mit mir abgeschlossen, oder? Er hatte eine neue Frau - das fiel mir jetzt wie Schuppen von den Augen -, und keiner hatte gewagt, es mir mitzuteilen! Das musste es sein.
Ich schwankte bei dieser Vorstellung. Am liebsten hätte ich die Flucht ergriffen.
Nun zeigte Tahim doch eine menschliche Regung, als er mitfühlend sagte: »Der Tod deiner Mutter tut mir sehr Leid, und ich wünsche dir viel Kraft. Ich mochte Susanne sehr. Sie war eine gute, sehr fröhliche Dame.« Er meinte es offensichtlich ernst, als er seinen Erinnerungen an Mamis Besuch in Bangui nachhing.
»Weißt du noch, wie wir zusammen in das Lobaye-Gebiet fuhren und sie dort am Rande vom Urwald mit den Pygmäen tanzte?« Ich musste lächeln. Mami hatte sich die blonden Haare aus dem Gesicht gestrichen, sich dann händeklatschend in den Kreis der Pygmäen eingereiht und entschlossen im Boogie-Schritt mitgetanzt.
Tahim lachte. »Ja, deine Mutter war eine mutige, eine besondere Frau!«
Dann räusperte er sich geschäftig. Offensichtlich wollte er keine weiteren Gefühle aufkommen lassen, und so teilte er mir förmlich mit: »Bahia hat das kleine Haus meiner Mutter hergerichtet. Da kannst du erst mal bleiben.« Ein abschließendes Hüsteln, das ich nur zu gut kannte, signalisierte mir das Ende der Audienz.
Ich merkte, wie meine alte Irritation über seinen Machismo wieder wach wurde. Der unterschiedliche kulturelle Hintergrund hatte immer schon zwischen uns gestanden. Er war es gewohnt, dass der Mann entschied und die Frau diente und gehorchte. Meine Selbstständigkeit hatte ihn fasziniert, aber letztlich war es ihm nicht gelungen, sie zu akzeptieren. Letztlich war unsere Liebe an diesem Grundkonflikt gescheitert.
Ironisch lächelnd erhob ich mich. »Merci, patron!«
Dann zog ich mich schnell zurück. Ich musste irgendwo meiner Enttäuschung freien Lauf lassen, das ernüchternde Gefühl verarbeiten, dass ich offensichtlich nicht so willkommen war, wie ich gehofft hatte. Ich bat Mallo, mich zum Haus zu fahren, das für mich vorbereitet war.
»Le patron habite là aussi«, erklärte Mallo mir bei unserer Ankunft dort, während er mein Gepäck aus dem Pick-up hievte und in den Schatten des Hauses stellte, das Bougainvillea-Blüten bedeckten.
Vom Garten wehten mich Koriander und starker Minzegeruch an, und der gelb blühende Frangipani-Baum verströmte eine betörende Süße. Es war wunderschön hier. Mallo deutete auf das Nachbarhaus im selben Garten, wo zwischen kargen, hohen Kakteen ein flacher, seelenloser Bau mit Blechdach, vergitterten Fenstern und dicker Eisentür stand. Kaum zehn Meter von meinem Haus entfernt sollte der Mann wohnen, der sich wieder völlig in meinen Gedanken eingenistet hatte?
»Was? Tahim wohnt hier?« Verständnislos betrachtete ich das öde Haus unseres Freundes Jacko, vor dessen Eingang eine verrottete Hollywoodschaukel ohne Dach, ein schiefer Tisch und leere Blumenschalen auf vergangene bessere Zeiten hindeuteten.
»Ja, seit dem Aufstand lebt der Patron mit seinem Bruder Diki, Monsieur Jacko und Monsieur Serge hier unten. In der großen Villa in Ngaraba war es für ihn allein zu gefährlich.«
»War er denn immer allein?«, fragte ich beiläufig, aber mit eindeutigen Hintergedanken.
»Ja, immer nur mit Diki!«, antwortete Mallo knapp und stieg wieder ins Auto.
»Aber Mallo!« Ich legte schnell eine Hand auf seinen Arm, damit er nicht wegführe. Ungläubig fragte ich: »Keine Frau?«
»Nein, Madame! Da war nie jemand!«, antwortete Mallo ernst.
In mir stieg ein Gefühl der Erleichterung und Genugtuung auf. Wenigstens hatte keine andere meinen Platz eingenommen.
Bevor sich diese angenehme Gewissheit in mir ausbreiten konnte, kam Billeba vor Freude laut lachend und gefolgt von einer kläffenden Hundemeute aus dem anderen Haus gelaufen und rief mir schon von Weitem sein »Madaaaaadame!« entgegen, mit dem er mich immer begrüßt hatte. Gerührt nahm er meine Hände zwischen seine faltigen, harten Finger und schüttelte sie ausgiebig, wobei er sich tief bückte. »Que Dieu vous protège!« Dabei rollten ihm Tränen der Freude über die ausgemergelten schwarzen Wangen.
Auch ich war gerührt über das Wiedersehen mit meinem guten alten Freund Billeba. Wie oft hatte er mir geholfen und das Leben mit seiner Fürsorge und den nützlichen Ratschlägen erleichtert! In seinem dürren Körper steckte so viel Zähigkeit, dass er der Familie Sadar seit Jahrzehnten von morgens bis abends ununterbrochen diente. Liebevoll packte ich ihn bei den Schultern. »Ja, Gott beschützt mich. Wie du siehst, hat er mich wieder hergeschickt!«
Ich kam nicht dazu, Billeba über das interessante Thema Le patron et les femmes auszufragen, denn als er mein kleines Zauberhaus aufschloss und den großen Koffer hineintrug, blieben mir die Worte im Halse stecken. Der Salon war ein kleines Wunderwerk. An alles hatten sie gedacht: Blumen überall, gelbe, rosafarbene, und rankender weißer Jasmin in kleinen Vasen, die noch aus meinen alten Beständen stammten. Lila blühende Bougainvillea von der Fassade waren mitten auf dem massigen, ausladenden Büfett drapiert. Die dunklen alten Holzmöbel, der Tisch, die hohen Stühle und die drei Sessel in der hinteren Sitzecke strahlten Ruhe aus. Die tiefroten Batistvorhänge mit dem Blumenmuster - ebenfalls noch aus meinen Beständen - gaben dem kleinen Salon einen zauberhaften, altmodischen Reiz, so als wären sie hier vergessen worden und amüsierten sich nun selbst mit alten, europäischen Geschichten. Die blank gescheuerten weißen Fußbodenkacheln rochen stark nach Eau de Javel, ein Zeichen, dass vor meiner Ankunft gründlich mit dem afrikanischen Allzweckreiniger sauber gemacht worden war.
»Billeba, du hast tatsächlich nichts vergessen, hast alle lieben Erinnerungsstücke zusammengetragen. Merci!«, rief ich ihm gerührt zu, während er im Schlafzimmer den Ventilator anstellte.
Strahlend kam er wieder zum Vorschein. »Und hier ist Ihr eigener Stuhl!«
Stolz zeigte er auf ein Möbelstück aus wertvollem Acajou-Holz, das ich vor mindestens sieben Jahren selbst geschreinert hatte und dessen massive Sitzfläche wie auch die gedrungene Rückenfront breite Herzformen darstellten. Zärtlich fuhr ich über die wunderschöne Maserung des gepflegten dunkelroten Massivholzes. Ein herrliches, ausgefallenes Stück.
Mittlerweile tobten die Hunde wie verrückt um mich herum und schnappten übermütig nach Rocksaum oder Ohrläppchen. Rex kannte ich noch von früher, ein schöner Dobermann, der inzwischen grau um die Nase war. Afrika war kein gutes Klima für diese Art Hunde. Sie waren ständigem Parasitenbefall ausgesetzt, fliegen fraßen ihnen die Ohrläppchen an, und die Hitze machte natürlich auch den Tieren heftig zu schaffen.
Liza schoss wie ein ungeübter Schlittschuhläufer mit kratzigen Krallen über die glatten Kacheln, wobei sie das einzige Seidenkissen des Salons erobert hatte und triumphierend damit über die Terrasse und mit elegantem Schwung in den Garten schoss. Dabei zog sie wie ein Stabhochspringer die Hinterläufe schräg unter den Bauch. Noch komischer war der fluchende Billeba, der bei dem Versuch, das teure Kissen zu retten, in ähnlichem Laufstil hinterher hechtete. Das war meine Chance, mich zu verkrümeln.
»A bientôt, mes amis!«, rief ich.
Allein, in der frischen Brise des leise surrenden Ventilators, fand ich mich in einer Glücksaura wieder, in der ich mich satt und zufrieden fühlte. So sah für mich das Glück aus, und ich sog es durch jede Pore ein, ging langsam durch die Zimmer und blickte in den verwilderten Garten hinaus. Allmählich begriff ich, dass ich tatsächlich wieder in meiner geliebten afrikanischen Heimat angekommen, dass dies Wirklichkeit war.
So zog ich mir langsam die nass verschwitzten Kleider vom Leib, stieg in die hoch gekachelte Duschecke und verschmolz mit dem kühlen Wasser, das mir die letzten hundert Jahre fortspülte. Zum Embryo wurde ich schließlich auf dem großen Bett, auf dem ich nun frisch und glücklich vor mich hindöste. Die Sonnenstrahlen, die durch die schrägen Lamellen der Holzjalousien ins Zimmer fielen, zauberten streifenförmige Schatten von tanzenden Blättern auf Decke und Wände und verschlangen und lösten sich in ständiger Bewegung auf das Fantasievollste.
Lange ließ ich mich einfangen von diesem Spiel, bis ich in einen wohltuenden Schlaf sank.
Les quatre bestioles: die vier Viecher
Nach meinem Mittagsschlaf wollte ich voller Tatendrang auf Entdeckungsreise gehen, alte Freunde besuchen, Land und Leute wiederfinden, Afrika einsaugen. Doch kaum hatte ich meinen weit schwingenden Boubou übergezogen und die Tür geöffnet, verwelkten sämtliche Wünsche auf der Stelle. Außer Rex und einem glühenden Schwall Mittagshitze, die in das Haus drängten, erwartete mich nichts von Bedeutung.
Die leblose Stille der Siesta lag über dem glühenden, ausgestorbenen Bangui. Die meterhohen Blätter der großen Voyageur-Palme hatten sich müde geschlossen. Nebenan, vor dem Haus Jackos, stand Tahims blaue Limousine. Ein einsames Velo lehnte an der grellweißen Hausmauer, und die Vorhänge des Hauses waren dicht zugezogen. Lediglich die trägen Tropfen vom Kühlwasser der Klimaanlage kündeten von verborgenem Leben, während sie träge aus dem breiten Metallbehälter unter dem Dach auf die Eingangsstufen klatschten.
Ich trat den Rückzug an und richtete mich mit meinen Papieren im Salon ein. Ich musste einen Plan entwerfen, wie ich weiter vorgehen würde. Was galt es zu erledigen? Vorrangig war die Suche eines Büros, danach musste ich die Reise in den Urwald, nach Bayanga, unternehmen, die Lodges besichtigen und abnehmen, Personal suchen und natürlich die Verwaltung organisieren.
Große Sorgen bereiteten mir die Finanzen. Der Nürnberger Teilhaber würde am kommenden Samstag eintreffen und das Geld für die ersten Ausgaben mitbringen. Aber irgendwie hatte ich ein komisches Gefühl. Falls etwas faul war an diesem Partner, überlegte ich beunruhigt, würde ich ohne Geld dastehen. Wie sollte ich dann eine andere Finanzierung zustande bringen? Ich war völlig mittellos, und ohne Grundkapital würde ich keinen weiteren Kredit mehr bekommen. Ta- him in meine finanzielle Unternehmung mit einzubeziehen war mir ein höchst unangenehmer Gedanke. Andererseits war ich ja vom WWF beauftragt, einen inländischen Geldgeber zu finden.
Mein Blick fiel durch den gegenüberliegenden Türspalt ins Bad, wo sich Rex mit sorgfältigen Drehungen einen gemütlichen Platz in der kühlen Duschecke suchte. Ich freute mich, endlich wieder Tiere um mich zu haben, im Gegensatz zu München. München? Lag Lichtjahre hinter mir.
Der aufregende Duft eines herzhaft gewürzten Bratens drang durch Ritzen und Fensternischen zu mir und erinnerte mich daran, dass meine letzte Mahlzeit fast einen Tag hinter mir lag, sofern man bei der Bordverpflegung der Air Afrique von Mahlzeit reden konnte. Es klopfte an meiner Tür, und der königliche Bratenzauberer Billeba richtete mir persönlich aus:
»Der Patron isst mit den anderen Herren in einer Stunde. Haben Sie gar keinen Hunger, Madame?«
Ladylike zog ich die Augenbrauen hoch. »Doch, ein wenig … aber es hat mich noch niemand eingeladen!«
»Aber Madame, Sie gehören doch zur Familie, da braucht man keine Einladung.« Suchend blickte er über meine Schultern durch den Salon.
»Er liegt in der Dusche!« Ich winkte Billeba, hereinzukommen. »Mach bitte die Tür zu, es ist die Stunde der Moskitos und der Malaria!«
»Merci, Madame!« Billeba ließ seine staubigen Schlappen - oder das, was davon übrig war - vor der Tür stehen und tappte mit Füßen, die nicht den Eindruck machten, weniger Schmutz zu verbreiten als die Schlappen, in den kleinen Flur. Er machte sich daran, meinen Koffer auszupacken und die Sachen sorgfältig in den Schrank zu räumen, während ich die Geschenke aus der Reisetasche holte. »Habe ich euch sehr gefehlt, Billeba?«, rief ich ihm zu. Er meckerte leise lachend und antwortete brav: » Oui, Madame! Der Patron war sehr lange krank, nachdem Sie uns verlassen haben!«
Verblüfft hielt ich inne. Tahim war meines Wissens nie krank gewesen. Sollte meine Abreise ihn derart mitgenommen haben? Hatte auch er gelitten? Er selbst hatte doch die Trennung gewünscht, oder etwa nicht? Meine Gedanken jagten sich im Kreis.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Neuausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783942822039
- DOI
- 10.3239/9783942822039
- Dateigröße
- 1.4 MB
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2012 (November)
- Schlagworte
- Afrika Zentralafrikanische Republik Kongo Deutsche Frau Photographin Forschungsreise Pygmäen