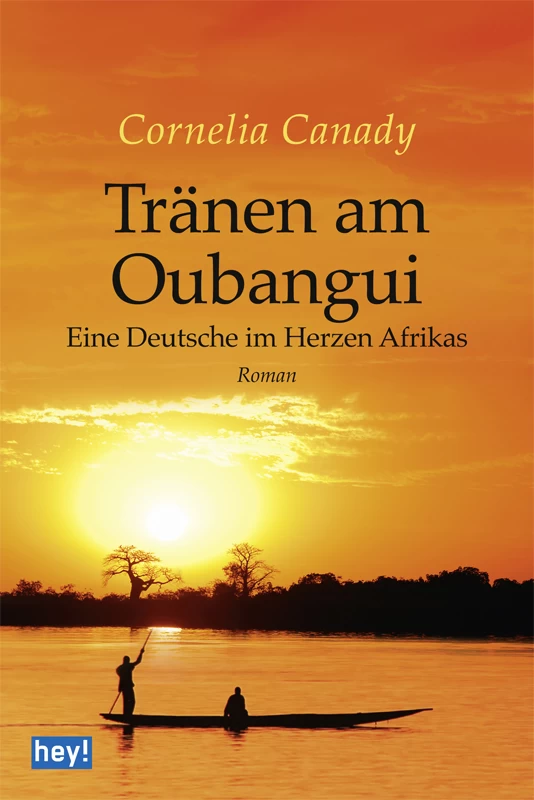Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1
Glück ist der Stuhl, der plötzlich da steht, wenn man sich gerade zwischen zwei andere Stühle setzt. Ich hatte ihn getroffen, saß nun fest darauf und bewegte mich zügig in Richtung Linz. Dabei dachte ich an Afrika, an Bangui, diese unbekannte Stadt am Regenwald, zu der es mich nun verschlagen sollte; dachte an die verschiedensten Farben, an Palmen, Blüten, Hütten, Menschen, Tiere. Ich war voller Spannung und kontrollierte vorsichtshalber noch einmal die Tasche mit meiner Fotoausrüstung. Die große Chance für meinen ersten eigenen Fotoband war gekommen, und ich würde Aufnahmen von den aufregendsten Motiven machen, die einer Fotografin aus München-Giesing jemals vor die Linse geraten waren ... Pygmäen, Elefanten, Schimpansen, Löwen - gab es dort überhaupt Löwen?
Plötzlich empfand ich tiefe Dankbarkeit gegenüber Adalbert, dem österreichischen »Hofrat«, daß er mich zu dieser Urwaldexpedition überredet hatte. Eigentlich war Urwald - dampfendes grünes Labyrinth, wie ich es mir vorstellte -, nicht meine Sache. Aber Adalbert fand, wir sollten mit dieser Expedition in den Tropenwald am Oubangui einen Wunsch von Wolfgang, seinem tödlich verunglückten Sohn, erfüllen. In Wolfgang war ich sehr verliebt gewesen, und dann war er von einem Tauchgang nicht mehr zurückgekommen. Sein Tod hatte mich tief getroffen, und obwohl er fünf Monate zurücklag, erholte ich mich nur langsam von dem Schock. Doch diese Reise sollte mich auf neue Gedanken bringen.
Während der Zug sich der österreichischen Grenze näherte, sah ich Adalbert in seiner dünnen, grau schattierten Erscheinung vor mir, wie er mich vor einigen Monaten in seinem Naturkundemuseum mit Marillenschnaps und Mozartkugeln davon überzeugt hatte, daß meine Ängste vor dem Dschungel und seinen Bewohnern unangebracht seien. Natürlich hatte er mich bei meinem Sportsgeist gepackt, ich wollte nicht als typisch weibisch eingestuft werden. Also hatte ich das Angebot angenommen, seinen neuen Katalog zu bebildern. Er hatte nicht mit österreichischem Charme gegeizt und in den höchsten Tönen von meiner letzten Fotoausstellung geschwärmt. Ja, meine Vernissage mit den Obdachlosen-Porträts war ein großer Erfolg gewesen. Schließlich hatte mich auch mein Big Boss, »II Professore« vom Max-Planck-Institut, zu der Reise ermuntert und mir wichtige Informationen über Fauna und Flora im Regenwald mit auf die Reise gegeben. Großzügig beurlaubte er mich von meiner Arbeit im Fotoarchiv.
Die Fahrt verlief reibungslos. In meinem Abteil saßen zwei Amerikaner und ein Student aus Schweden; polnische Würstchen wurden von einem türkischen Kellner angeboten, und ein griechischer Schaffner knipste gerade meine Fahrkarte. Leichter Patriotismus überkam mich. München-Giesing war schließlich auch nicht übel.
In Linz wartete Inge, Adalberts Assistentin, bereits auf mich, und während die winterlich fahle Sonne in dem alten Bahnhof ausgerechnet auf meinen schäbigen Armysack fiel, rief Inge erstaunt aus: »Servus Julia, ist das etwa dein ganzes Gepäck?«
»Ja. Ich dachte, so könnte ich leichtfüßig und schnellstmöglich aus brenzligen Situationen flüchten.«
Inge umarmte mich. »Wenn dich der Pygmäenhäuptling jagt?«
»Zum Beispiel.«
Aufgekratzt fuhren wir zum Museum. Dort ging es hektisch zu: ein »kleiner Brauner« mit Schlagobers und letzte Kontrolle der Medikamente - Antihistamine, Fansidare, Penizilline, Antischlangendings, Malariapips und Pipapo. Ein bärtiger junger Mann tapste mit einem Schmetterlingsköcher zwischen der Ausrüstung herum und versuchte mit bärenhafter Grazie, die dichtgestapelten Tüten und Kartons zu umgehen. Gebannt sah ich zu.
»Das ist unser Biologe und Zoologieprofessor Nosbusch. Er reist mit uns«, erklärte Adalbert, dem plötzlich einfiel, daß wir uns noch gar nicht begrüßt hatten. »Entschuldige, Julia, aber die Hektik ...« Und er drückte mich eilig an seinen langen, hageren Körper.
Der Biologe hielt mir seine kräftige Hand entgegen: »Nenn mich einfach Nossi, okay?«
»Freut mich, ich bin Julia, das Greenhorn.«
Der Chauffeur kam, Gepäck wurde verladen, Inge weinte zum Abschied, und weiter ging es nach Wien.
Auf der Fahrt fanden wir endlich Zeit, uns in Ruhe zu begrüßen. Adalbert nahm mich väterlich in die Arme. »Ich freue mich so, daß du doch noch zugesagt hast. Du wirst sehen, daß deine ganze Angst unnötig war. Nosbusch kennt sich in Afrika bestens aus, und schließlich sind wir immer in deiner Nähe.«
Die letzte Bemerkung gefiel mir überhaupt nicht, und mir kamen wieder Zweifel. Hatte es eigentlich schon Expeditionen mit weißhäutigen langhaarigen Großstädterinnen auf Pygmäenjagd gegeben? Die beiden anderen waren zumindest Biologe, Ethnologe, Mediziner und »Hofrat«, ich hingegen war nur ein fotografierendes Greenhorn. Wenigstens sprach ich als einzige französisch - glaubte ich zumindest. Flughafen Wien, 18 Uhr, sechs mal acht Meter Rucksack, acht prall gefüllte Plastiktonnen und drei Meter mittelgroße Taschen standen vor uns, unser »Handgepäck«. Ich kannte bereits den Schmerz einer zehn Kilo schweren Tasche, die möglichst leicht und elegant am kleinen Finger baumeln sollte. Nosbusch hatte Erbarmen und verteilte sämtliche Rucksäcke am eigenen Körper. Sein Gesicht lief gerade blutrot an, als Adalbert ihm noch drei Taschen entgegenhielt. »Kannst du das noch umhängen, wir müssen sonst ein Vermögen für Übergewicht bezahlen.« Nosbusch sah so ratlos aus, daß ich ihm eine Reisetasche abnahm und zusätzlich über meinen Tragesack hängte. Das Gewicht zwang mich fast in die Knie. Bei der Paßkontrolle folgte uns ein spöttischer Blick ... Rucksacktouristen, aber man ließ uns hindurch.
Weiter nach Paris. Dort der Transitgang, nein, zurück, verdammt, die Zeit wurde knapp. Air Afrique, wo bitte, vite. Ahhh, am anderen Ende, Dauerlauf, schweißtreibende Kontrollen. Bei der Gepäckdurchleuchtung wäre ich beinahe auf dem Fließband mitgefahren, ein Riemen hatte sich an meinem Ärmel verheddert. Dabei sollten wir uns doch unauffällig verhalten wegen des ›Handgepäcks‹. Nosbusch schubste mich von hinten weiter, schob mich mit der einzigen unbepackten Stelle seines warmen Bauches voran, bis wir im Flugzeug endlich unsere Plätze erreichten.
Entnervt ließ ich alles zu Boden fallen und verschwand auf die Toilette. Die Schulter schmerzte, und ich entdeckte unter der Bluse einen dicken rotblauen Striemen, der sich bis zum Busen zog und tief ins Fleisch gekerbt hatte. Die Expedition hatte offensichtlich begonnen. Der Spiegel verriet mir mein gegenwärtiges Alter: der vergrämte Blick einer Mittfünfzigerin ... Ja, ich fühlte mich tatsächlich doppelt so alt, wie ich war. Sachte kühlte ich meine lädierten Körperstellen, versuchte mein Kostüm herzurichten, das einem frisch ausgewrungenen Scheuerlappen glich, und gesellte mich wieder zu meinen Begleitern.
Erschöpft fiel ich in den Sitz am Fenster und freute mich auf einen großen Drink mit klirrendem Eis. Ich spürte das Vibrieren der Motoren, und plötzlich wußte ich: Dies war der Anfang einer langen Geschichte. Afrika wartete auf mich mit vorschriftsmäßig blühenden Akazienbäumen, Sklaven, die mit Straußenfederfächern wedelten, untergehender Sonne am Ende eines langgezogenen Savannenpfades ... Regenwald mit Schmusekatze, Vanilleeis an Dschungelbeeren...
In der Morgendämmerung begann der Anflug auf Bangui. Abenteuer verhieß der Blick durch das Fenster: Tief unten dampfte der Urwald. Die Landung war so hart, daß Gepäck, Kartons, Tüten und Proviantreste in den Mittelgang stürzten. Dazu tönte aus dem Lautsprecher die samtige Stimme des Piloten: »Bienvenue à Bangui - Wir haben 41 Grad. Air Afrique wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt ...«
Auf der Gangway erstickte mich der erste Atemzug fast, schnürte mir die Kehle zu und war zu heiß für meine Lunge. Feuchtigkeit kroch mir in die Bluse, und im Nu war ich völlig naßgeschwitzt. Neugierig ließ ich die Blicke schweifen. Vereinzelte, ausgedörrte Palmlinge belebten das monotone Bild des verbrannten Geländes, aus dem sich der klotzige, verrottete Flughafenbau erhob. Die Hitze war so drückend, daß ich kaum atmen konnte. Das Gepäck wurde von schwarzen Uniformierten Stück für Stück durchwühlt und in einer fremden Sprache kommentiert.
Nosbusch kauderwelschte bereits mit einem Zollbeamten. »Julia, hilf doch mal. Ich glaube, er will wissen, was wir in der Zentralafrikanischen Republik Vorhaben. «
Nun kam die Stunde der Wahrheit, in der sich mein Schulfranzösisch bewähren sollte. »Mais oui«, entschlüpfte es mir fließend, und ich versuchte dem Menschen mit meinem schönsten Lächeln zu erklären: »Wir ... äähhh, bleiben im ähhh ... forêt... Urwald ... avec ... pygmées.«
Hilfesuchend blickte der Zollmensch zu einem Kollegen in Tipptopp-Uniform und schneeweißem Hemd. Ich vertiefte mein Lächeln. Da kam er auch schon und blickte auf meinen glänzenden Kugelschreiber.
»Pour vous, monsieur.« Mit diesem wunderbaren Satz schenkte ich ihm den Stift. »Bitte Nosbusch, kümmere dich um unser Gepäck, ich regle das hier schon.« Mir war es peinlich, daß er bei meinen weiteren Sprachversuchen zuhören würde, denn offensichtlich hatte ich das meiste vergessen.
Der Uniformierte begleitete uns freudig zur Paßkontrolle, und dann ging es zügig voran.
Ein gestreßter, völlig verschwitzter Mensch näherte sich uns, Felsfurch, der vierte Teilnehmer unserer Expedition. Er hatte sich bei unserer Begegnung in München bereit erklärt, die Verantwortung für diese Expedition zu übernehmen, allerdings unter der Voraussetzung, daß wir uns ausschließlich nach ihm zu richten hätten. Das machte ihn mir auf Anhieb unsympathisch, wie alles, was mich unter Zwang setzte. Seit langem lebte er schon im Lobaye-Gebiet bei den Pygmäen, zu denen er uns jetzt führen sollte.
»Ti lasso alingbi awe.« Er zahlte die Gepäckträger aus. Auf meinen fragenden Blick antwortete er: »Das heißt auf Sango: ›Es reicht für heute‹. Ein Satz, den Sie lernen müssen, Julia. Ihr solltet euch beeilen, wir haben noch viel zu erledigen.« Mit diesen knappen Worten brachte er uns zum Rover und bestätigte mich in meinem Gefühl, daß ich diesen Menschen nicht mochte. Er war mir zu rüde und autoritär.
Als ich einstieg, fiel mein Blick auf einen orientalisch wirkenden Mann auf der Straße, der lebhaft in einer Gruppe Schwarzer diskutierte. Ein faszinierendes, geheimnisvolles Gesicht. Unsere Blicke begegneten sich, und ich versank in den dunkelsten Augen, die ich jemals gesehen hatte. Ich konnte den Blick nicht von ihm lösen, mir war, als brannten meine Haare. Wie aber hätte ich erst reagiert, wenn ich geahnt hätte, wie sehr dieser Mann noch mein Leben beeinflussen sollte!
»Julia, geht’s dir nicht gut?« Adalbert sah mich besorgt an. Ich kam wieder zu mir. »Alles in Ordnung. Mich hat nur gerade ein geheimnisvoller Fremder in orientalische Gefilde ...« Ich brach abrupt ab, denn Felsfurchs eisiger Blick ließ mich erstarren.
Wir fuhren an dem bunten Treiben des großen Markts von Bangui entlang, der sich über einige Kilometer erstreckte. Schwarze feilschten um den Preis von getrocknetem Fleisch, das auf dem Boden ausgebreitet lag und von Schwärmen schillernder Fliegen bedeckt war. Aufgeschlitzte, blutige Affen lagen übereinander, Berge von leuchtenden Orangen, roten und gelben Pimentschoten, Gemüsesorten in allen Farben waren zu sehen; Stände mit zerlöcherten T-Shirts und gebrauchten Schuhen, Kisten mit Brillen, Medikamente in praller Sonne, Erdnüsse in Flaschen, Glitzerschmuck, falsche Haare, Brennholz, zerlumpte Kinder und Afrikanerinnen in bunte Tücher gewickelt, die ihre Habe in großen Körben auf dem Kopf balancierten. Über allem lag der Duft exotischer Gewürze. Begeistert nahm ich die neuen Eindrücke in mich auf.
Felsfurch richtete meine Aufmerksamkeit auf unser Tagesprogramm. »Zuerst müssen wir ins Ministerium, die Dreh- und Fotogenehmigung abholen, danach Proviant kaufen. Julia kann das ja machen, während wir den Rover zur Inspektion bringen, die Bremsflüssigkeit läuft aus.«
Adalbert und Nosbusch fragten fast gleichzeitig: »Und wie lange dauert das?«
»Woher soll ich das denn wissen? Ich stecke doch nicht drin«, erwiderte Felsfurch barsch. Sein Gesicht, das fast ausschließlich aus Längsfalten bestand, wurde noch etwas länger.
Die afrikanische Mentalität ermöglichte uns einen verlängerten Aufenthalt in dieser bunten Stadt, in der kaum Weiße zu sehen waren. Im Ministerium hatte niemand unsere Genehmigung gefunden, selbstverständlich würde das aber sofort erledigt. »Sofort« hieß hier »morgen«. Am nächsten Morgen hieß es »am Nachmittag«. Ich war froh über diese Verzögerungen, denn mich interessierte alles hier.
Mein Französisch entpuppte sich als ein Desaster. Doch als ich im Supermarkt einkaufte, bekam ich auf meine erste fragend vorgetragene Bestellung: »Cinq paquets de cigarettes?« umstandslos, was ich wollte. Begeistert fuhr ich in meiner Liste fort und orderte fünfhundert Büchsen Sardinen, fünfzig Büchsen Thunfisch und - da ich alles, was mit »fünf« anfing, so gut aussprechen konnte - weitere fünfzig Kilo Reis, fünfzig Tüten Kartoffelpüree, fünfzig Büchsen Tomatenmark, fünfzig Tütensuppen, fünf mal fünf Säcke Salz, fünfhundertfünfzig Teebeutel, fünfzig Päckchen Kaffee, fünfhundert Päckchen Kekse, fünf Säcke Zwiebeln, fünf mal hundertfünfzig Beutel Spaghetti, fünf mal fünfzehn Stück Seife, fünfzig Kartons Zucker, fünf Flaschen Palmöl ... Mein Verhältnis zu Zahlen war zugegebenermaßen immer schon schwierig gewesen. Beim Zahlen mit all den bunten Scheinen, die Felsfurch mir gegeben hatte, dachte ich mir noch nichts Böses. Als aber der Boy die Proviantkisten ins Auto lud, kam mir die Menge übertrieben vor. Andererseits sollten wir für sechs Wochen versorgt sein. Für einen Umtausch war es nun zu spät, außerdem wußte ich nicht, was »Umtauschen« auf französisch hieß.
Felsfurch beobachtete mißtrauisch, wie die Kisten eingeladen wurden. »Geben Sie mir das Restgeld zurück?« Erstaunt sah ich ihn an. »Welches Restgeld?«
Er preßte die Lippen zusammen. »Von dem Geld sollten noch der Rover überholt und die Gaskartuschen gekauft werden«, antwortete er mit drohendem Unterton.
In schlechter Stimmung und brütender Hitze wurden wir im Hotel abgeliefert. Der deutsche Botschafter hatte uns eine Einladung zum Dinner hinterlassen. Bis dahin hatten wir glücklicherweise genug Zeit, um uns von den Strapazen zu erholen.
Fast eine Stunde lang duschte ich mir den roten Staub und die vierzig Grad Hitze vom Körper, wusch meine langen Haare, sicherlich für lange Zeit zum letzten Mal. Liebevoll cremte ich dann meine geschundenen Schultern ein. Ich fühlte mich schlaff in diesen feucht-tropischen Temperaturen.
Im Rucksack fand ich, zerknüllt und kaum wiederzuerkennen, mein einziges Kleid. Ich zog es unter lauwarmem Wasser in Form und hängte es in den Wind. Noch Rouge und Lippenstift, und ich war zufrieden mit meinem Spiegelbild, das mich erwartungsvoll aus grünen Augen anblitzte. Doch schon klebten wieder die ersten kleinen Schweißperlen an meiner Oberlippe, und zwischen dem Busen bildete sich ein Rinnsal. Mißmutig beschloß ich, nochmals unter die Dusche zu gehen und die restliche Zeit unter dem wohltuenden Strahl zu verbringen.
Abends wurden wir von einem hochaufgeschossenen, blonden und blauäugigen Mann an der Rezeption begrüßt. »Gestatten, Hans Schnell, ich hoffe, Sie haben sich inzwischen von den ersten Strapazen erholt?« Ein charmantes Lächeln traf mich aus den Augen unseres Botschafters. Glatt frisiert, adrett und Ton in Ton gekleidet, stand er in strammer Haltung vor mir und musterte mich. Ein wenig zu direkt, fand ich, keine Chance, mein Lieber, du bist mir irgendwie zu deutsch in dieser exotischen Umgebung. Mir fiel der geheimnisvolle Fremde vom Flughafen wieder ein ... ich sah sein männliches, orientalisch wirkendes Gesicht mit den buschigen Augenbrauen ganz dicht vor mir, wir lächelten uns an ... Verträumt sah ich zum Hotelausgang auf die vorbeiziehende schwarze Künstlerschar, die verschämt ihre kleinen Holzfiguren zum Kauf anbot. Dabei begegnete ich den Blicken Adalberts, der gerade mein versonnenes Lächeln nachäffte, und ich kam wieder zu mir.
»Hatten wir schon Strapazen, Julia?« wiederholte er bohrend.
»Die einzige Strapaze, die ich hatte, war Monsieur Felsfurch.« Ich mußte lachen, als ich an diesen eigenartigen Typen dachte.
Wir machten uns auf den Weg. Das Restaurant war nur eine Straße weiter, und zwischen den morbiden, halb zerfallenen Häusern nahm es sich wie ein Luxustempel aus, eingerahmt von Mangobäumen, die voll satter, rotgoldener Früchte waren. Ich hatte einen Bärenhunger und bestellte alle vier Gänge, ohne zu zögern. Kaum stand die Vorspeise auf dem Tisch, machte ich mich auch schon über den gebeizten Fisch her, ein Capitaine, wie der Kellner erklärte, ganz frisch aus dem Oubangui. Einfach köstlich, dazu ein Glas Bourgogne und ganz schnell noch eins. Ich hatte überhaupt keine Ohren für die Unterhaltung am Tisch. Der zweite Gang kam, ein einheimisches Gericht, das ausgesprochen bemerkenswert war, klebrige Erdnußbuttersoße, sportliches Hühnchen in Palmöl, dazu als Gemüse gekochter Rasen. Und ein teuflisch scharfes Piment rouge, das mir die Luft abschnürte. Plötzlich war es still am Tisch, ich schreckte hoch und sah in sechs erstaunte Augen, die mich verblüfft musterten. Ich verharrte mit dem Bissen im Halse. »Habe ich irgend etwas falsch gemacht?«
Adalbert lachte schallend los. »Nein, das nicht, aber wir versuchen dich seit einer halben Stunde ins Gespräch einzubeziehen, du antwortest einfach nicht.«
Ich unterbrach ihn mit einem Hustenanfall und Tränen in den Augen. »Du siehst doch, daß ich gerade gegen die Pfefferschoten kämpfe, bin gleich dabei«, waren meine letzten Worte vor dem nächsten Hustenanfall. Entfernt hörte ich Herrn Schnell. »Ich bewundere Sie aufrichtig. Mit Sicherheit sind Sie die erste weiße Frau, die hier eine solche Expedition in den Urwald macht. Mich persönlich würden keine zehn Pferde in dieses Gebiet bekommen, außerdem traut man den Pygmäen ja alles Mögliche zu. Letztes Jahr sind ein paar Leute in dem Gebiet verschwunden.«
Plötzlich bekam ich wieder Luft. »Ich dachte, hier im Land sorgte ausschließlich der selbstgekrönte Kaiser Bokassa für Überraschungen, indem er weiße Babys zu Hauptgerichten verarbeiten ließ?«
Der Botschafter nickte leicht bedrückt. »Ja, das war tatsächlich eine schlimme Sache. Aber dieses Land hat für Weiße eine Vielzahl an überraschenden mystischen Traditionen. Auch heute noch tötet man kleine Kinder, um Herz, Hirn und Genitalien herauszuschneiden.«
»Na, Mahlzeit!« entfuhr es mir angeekelt, und ich legte geräuschvoll das Besteck auf den Teller. Wir saßen noch eine Weile zusammen, etwas träge, denn es war ein langer Tag gewesen.
Ich war froh, als ich endlich wieder im Hotel ankam. Müde, aber guter Dinge schrieb ich die ersten Eindrücke in mein Tagebuch. Doch dann zogen mich ein ferner melodischer Singsang und das leise Rauschen des Ventilators in abstruse Träume. Große Schlangen in Form von Mangofrüchten schillerten golden durch Urwalddickicht, schwarze Fliegen schwirrten um meine Füße, legten weiße Maden unter die Zehennägel, Flöhe, die über Kinderherzen hopsten ... pfui Teufel! Entsetzt fuhr ich aus dem Halbschlaf auf und suchte den Boden nach Ungeziefer ab.
Am nächsten Morgen waren wir endlich startbereit für unser Abenteuer. Alles war erledigt, und ein zweiter Rover voll Gepäck und Proviant begleitete uns, am Steuer ein gutaussehender Franzose, Francis, der mir freundlich zulächelte. Wir fuhren mit schnellem Tempo auf einer Straße voll tiefer Löcher, ließen Bangui hinter uns, und Simsalabim ... eröffnete sich vor uns eine Savanne bis zum Horizont. Hohes, verdorrtes, braungraues Gras, ein kleiner Weg, knorrige und zum Teil abgebrannte Bäume, die vereinzelt aus dem Schilf ragten, hohe Termitenbauten, die tiefrot und in gefächerter, übereinander geschichteter Form wie außerirdische Bauwerke aussahen. Rechts und links des Weges trugen Bantufrauen, schön und hoch gewachsen, in bunte Boubous gehüllt und auf deren tiefschwarzer Haut die Sonne golden glänzte, mit wiegenden Hüften ihre Lasten auf dem Kopf: Gemüsesäcke, große Blechschüsseln mit braunen Maniokknollen, gestapeltes Brennholz, Bananenstauden oder Wasserkanister. Mädchen mit stachelig hochstehenden Zöpfchen winkten johlend herüber. Bäume mit breitflächigen, orangefarbenen Blüten sausten an uns vorbei, flüchtende Ziegen und Hühner, die im letzten Augenblick über die löcherige Teerstraße rannten. Roter Staub hinter uns und Felsfurch neben uns, der, wie mir schien, kein Schlagloch ausließ.
Die Landschaft wechselte von graubrauner Dürre zu rotlehmigen Straßendörfern. Wir fuhren durch hohes Schilfgewächs, dann eine stark duftende Kaffeeplantage in weißer Blüte, immer wieder an Avocadobäumen vorbei und an vereinzelten Hütten, vor denen sich Männer träge in schiefen Stühlen lümmelten. Auf Holzgestellen wurden Zitronen, Papayas und Bananen angeboten. All diese schnell aufeinanderfolgenden sinnlichen Eindrücke gingen mir tief unter die Haut, und ich fühlte mich im Innersten berührt, als wäre ich endlich durch eine Türe getreten, die lange Zeit verschlossen war.
Am Horizont zog inzwischen schon die Dämmerung herauf, und in das Abendlicht mischte sich der Geruch von Holzfeuer. Frauen bereiteten das Abendessen auf kleinen Feuerstellen. Nun teilte sich die geteerte Straße in einen ausgefahrenen Schotterweg und in eine frische, rotsandige Trasse, gesäumt von breitfächerigen Musangabäumen, die den nahen Urwald ankündigten. Mir fielen all die Einzelheiten ein, über die ich in München gelesen hatte - Bäume, Bantu, Urwald, Klima und ich freute mich wie ein Kind, wenn ich Gelesenes in der Realität wiederfand, wie jetzt diese Bäume.
Felsfurch, immer noch gestreßt und mit grantigem Gesicht, erklärte uns: »Wir werden heute in einem Holzlager übernachten, einem alten Landhaus, das dem einflußreichsten Mann in Bangui gehört, außerdem steinreich. Er hat es uns zur Verfügung gestellt, als er von der Expedition hörte. Er selbst lebt in einer Prunkvilla in Bangui.«
»SALAND« las ich auf einem verwitterten Blechschild vor dem Holzlager, das sich da als ein Monsterwerk entpuppte mit Fabrikhallen, Lagern voller langer Holzblöcke, diversen Caterpillars und großen Lkws mit Hängern, Häusern, Hütten, kleinen Läden ...
»Ja, Julia, hier wird der Urwald in Scheiben geschnitten und mit ihm die meisten Wildarten«, klärte mich Adalbert traurig auf.
»Aber es wird doch wieder aufgeforstet«, belehrte ich ihn. »Schön wär’s. Das passiert leider nur auf dem Papier«, fügte Felsfurch erbost hinzu. »Hier ist es den Leuten völlig egal, ob der Wald gerodet und vernichtet und der Boden anschließend von Bauern abgebrannt wird, um Nutzland zu gewinnen.«
Plötzlich hüllte sich die Landschaft kurz in Lila, Rot... und dann war es schlagartig dunkel. Ich erkannte die Umgebung nur noch schemenhaft. Doch überraschend leuchtete nun fahles Mondlicht auf, und als Felsfurch in die nächste Kurve fuhr, sah ich den silbrig sich dahinschlängelnden Fluß mit leisem Plätschern über kleine Stromschnellen springen. Vereinzelte Fischerpirogen wurden lautlos durch eine dunkle Märchenwelt gepaddelt. Auf einmal war ich ganz sicher, daß hier mein Schicksal lag, irgend etwas würde geschehen ...
»Oh, wie schön!« Ich war begeistert, voller Andacht angesichts dieser einmaligen Schönheit in tiefer Stille.
»Das hier ist der Lobaye, ein Fluß, der vom Oubangui kommt und uns bis zum Kongobecken begleiten wird«, kommentierte Felsfurch verächtlich und ließ mich wissen, daß Oh-wie-schöns hier ihre Namen haben. Ich würde ihn ab jetzt nur noch den »Grantler« nennen, denn wie konnte ein Mensch so dauerhaft grantig sein, oder war er vielleicht krank?
Die Auffahrt zu einem Haus blitzte rotsandig auf, und ich erkannte die Umrisse einer traumhaft schönen Villa aus altem Holz, mit ausladender Terrasse, an der sich im Schein der Nachtleuchte violette Bougainvilleablüten emporrankten.
»Ist dies etwa das alte Landhaus, von dem Sie so beiläufig erzählten, und wenn ja, ist der Eigentümer Junggeselle?« wollte ich scheinheilig wissen.
»Ja, das ist das Haus, und der Eigentümer ist Junggeselle, ein Syrer, der seit dreißig Jahren hier im Lande lebt.«
Na ja, Orientale. Mit Sicherheit ein alter, dickwanstiger Typ, dachte ich, während ich ausstieg. Im selben Augenblick öffnete ein Boy sämtliche Türen des Hauses und der Terrasse und lud uns dann mit freundlichen Gesten ein näherzutreten. An einem angrenzenden Bambuswäldchen lag ein längliches Gästehaus, wohin ein anderer Boy das Gepäck der Männer trug.
Beeindruckt standen wir auf dem Vorplatz, der von rosa blühenden Büschen gesäumt war. Trotz der Dunkelheit war ein eindrucksvolles Panorama zum anderen Ufer erkennbar,
bis zum Dschungel: Geheimnis und pure Sinnlichkeit mit lockenden Rufen. Doch die Krone aller Sinnlichkeit bat uns nun in einen großen Salon, hieß Bilebou, war schwarz, trug eine weiße Schürze und hielt ein Tablett mit Rum, Campari, Souze, Mokafbier, Zitronen, Pernod, Whisky und Cognac. Bereits der Anblick tat gut.
»C’est une bonne idée, ça«, bedankte ich mich strahlend bei ihm, doch da bemerkte ich seinen irritierten Blick auf ... Nosbusch mit dem Schmetterlingsfänger. Ich mußte lachen. »Wirst du mit diesem Ding auch schlafen gehen? « wollte ich wissen.
Doch er fand das gar nicht komisch. »Wenn dem etwas geschieht, ist eine meiner wichtigsten Arbeiten in Frage gestellt.«
»Entschuldige, war doch nicht böse gemeint.« Ich knuffte ihn freundschaftlich. »Pour papillons«, fiel mir als Erläuterung zu dem Kescher ein, und ich nickte Bilebou zu. Der sah nur noch ratloser aus. Aber ich hatte keine Lust mehr auf Erklärungen, außerdem wollte ich meine Französischkenntnisse nicht noch mehr bloßstellen. Francis, der schmunzelnd zugehört hatte, erklärte die seltsamen Zusammenhänge von Kescher und Schmetterlingen, während ich mich auf einen Drink freute. Ich nahm mir ein großes Glas und aus all den schönen Flaschen je einen kleinen Schuß, dann das Eis, eine Zitronenecke und endlich den ersten Schluck. Wahoooo! Er kam sofort an ... der nächste und ein weiterer auch, und ich wollte gerade den anderen sagen, daß ich gern hier bleiben würde, da fiel ich auch schon von der Lehne, weich und fließend in die neue Welt.
2
Um vier Uhr morgens saßen alle im Rover, ich auch, wie man mir sagte. Mein Kopf dröhnte und paßte zu der frühen Aufbruchstimmung. Adalbert sah frisch gebügelt aus und freundlich, ich kuschelte mich leicht an ihn. »Wenn ich dich kurz aufklären darf, nachdem du uns gestern so frühzeitig verlassen und Felsfurchs Pläne nicht mitbekommen hast...«, eröffnete er mir. »Wir haben ungefähr drei Stunden Fahrt vor uns, dann geht es nur noch zu Fuß weiter.«
»Na, wunderbar, bis dahin bin ich wieder fit.« Erschöpft drehte ich mich zum Fenster und wurde an mageren Rindern vorbeigeschaukelt, an ein paar gaffenden Frauen, ich gaffte zurück. Ein schmaler Weg führte uns direkt in den Wald, der seinen kühlen Atem durch die Fenster hauchte. Die folgenden Wege wurden enger, Bäume standen dichter, die Erde sah schwarz und fett aus. Wir kreuzten eine fünfspurige Straße. Leise und verächtlich erklärte uns Felsfurch:
»Diese Trasse hier führt direkt in den Kongo und soll den Holzfällern den Wald öffnen. Über 150 Kilometer lang. Primärwald vom Feinsten. Stellt euch mal vor, wie vielen Tieren und Pflanzen durch dieses Projekt der Lebensraum entzogen wird. Sie verschwinden für immer von diesem Planeten.«
Plötzlich peitschten Äste auf die Windschutzscheibe. Wenn ein Weg zugewachsen war, tat sich irgendwie immer ein neuer Weg auf. Nach ein paar Minuten saßen wir jedoch endgültig fest, der Pfad endete in undurchdringlichem Dickicht. Man hörte fremdartige Geräusche und die vereinzelten Schreie eines Vogels. Hinter uns wurden Stimmen laut. »Tangueoghobo, hingo ... so nye ...«
Eilig warf Francis das Gepäck aus dem hinteren Rover, dann hupte jemand, und wie Geister wuchsen plötzlich braune, halbnackte Menschen aus dem Boden. Teilweise nur mit löcherigen Hosen bekleidet, standen sie in sicherer Entfernung, scheu und unbeweglich. Plötzlich traten sie zur Seite, und ein größerer Schwarzer kam in Shorts und T-Shirt auf uns zu geschlendert. Zum erstenmal zeigte Felsfurch so etwas wie Freude, zog die linke Mundhälfte nach oben, eineinhalb Zentimeter, und begrüßte den Mann, indem er ihm unaufhörlich die Hand schüttelte. Dann wandte er sich an uns. »Das ist Sabango, unser Dolmetscher, er hat uns die Träger hier mitgebracht.«
Gespannt sprang ich aus dem Wagen, begrüßte Sabango und fand ihn spontan nett. Unauffällig versuchte ich, die exotische Gruppe ins Auge zu fassen. Sabango rief den vier jungen Männern in einer gutturalen Sprache etwas zu, und sie kamen zögernd näher. Sie waren drahtig, nicht einmal anderthalb Meter groß, trugen einen Schamschurz aus dünner Rinde oder etwas Ähnlichem, und sie waren ziemlich behaart, sogar an den Oberarmen. Schöne, schräg stehende, dunkle Augen blickten aus aufgeschlossenen Gesichtern. Auch sie musterten uns verhohlen und luden dann vorsichtig die vielen Gepäckstücke in Tragegurten auf den Kopf und vor die Brust, bevor sie lautlos in den Wald verschwanden. Das waren die ersten Pygmäen meines Lebens, dachte ich, aber anscheinend auch die letzten, die ich sehen sollte, denn sie waren urplötzlich weg, wie vom Erdboden verschluckt.
»Habt ihr das gesehen, so schnell ist unser Gepäck weg«, wandte ich mich an Adalbert und sah, daß auch meine Leute inzwischen beladen waren. Felsfurch warf seinen Autoschlüssel dem Ersatzfahrer zu. »E k’i ri na ok’a an.«
Der sprang in den Wagen und rangierte mühsam herum. Niemand nahm Notiz von mir, statt dessen verschwanden Nosbusch, Adalbert und Felsfurch in der gleichen Richtung wie die Träger, und der Wald schloß sich lautlos hinter ihnen. Auch sie waren wie vom Erdboden verschluckt.
Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, wurde aber bereits mit meinem Rucksack und der Kameratasche beladen. Der freundliche Francis verabschiedete sich von mir: »Also dann in sechs Wochen um sieben Uhr. Bonne chance.« Mit einem letzten bewundernden Blick auf mich sprang er in den Wagen und setzte ebenfalls zurück, dem anderen Rover hinterher.
Verdammt, ich war allein. In dem ganzen Aufbruchsgetümmel war mir gar nicht bewußt geworden, daß tatsächlich alle abgezogen waren. Das war doch nicht möglich, man hatte mich einfach vergessen! Voll panischer Angst rannte ich in die Richtung, in der alle untergetaucht waren, und fiel der Länge nach hin. Durch den Schwung hatte sich das schwere Gepäck auf die Seite verlagert. Wie ein dicker Käfer, der auf den Rücken gefallen ist, strampelte ich mich schwerfällig wieder hoch. Für ein paar Sekunden war ich doch froh, daß niemand in der Nähe war und mich sah. Mit einem kleinen Gebet auf den Lippen schlug ich mich in den Dschungel, in dieses schier undurchdringliche Grün. Außer meinem Herzklopfen war nichts zu hören. Ein einsamer Schrei, dann herrschte beängstigende Stille, ab und zu leises Rascheln, mir war es nicht geheuer. Deutlich hatte ich Nosbuschs Ausführungen in Erinnerung, wie sehr er sich auf all die Spinnen, Schlangen und wunderbar seltenen Skorpione freute, alles sei hier zum Greifen nah ... Um mich herum war ein dichter Vorhang aus fleischig-haarigen Blättern, und dahinter der nächste, ein Irrgarten, kein Weg, nur Schlingen und Äste, die mir ins Gesicht peitschten, während Moskitos sich an meinem Hals festsaugten.
Ich hastete weiter, bemühte mich, die Füße nur so kurz wie möglich am Boden zu lassen, um sie nicht irgendwelchen Bissen oder sonstigen Angriffen auszusetzen. Angst pochte in meinem Hals. Wo war bloß meine gemütliche Fernsehecke mit dem kuscheligen Bett und meinem süßen Knuddelkater? Irgend etwas kroch in meine Socke und biß kräftig zu. Ich schrie auf und versuchte mit langem Finger danach zu kratzen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren.
Da hörte ich Laute vor mir, österreichische Freudenlaute. »Hast des g’sehn?« Gott sei Dank! Wie schön war doch diese Sprache. Schweißtropfen perlten mir in die Augen, als ich halb blind den Stimmen hinterherrannte. Endlich holte ich die anderen ein und stellte entsetzt fest, daß mich niemand vermißt hatte. Schweigend und enttäuscht gesellte ich mich zu dieser egoistischen Bande und atmete das erstemal tief durch.
Die Augen nun fest auf die Fersen meines Vordermannes geheftet, trat ich in seine Spuren und riskierte keinen Blick nach rechts oder links. Anscheinend setzte dieser mysteriöse Urwald in mir Urängste frei, denn ich hatte auf einmal das Gefühl, daß hinter jedem Baum der grüne Horror auf mich lauerte und mich beißen, stechen und aussaugen wollte. Dieser Schweigemarsch erschien mir ewig. Plötzlich kam die Kolonne zum Stillstand, und ich rempelte gegen Adalbert. Er war ebenfalls bis an die Zähne bepackt und drehte sich behäbig zu mir um. »Jetzt haben wir uns aber eine Rast verdient.« Keine weitere Nachfrage, kein: »Na, liebe Julia, wie fühlst du dich, alles in Ordnung, wenn irgend etwas ist, sag ruhig Bescheid ...« Na ja, wir waren halt unter uns Männern.
Ich arbeitete mich nach vorn zu den anderen, denn inzwischen hatte ich wirklich Angst, als letzte vom Affen gebissen zu werden. Ich mußte kurz lachen, weil ich dieses Sprichwort fast körperlich erlebte. Dann wischte ich mir die Moskitos vom Hals und versuchte mir Ohren und Nasenlöcher frei zu bohren. Als ich gerade einen Schluck Wasser trinken und die verdiente Rast beginnen wollte, setzte sich, wie auf ein geheimes Kommando, der Schweigemarsch wieder in Bewegung. Mit Mühe hastete ich hinter Sabango, wo es mir am sichersten schien. Schon machte er mich auf einen breiten, roten Ameisenzug aufmerksam. »Nicht reintreten, Vorsicht«, warnte er. Mit einem Satz überwand ich den Zug, landete knallhart in einer Lianenangel, und als ich mich an einem Ast über mir festhalten wollte, griff ich treffsicher in einen Dornenableger. Äußerst schmerzhaft. Ich wischte mir das Blut an der Hose ab und wollte Jod aus dem Rucksack nehmen, aber schon wurde ich von hinten weitergeschoben. »Na klar, wir Männer«, fauchte ich über die Schulter.
Bei unserem zügigen Tempo blieb mir keine Zeit, an irgend etwas anderes zu denken als an die Frage, wo ich den nächsten Schritt hinsetzen sollte. Über mir hörte ich schweres Schwingenrauschen. Es mußte ein sehr großer Vogel sein, kurz sah ich dunkle Flügel in einem Blätterloch.
»Ein Kronenadler!« rief Adalbert begeistert am Ende des Zuges.
Außer mir schienen alle verzückt zu sein. Ich aber kämpfte und litt still, voller böser Vorahnungen. Ein paar karge Sonnenstrahlen fielen senkrecht durch die Zweige. Es mußte Mittag sein, und demnach hätten wir bereits fünf Stunden Fußmarsch hinter uns. Doch wir drangen immer tiefer in den Regenwald, und nun wurde der Boden auch noch schlammig. Mit jedem Schritt versank ich tiefer in sumpffarbener Brühe. Schließlich watete ich bis zu den Oberschenkeln im Wasser. Einer der Führer blieb stehen, deutete nach vorn zu einer kleinen Lichtung und winkte Sabango zu sich. »Gasi.« Sie unterhielten sich leise und ein wenig aufgeregt, dann übersetzte er uns: »Da vom ist wohl ein Jagdlager der Pygmäen, wir sollen leise sein.«
»Wieso denn leise«, fragte ich zurück, »das sind doch sozusagen Kollegen von unseren.«
Sabango kicherte leise. »Nix Kollege, unsere Leute sind Banda, das da sind By-Aka-Pygmäen.«
Felsfurch warf mir einen vielsagenden Blick zu. »Nun hört doch auf zu quatschen und laßt uns weitergehen.«
So ein Ekel! Ich blickte böse zurück, doch ein wenig später kreisten meine Gedanken nur noch um die Hoffnung, wieder festen Boden zu gewinnen und daß die Pygmäen heute schon eine gute Mahlzeit hatten. Stille ... Vorsichtig schlichen wir weiter, mir war es sehr mulmig zumute, denn das hier waren nun wohl die echten »Herren des Waldes«, wie ich in einem Reisebuch gelesen hatte. Hier, tief im Primärwald, hatten sie weder Kontakt mit der Zivilisation noch mit anderen Bevölkerungsgruppen und lebten wie in der Steinzeit. Nur zum gelegentlichen Tausch von Wild gegen Metall für Speerspitzen suchten sie kurzfristig die Nähe der Bantu. Adalbert bedeutete mir, das Gepäck abzulegen und still zu sein. Unser Führer hatte seine Last bereits fallen gelassen und war verschwunden. Das fing ja gut an. Eine innere Stimme bereitete mich darauf vor, daß wir nun gefangen und gebraten würden. Es war so verdammt still, nicht mal das Knacken eines Astes war zu hören.
Nach einer geraumen Weile tauchte unser Führer genauso plötzlich wieder auf, wie er verschwunden war. Zweige öffneten sich brüsk, und da stand er! Ich roch seinen scharfen Körpergeruch. Er sagte etwas zu mir, was ich mit einem selbstverständlichen »Oui, o.k« akzentfrei beantwortete. Als er darauf wieder in dieselbe Richtung verschwand, folgte ich ihm automatisch durch das Dickicht. Erst da fiel mir auf, daß ich ihn ja gar nicht verstanden hatte! Wohin lief er eigentlich? Ich sah mich um und blickte in Felsfurchs grinsendes Gesicht.
»Sie haben die Sprache aber schnell gelernt.«
Verärgert kroch ich weiter durch das Unterholz. Auf einmal tauchte ein dünner Pfad vor uns auf, dann eine kleine Lichtung mit vier runden Laubhütten, hinter denen gerade noch kurze, braune Beine sichtbar waren, die in das Gehölz rannten. Wir blieben stehen, offensichtlich waren alle geflüchtet.
»Und was jetzt, was schlagt ihr vor, nachdem dies wohl die letzten By-Aka-Beine waren, die wir zu Gesicht bekommen haben?« Adalbert sah fragend zu Felsfurch.
Für den war die Sache klar, und er zeigte uns mal wieder, wie blöd wir waren. »Also, wir werden hier in einiger Distanz zu dem Lager unsere Sachen ablegen, ihr könnt euch dann ja wieder etwas ausruhen.« Dies mit einem fiesen Seitenblick zu mir. »Wir haben noch ungefähr vier Stunden Marsch, bis wir auf die Gruppe stoßen, zu der ich möchte.«
Ich fand diesen Typen einfach zum Kotzen und konnte mir nun nicht mehr verkneifen zu fragen: »Sagen Sie mal, Felsfurch, haben Sie ein Magengeschwür, oder wieso sind Sie so eklig?«
Wie aus der Pistole geschossen kam es zurück: »Ich bin nicht eklig. Nur frage ich mich, wieso man ständig gebremst wird von jemandem, der von nichts Ahnung hat.«
Adalbert griff ein, geduldig wie immer: »Kinder, beruhigt euch. Es wird sich alles finden.«
So ein Feigling, der keine Partei ergreifen will, dachte ich. Inzwischen hatten die Träger den Boden mit der Machete freigeschlagen, und wir ließen uns nieder. Ich versuchte mich schonend dem Rucksack zu entwinden, der auf dem Rücken festgewachsen schien, und suchte meine Vitaminmineralantidurchfallprophylaxflasche heraus. Ein großer Schluck davon tat mir ungeheuer gut. Es war spät geworden, und ich spürte meine müden Knochen. Doch unter dem Scheitel war ich hellwach. Ich hatte viel zuviel Angst, um einzudösen, wie die anderen, meine tapferen Freunde neben mir. Die hatten sich langgestreckt ihrer Mattigkeit ergeben, und ich fühlte mich mal wieder ausgesetzt, allein gelassen. Plötzlich raschelte es hinter mir, und ich fuhr fürchterlich zusammen, das Blut hämmerte in meinen Adern. Halb erstarrt versuchte ich, unauffällig das Terrain zu sichern. Es war nichts zu sehen, dennoch hatte ich das deutliche Gefühl, nicht so allein zu sein, wie eben noch geglaubt. Trotz meiner Angst lag es mir überhaupt nicht, Katastrophen abzuwarten, und so kramte ich mit unauffälligen Bewegungen in meinem Rucksack nach dem Fahrtenmesser. Ich hielt es fest umschlossen, doch nichts rührte sich.
Erleichtert ließ ich das Messer wieder los. Gut so, denn wie ich mich kannte, hätte ich mich nur selbst damit verletzt. Trotzdem fühlte ich mich ständig beobachtet. Da kam ich auf eine Idee ... Aus der Provianttüte fischte ich eine Büchse Ölsardinen und eine Schachtel Zigaretten, öffnete die Dose und aß etwas davon. Dabei drehte ich mich langsam nach allen Seiten, so daß sie jeder verborgene Feind sehen konnte. Schließlich stellte ich die angebrochene Büchse dicht neben das Gebüsch hinter mir. Nun zündete ich eine Zigarette an, legte die restliche Packung neben die Sardinen und war sehr froh, Karl May gelesen zu haben. Während ich versuchte, genüßlich zu rauchen, was bei dem kratzenden schwarzen Kraut nicht einfach war, musterte ich unauffällig die Gegend. Es rührte sich immer noch nichts. Auch bei den müden Pfadfindern rührte sich nichts. Was aber, wenn angegriffen wurde? Armbrust gab es sicher hier, Schlingen und Jagdnetze, Giftpfeile.
Plötzlich sah ich, wie ganz vorsichtig eine kleine braune Hand aus dem Gebüsch kam und ... grapsch! Die Zigaretten waren weg. Ich war wie gelähmt, das heißt, ich war gelähmt. In einiger Entfernung knackte ein Ast, ganz leise, dann war wieder Stille. Anscheinend war ich noch mal verschont geblieben. Langsam kribbelte wieder Leben durch meine Glieder. Da ließ mich ein Röhren erneut erstarren, in Zeitlupe drehte ich mich um und blickte in den weit geöffneten Rachen von Adalbert, der wieder einen röchelnden Schnarcher von sich gab. Nun mußte ich doch lachen, so leise wie möglich. Eine ganze Weile noch beobachtete ich die Büchse neben dem Gebüsch. Als nichts geschah, nahm ich noch ein kleines Fischstück heraus und kaute es ganz langsam. Mit flauem Magen wartete ich, wartete, wartete ... Auf einmal, ganz zögernd, teilten sich die Zweige des Gebüsches wie von Geisterhand. Dahinter erblickte ich ein unbewegliches, fremdartiges Gesicht. Zwischen tätowierten Wangenknochen und buschigen schwarzen Augenbrauen sahen mich dunkle mandelförmige Augen unverwandt an. Ich versuchte meiner Erstarrung ein Lächeln abzuringen und erhielt aus meinem tiefsten Innern das Signal, unbedingt wieder zu atmen. Die Zigarette hatte mir inzwischen die Finger verbrannt, ich warf sie weg. Meine Gedanken überschlugen sich. Sollte ich ihm die Ölsardinenbüchse entgegenhalten oder vielleicht gar nicht hinsehen? Mit vorsichtiger Geste bot ich die Büchse an. Die Augen musterten mich starr, und ich nickte ihnen auffordernd zu, und schon griff wieder eine kleine, braune Hand zu, diesmal kam sie aber von weiter drüben und grapsch! Die Dose war verschwunden.
Das Gesicht hatte sich nicht bewegt, die Augen musterten mich immer noch. Wieder machte ich eine einladende Geste näherzukommen und bot diesmal eine Zigarette an. Angezündet reichte ich sie als Friedenspfeife nach hinten. Etwas griff danach, und gleich darauf sah ich, daß im Gebüsch geraucht wurde. Ich machte Zeichen, daß ich auch wieder ziehen wollte, und bekam tatsächlich die Zigarette zurückgereicht. Diese Geste war mir rein zufällig eingefallen, mein »Professore« hatte sie einmal in einer Vorlesung als verbindende Zeremonie geschildert, wie wahr!
Ich mußte husten und sah, wie sich das Gesicht zu einem Lachen verzog. Endlich war der Bann gebrochen, ich lachte mit, erlöst und voller Dankbarkeit, ein menschliches Zeichen empfangen zu haben. Nun kam es vollständig zum Vorschein, dieses Wesen, ein braunhäutiger Mann in faserigem Lendenschurz. Ohne zu zögern, teilte er das Gebüsch und kam auf mich zu. Ich winkte ihm, sich neben mich zu setzen, was er auch tat, in gewissem Abstand, versteht sich. Eine eindrucksvolle, kleine Gestalt, vernarbt, mit schiefen Schultern, verbogenem Knie, vereinzelt fehlenden Fingern und einem verschmitzten Gesicht. Er wirkte erfahren und schlau. Sicherlich war er der Medizinmann, oder wie nannte man das hier?
Aus seinen geschlitzten Augen beobachtete er die Schlafenden und grinste. Sein Grinsen wurde noch breiter, als er mich anschließend musterte. Unwillkürlich sah ich den kleinen Weg entlang und suchte ihn heimlich nach Knochen oder anderen menschlichen Überresten ab. Voller Unbehagen rutschte ich etwas weiter weg von dem Mann. Der hatte mich nicht aus den Augen gelassen. Nun drehte er sich um und blickte in das Dickicht. Besorgt folgte ich seinem Blick und sah in dem unergründlichen Grün etwas hochschnellen oder herunterfallen, eine blitzschnelle Bewegung jedenfalls. Sekundenlang sah ich ein dunkles Gesicht, ein Ast schwang zurück, und das Dickicht schloß sich wieder. Angestrengt versuchte ich, das Laub auf weitere Gefahren abzusuchen, dann wandte ich mich wieder meinem neuen Nachbarn zu, der inzwischen eine andere Stelle fixierte. Ein heißer Stich fuhr mir durch den Körper, als ich Augen erkannte, die mich anglühten, dicht daneben noch ein Paar, und dann bemerkte ich noch weitere.
Ich bekam einen Schluckauf, der laut durch die Stille des Urwaldes hickste. Meine Augen brannten vom angestrengten Starren, Schweiß rann mir in Bächen den Körper herab. Ich beschloß, in Sicherheit zu gehen, und rutschte langsam zurück, ohne den Blick vom Gebüsch zu lassen. Plötzlich stieß ich mit dem Hinterteil auf Widerstand, und als ich mich ruckartig umdrehte, saß ich fast auf den behaarten Füßen des knorrigen Medizinmannes. Ein scharfer Geruch nach Waldmarinade und angebranntem Schweinespeck umgab ihn. Ich lächelte ihm verkrampft zu, er nickte erfreut und zog dabei die Augenbrauen stark nach oben. Ich entspannte mich ein wenig. Inzwischen schwankten meine Gefühle zwischen Furcht und »Besitzerstolz«. Schließlich hatte ich den kleinen Mann erobert, und nun gehörte er mir. Der Besitzerstolz setzte sich durch, und zufrieden weckte ich die anderen. Zuerst tippte ich Adalbert an, der sofort in Angriffsstellung ging.
»Ganz ruhig, du bist hier bei Freunden«, sang ich leise zwischen zusammengepreßten Zähnen, »wenn auch im Urwald«, führte ich ihn weiter in die Realität zurück. Felsfurch wachte auch auf und musterte erstaunt die Umgebung. Nosbusch jedoch hatte die tollste Reaktion, als er geweckt wurde: Er schreckte kurz hoch, sah die neuen Gesichter - »Ja servus, da sans ja.« - blickte fröhlich in die Runde und nickte uns allen hocherfreut zu.
Ich mußte unwillkürlich lachen. »Du nix Angst?« fragte ich ihn.
»Ach geh. Der gute Mann ist nicht mal halb so hoch wie ich.« Er hatte recht.
Fast kamen mir meine vorangegangenen Ängste albern vor. »Na gut. Aber all die anderen ...?« Ich deutete in den Wald. Da sahen meine Begleiter in ein gutes Dutzend regloser, wild aussehender Gesichter.
Adalbert flüsterte mir anerkennend zu: »Wie hast du es bloß angestellt, daß die plötzlich alle da sind?«
»Ich habe sie mit Zigaretten und einer Büchse Ölsardinen angelockt, dann aber einen furchtbaren Schrecken bekommen, als sie tatsächlich neben mir saßen.« Wir lachten alle, auch die Pygmäen lachten mit.
Sabango tauchte plötzlich wieder auf, der Tapfere. Und schon wurde er von Felsfurch angeblafft: »Wenn du uns noch einmal im Stich läßt, schicke ich dich sofort nach Hause, und du bekommst keinen Pfennig Geld. Wo sind denn überhaupt die vier Träger?« Suchend sahen wir uns um. Mir fiel jetzt erst auf, daß wir allein gelassen worden waren.
»Wir hatten alle Angst«, erklärte Sabango mit so heftig rollenden Augen, daß man fast nur noch das Weiß darin sah. Felsfurch schimpfte weiter, nun zu mir gewandt: »Und Ihnen verbiete ich hiermit ein für alle mal, jemals wieder irgendeine Unternehmung im Alleingang zu machen, solange Sie mit uns zusammen sind. Das ist unverantwortlich.« Den Schluß schrie er fast heraus: »Ich werde nicht wegen so einer blöden Kuh mein Leben aufs Spiel setzen.« Das war an Adalbert gerichtet.
Ich war so empört über seinen Umgangston, daß ich wütend zurückbrüllte: »Sagen Sie mal, wie reden Sie denn mit mir, Sie Affe!« Wütend baute ich mich vor ihm auf und war nahe daran, ihm eine zu langen.
Doch da stand schon Adalbert neben mir und hielt ahnungsvoll meine Hand fest. »Kinder macht doch nicht so einen Zirkus, man kann sich doch über alles normal unterhalten.«
Felsfurch hatte nun aber auch für ihn etwas bereit: »Wenn ich gewußt hätte, daß keiner von euch hier tauglich ist, hätte ich diese Expedition gar nicht gemacht.« Aufgebracht stolzierte er hektisch hin und her, dann blieb er plötzlich vor Sabango stehen. »Sag den Leuten,« - er nickte zu den Pygmäen hinüber - »daß wir von weither kommen und sie in friedlicher Absicht besuchen.«
Jetzt mußte ich doch lachen. »In friedlicher Absicht, sagen Sie, und dabei brüllen Sie hier seit zehn Minuten aggressiv herum.«
Mit hochrotem Gesicht drehte Felsfurch sich zu mir um. »Falls Sie mich noch einmal in irgendeiner Form blöd ansprechen, geht einer von uns beiden, darauf können Sie sich verlassen.«
Ich holte tief Luft, um mich zu bremsen. War das alles peinlich! Sabango unterhielt sich bereits mit dem Alten und machte weit ausholende Gesten. Das sollte wohl »von weit her« darstellen. Schließlich sah er den Mann abwartend an, ich auch, wir alle. Eine lange Pause entstand. Ich blickte Adalbert fragend an, der zuckte nur mit den Achseln. Endlich ertönte ein langgezogenes »iiihhhhh« neben mir. Sabango strahlte erlöst und übersetzte: »Er hat verstanden, ›iiii‹ heißt ›ja‹«. Na, bravo, das hätte ich fast genauso schön übersetzen können.
Felsfurch knurrte weiter: »Frag sie, ob wir bei ihnen bleiben dürfen.«
Diese Frage wurde auch nach einer langen Pause nicht beantwortet. Statt dessen erhob sich der Alte und schritt humpelnd, wenn auch äußerst würdevoll, in das Dickicht zurück ... verschluckt ... weg. Wieder wechselten wir fragende Blicke, und Adalbert sagte besorgt: »Ich bin jetzt auf das Schlimmste gefaßt.« Mir war auch ziemlich mulmig, sogar Nosbusch rückte unruhig hin und her und zupfte nervös an seinem Schmetterlingsfänger.
Ständig krabbelten kleine Bienen in meinen Haaren und klebten auf dem Schweiß fest, auch meine Nase war voll von ihnen. Die Füße schmerzten und waren geschwollen vom langen Laufen, alles Vertraute war so verdammt weit weg. Wut kroch wieder in mir hoch.
Plötzlich entstand Bewegung hinter meinem Rücken, und ich sah gebannt in diese Richtung, in die auch der Alte verschwunden war. Leise Stimmen, Knacken und Rascheln waren zu hören, sehr spannend. Der Wald öffnete sich ... hallelujahh ... und der Alte hielt Einzug mit einem Gefolge aus fünf jungen Männern, die mit Armbrust und Speeren ausgestattet waren, drahtige Burschen mit unbeweglichen Mienen, muskulösen Oberkörpern und Schenkeln. Nur die Waden waren etwas verkümmert und nach außen gewölbt. Bekleidet waren sie mit einem Lendenschurz, das heißt, das Wichtigste war in eine Art Rindenlappen gepackt, vorne nach oben gezogen und mit einer Lianenschnur um die Taille befestigt. Hinten war es durch die Backen nach oben gedreht und auch an der Liane festgezurrt. Die Köpfe waren, abgesehen von einer kleinen Tonsur, kahl geschoren, auf den Wangenknochen waren blaue Häkchen tätowiert und in die Augenbrauen schmale Längsstreifen rasiert. Der Vorderste sah sehr gut aus, seine kohlschwarzen Augen schienen ein besonderes Geheimnis zu bergen ...
Der Alte ließ sich gemächlich an der erloschenen Feuerstelle auf einem Holzscheit nieder, während die anderen wie angewurzelt stehenblieben und zu uns herüberstarrten. Ich griff nach meiner Kamera und überlegte gerade, wie ich die Pygmäen um Erlaubnis fragen sollte, da wohl keiner verstehen würde, was ein Foto ist, als ich hörte, wie Felsfurch schmallippig einen Befehl zu uns zischte:
»Ihr bleibt hier sitzen, bis ich eine Verhandlungsbasis geschaffen habe. Pygmäen sind zwar im allgemeinen friedlich, doch werden wir nichts provozieren und uns in respektvollem Abstand halten.« Er kniff den lippenlosen Mund noch mehr zusammen und blickte bedeutungsvoll von einem zum anderen. Sein Blick fiel auf meine Kamera, und schon ging es los: »Sagen Sie mal, kapieren Sie eigentlich gar nichts? Gerade sage ich, daß wir nichts provozieren wollen, und Sie holen Ihren dämlichen Fotoapparat heraus.«
»Meinen dämlichen Fotoapparat habe ich sehr gut unter Kontrolle. Und von Ihnen laß ich mir überhaupt keine Vorschriften machen, Sie altes Ekel«, giftete ich zurück. »Ihr gestörtes Verhältnis zu Frauen können Sie woanders abreagieren.« Mit den letzten Worten hätte ich fast die große Fliege verschluckt, die seit der Ölsardinenaffäre um meine Nase kreiste. Ich hatte so sehr die Nase voll von diesem Typen, daß ich beschloß, beim nächsten großen Krach die Expedition abzubrechen. Bei diesem Gedanken kam eine wunderbare Ruhe über mich und ließ mich etwas heiterer an den folgenden Geschehnissen teilnehmen.
Unser Platz füllte sich auf einmal, die Männer kamen nicht, sie waren plötzlich da. Unbeweglich starrten sie uns an. Nirgends waren Frauen oder Kinder zu sehen. Sabango winkte uns herüber, er wollte uns wohl vorstellen. Das war die Gelegenheit: Schnell nahm ich die Kamera und machte erste Aufnahmen. Es war mir egal, was daraus entstehen konnte, es mußte jetzt sein.
Adalbert raunte mir zu: »Paß auf, wo du dich hinsetzt. Hier gibt es überall Sandflöhe.«
»Mein Gott, was denn noch alles, ich kann doch nicht die ganze Zeit stehenbleiben.« Ich beschloß, erst einmal zu beobachten, was die anderen machen würden. Nosbusch setzte sich in den Sand, das war vorauszusehen; Felsfurch hockte mit den Hinterbacken auf seinen Fersen; der lange Adalbert knickte einfach in der Mitte zusammen und beugte auf halber Höhe den Kopf nach vorne. Ich wählte System Felsfurch.
Eindringlich und offenen Mundes musterten mich die kleinen Burschen von oben bis unten. Zu gern hätte ich das gleiche getan, schämte mich jedoch ein wenig und versuchte es durch halbgeschlossene Lider. Auf den zweiten Blick fand ich sie gar nicht mehr so wild aussehend. Meine Betrachtungen wurden von Sabango unterbrochen.
»Das ist Maseke.« Er deutete auf den Alten. »Er ist der Dorfälteste.«
Ich wiederholte den Namen, und Maseke nickte begeistert. Dann stellte ich mich vor: »Juuuliiiaaah.«
Er lachte, und dabei entblößte er blitzende, spitz zugefeilte Zähne. Erschrocken zuckte ich zurück, verlor das Gleichgewicht und fiel mit dem Hintern in die Flöhe. Nie in meinem Leben war ich so schnell wieder auf den Beinen wie jetzt, schüttelte die Hosenbeine und klopfte mir auf den Po. Dabei sah ich im Geiste, wie das Piranhagebiß des Alten ein saftiges Stück Fleisch aus meinem Körper riß. Unwillkürlich tastete ich mich ab.
Felsfurch ließ mittlerweile Maseke fragen, ob noch andere By-Aka-Gruppen in der Nähe seien. Der Alte zeigte nach Norden - oder war das hier vielleicht Süden? Sabango übersetzte, daß es in der Nähe noch ein anderes Lager gebe, doch zur Zeit seien die Männer dort zur Affenjagd aufgebrochen. Adalbert sah Felsfurch etwas hilflos an. »War denn nicht ausgemacht, daß die dableiben?«
»Doch, natürlich, deshalb bin ich ja das erstemal hergekommen. Aber sie haben halt ihren eigenen Rhythmus.« Und noch grantiger fügte er hinzu: »Wenn es hier Zeit zum Jagen ist, dann jagen sie halt. Du hast es da einfacher: Wenn du Hunger hast, gehst du zum Kühlschrank.«
Maseke erkundigte sich, was wir von den anderen wollten, und als wir ihm erklärten, daß wir für kurze Zeit gern bei ihnen leben würden, fand er das merkwürdig, wie ich an seinen erstaunten Augen sah.
Zwei Frauen tauchten auf einmal auf. Eine trug einen Säugling rittlings auf der Hüfte. Schlafend hing er dort in einer breiten Hängeschlaufe aus Lianen. Scheu und eilig schlüpften sie in eine Hütte.
Ich konzentrierte mich gezwungenermaßen voll auf mein T- Shirt, in dem es hundertfüßig krabbelte. An meinem Hals unter dem Tuch juckte es, und zwischen den Pobacken kroch etwas langsam in untere Gefilde. Ich kratzte und zwickte überall, und zu allem Überfluß fielen mich wieder die kleinen Bienen in Schwärmen an, flogen mir haufenweise in Nasenlöcher und Ohren und brannten in den Augen. Als ich panisch mit dem Halstuch nach ihnen schlug, machte sie das nur noch wilder. In einer großen schwarzen Wolke folgten sie mir zum Gepäck. Ich rannte hin und her, aber die Biester ließen sich nicht abschütteln. Auch die anderen wurden gequält.
Resigniert fragte ich Adalbert: »Bleiben wir nun hier? Ich habe Hunger und würde auch gern die weitere Planung wissen.«
Da kam Maseke zu uns und machte eine weit ausladende Geste auf sein Terrain, das hieß, wie Sabango übersetzte, daß wir dableiben durften. Wir bedankten uns, und freudig schüttelte Adalbert allen die Hand. »Vergelt’s Gott.« Meine Hand wollte er auch drücken im Überschwang.
»Ist ja gut«, beschwichtigte ich ihn. »Vergiß bloß nicht den Handkuß bei den Damen«, fügte ich hinzu und stellte mir dabei vor, daß die Mädels hier sicher dachten, er wolle ihnen die Finger abbeißen.
»Jetzt eilt es ein bissl... Nosbusch, hilf Julia, das Zelt vorzubereiten, ich schaue mich inzwischen nach einem geeigneten Lagerplatz um«, drängte Adalbert.
Fast fühlte ich mich wie zu Hause und legte das Zeltgepäck aus. Felsfurch brüllte nach Trägern und gab mit königlichen Gesten Anweisung, den Boden zu säubern. Er hatte bereits die Macheten ausgepackt. Alle Träger halfen natürlich ihm, für uns war niemand übrig.
Adalbert rief: »Kommt her, ich habe einen schönen Platz gefunden.« Wir staunten nicht schlecht, unser neuer Platz, circa sechs mal acht Meter, war schon fast von Unterholz freigeschlagen. Grégoire, einer der Träger, hatte mit seiner Machete Lianen abgehackt, und zwei kleine Frauen fegten den Boden. Sie lächelten mir verschämt zu, und meine Menschenfressersorge löste sich in Wohlgefallen auf. Diese Menschen hier schienen genauso neugierig wie wir und hatten die gleiche Angst vor Neulingen, nur wirkten sie freundlicher als wir und redeten nicht so viel. Ihre dunklen, undurchdringlichen Augen und das wilde Aussehen trugen natürlich nicht zur schnelleren Verständigung bei, ein paar ängstliche Vorurteile blieben. Man konnte ja nie wissen... Adalbert wies uns die Zeltplätze zu. Zur Sicherheit bekam ich den Lagerplatz zwischen den beiden Männern. Der Aufbau ging flott voran. Ich zerrte Stangen und Geraffe aus dem Armysack und baute, fädelte und steckte das Zelt zu einem häuslichen Dreieck zusammen. Dabei wurde ich die ganze Zeit von staunenden Pygmäen beobachtet, die nun wie eine braune Mauer an unserem Camp in ihrer Nachbarschaft standen. Vorsichtig und mit eingezogenem Kopf kletterte ich stolz durch die Öffnung, tastete prüfend über die Bodenmatte, zog den Reißverschluß hinter mir zu und saß schließlich gebückt, aber froh in meinem Zelt. Ziemlich klein, das sogenannte Radlerzelt, dessen Namen wohl bedeutete, daß man so zusammengeklappt schlief, wie man auf dem Sattel saß. Tastend überprüfte ich die Zeltwand auf Löcher, denn meine größte Sorge galt Schlangen- und Kriechtierbesuchen, doch fand ich nicht den kleinsten Defekt. Da fiel ein länglicher Schatten über das Zeltdach und vergrößerte sich zusehends. Ich erstarrte.
»Sag mal, was kratzt du denn da herum?« wollte Adalbert über mir wissen.
Langsam atmete ich wieder aus. »Ich wollte nur mal sehen ...«
»Ach Julia, ich habe dir doch gesagt, daß es ein nagelneues Zelt ist.«
»Aber die Wände sind so dünn«, kam meine klägliche Antwort.
»Das hat doch nichts zu bedeuten, es ist das modernste Material. Komm jetzt heraus, wir müssen schnellstens Proviant und die Lampen herrichten. Hier wird es von einer Minute zur anderen dunkel.«
Ich kroch aus meinem Zelt und sah direkt in das grinsende Gesicht Albert des Langen, der sich erwartungsvoll meinem Eingang entgegengebeugt hatte. »Wie kann ein einzelner Mensch nur soviel Angst haben?«
»Na, du hast gut reden, bist Zoologe, Biologe, Ornidings ... kannst viechermäßig jedenfalls Feind von Freund unterscheiden. Das einzige, was ich weiß, ist, daß Hunde Zähne zeigen, bevor sie beißen. Wenn das bei Schlangen und Spinnen auch so ist, habe ich wenigstens einen kleinen Anhaltspunkt. Also?«
Er zog mich hoch. »Ich werde dir später ein paar Grundlagen der Biologie beibringen, und bis dahin sorge ich dafür, daß deine schöne Haut von giftigen Bissen verschont bleibt.« Mein lieber Hofrat ließ mal wieder seinen österreichischen Charme spielen.
Mein Blick fiel auf unsere Zuschauer, die ziemlich fassungslos in die Richtung von Nosbuschs Zelt blickten, und was ich da sah, belustigte mich außerordentlich. Unter seiner Zeltplane bewegte es sich heftig. Die kräftigen bleichen, mit roten, borstenartigen Haaren bedeckten Beine ragten heraus, mal zuckten sie vor, mal zurück, und mit jedem Zucken flog ein Gepäckstück, Beutel oder Karton heraus. Ganz klar, hier baute sich Neandertal ein Nest. Eine Pygmäenfrau zeigte erstaunt zu mir herüber. Sie wunderte sich, daß wir über das gleiche lachten.
Der Abend verlief friedlich. Man hörte das monotone Nachtgeschrei der Zikaden. Felsfurch zündete die Butanlampe an, und ich kochte auf dem offenen Feuer Reis mit Thunfisch in Tomatensoße. Ich hatte das Gefühl, daß tausend Augen aus dem Dunkel des Dickichts in meinen Fischtopf starrten. Immerzu schrie, heulte, schmatzte, knackte es irgendwo, und ich nahm überall kleine gelbe Glühpunkte wahr.
»Julia, kann es sein, daß deine offene Fototasche noch drüben im Gebüsch liegt?« fragte Adalbert mich besorgt. »Ach, du liebe Zeit!« Mit Hilfe meiner Taschenlampe fand ich sie schließlich.
»Paß auf Treiberameisen auf oder die Magaponera. Die sind noch größer und gefährlicher. Sag sofort Bescheid, wenn du welche siehst, denn wenn sie erst mal das Lager angreifen, ist es zu spät. Sie kommen zu Tausenden und fressen, was nicht niet- und nagelfest ist. Sogar von Ästen lassen sie sich auf deinen Kopf fallen«, rief mir Nosbusch hinterher.
Entsetzen lähmte mich, wieso auf meinen Kopf? War denn hier kein Ort sicher? Wo konnte ich hin, um meine Angst zu vergessen? Sicher würden sich auch Schlangen in meinem Zelt verstecken, Vogelspinnen am Eingang lauern, Krabbeltiere die schützenden Wände fressen. Ich rannte zum Lagerplatz zurück, wo die anderen bereits entspannt um die Feuerstelle saßen und mit dem Essen begonnen hatten. Mir war der Appetit vergangen, ich hatte nur noch das dringende Bedürfnis, mich des Angstschweißes der letzten vier Stunden mitsamt aller zerquetschten Mückenteile zu entledigen.
Als hätte Felsfurch meine Gedanken erraten, erklärte er: »Für heute abend habe ich Wasser vom kleinen Fluß holen lassen, für jeden einen halben Eimer voll. Und zum Waschen ist ein kleiner Platz hier vorne freigeschlagen. Die Dusche werden wir morgen zimmern.« Sein blauer Blick fiel auf mich. »Die Toiletten befinden sich circa fünfzehn Meter hinter dem Lager, in östlicher Richtung.« Er hatte seine kurze Ansprache beendet, die Stimme gesenkt und signalisierte somit, daß er zu keinen weiteren Ausführungen bereit sei.
»Kann mir einer verraten, wo die ... ›östliche Richtung‹ liegt?« fragte ich kleinlaut.
Felsfurchs Gesicht verlängerte sich bis zu den Brustspitzen. Mit einem »Das darf doch nicht wahr sein!« verließ er die Runde.
»Na, entschuldigen Sie mal«, ich wurde jetzt böse, »ich habe nie behauptet, daß ich in einem Pfadfinderverein war, ich will einfach nur wissen, wo ich dieses verdammte Klo finden kann.«
»Mahlzeit«, kam es lakonisch von Adalbert.
Ich hatte die Nase voll, fand den halben Wassereimer, zog bis auf den Slip alles aus und begoß mich mit dem Wasser, wunderbar. Ich genierte mich überhaupt nicht vor den anderen, und überhaupt ... die Pygmäenfrauen waren auch bis auf das Lianenröckchen nackt.
Als ich mich dann im Zelt schlafklar gemacht hatte, kam das bittere Ende ... meine Blase drückte. Sollte ich etwa den langen, finsteren Pfad entlanggehen? Nein! Ich kniff alles zusammen, doch war an Einschlafen nicht zu denken. Ich mußte einfach zu dringend ... Schließlich drückte ich die Taschenlampe an mich und machte mich zaghaft auf den Weg. Eine dunkle Erscheinung rückte plötzlich in mein Blickfeld und machte verwegene Zeichen. Ein Vorzeiger! Er entpuppte sich als Nosbusch, der mir zuwinkte. Vorsichtig näherte ich mich ihm, man konnte nie wissen: die Jungs, so lange von zu Hause weg ...
Er grinste. »Trau dich, ich will dir nur etwas zeigen.«
Na, was hatte ich gesagt! Das alte Lied. Und wie wurde ich ihn jetzt los, ohne grob zu werden? Fieberhaft überlegte ich und suchte nach einer freundschaftlichen Lösung. Da winkte er wieder und deutete schräg hinter sich. Einen Schritt traute ich mich nun doch vor, und da sah ich einen schmalen Pfad. Kichernd flüsterte mir Nosbusch zu: »Das Ossi-Klo.« »Wie bitte, was?«
»Die Toilette ... im ›Osten‹.«
Langsam begriff ich und mußte lachen. »Ach Nossi, du bist ein Schatz.« Mit einem schwesterlichen Kuß verabschiedete ich mich und arbeitete mich tapfer voran. Dabei stierte ich mit beschwörendem Beiß-mich-nicht-Blick in die Finsternis. Dann aber wurde mir der Pinkelpfad zu lang. In letzter Minute bekam ich die Hose herunter, und schon prasselte ein lang anhaltender Sommerregen zu Boden, ergoß sich in einen Bach zu meinen Füßen und umschloß die Stiefel, in denen ich vor Pein erstarrte. Mit einem heftigen Hustenanfall versuchte ich das laute Geplätscher zu übertönen und mich dabei gleichzeitig etwas tiefer zu hocken, damit der Strahl nicht so aufplatschte, was zur Folge hatte, daß er mitsamt der Erde vom Boden zurückprallte und sich an meinen Waden wieder fing, langsam an ihnen entlangrieselte, um endlich in den Schuhen zur Ruhe zu kommen ... Und erlöse mich von dem Übel ...
Auch dieses Desaster wurde überwunden, und endlich lag ich auf meiner platten Luftmatratze. Meine erste Dschungelnacht ... aufregende fremde, entfernte und nahe Rufe, Schreie wie von Kindern, keckerndes Lachen, sehnsüchtiges Locken. Sachte verschmolzen die Schatten auf dem Zeltdach ineinander, und die großen, fingerartigen Blätter des Musangabaumes neigten sich herab.
3
Der nächste Morgen begann mit einer Überraschung. Es war so schweinekalt, als ich mich aus dem Zelt schälte und in den tropfnassen Urwaldmorgen kroch, daß ich mir alles überzog, was ich finden konnte. Trotzdem fror ich noch wie ein Schneider, denn die Sachen waren klamm und feucht. Grégoire, der von Sabango mit Lagerdiensten betraut war, brachte heißen Kaffee vom Lagerfeuer.
Aus dem »Waschgebüsch« begrüßte mich zwischen Zahnpastaschaum und Gurgellauten Adalbert. »Julia, wir haben gerade beschlossen, daß wir nachher zum Raffiapalmensumpf aufbrechen werden. Die Pygmäen und unsere Pisteure haben viele frische Elefantenspuren in dieser Richtung gesehen. Wenn wir in einer halben Stunde abziehen, könnten wir sie heute noch erreichen, bevor sie weiterziehen.«
Mir blieb der Kaffee im Halse stecken, war ich doch heute eher auf Ausruhen und das Versorgen von Wunden und Blasen eingestellt, aber die Jungs kannten wohl kein Erbarmen. Mir blieb kaum Zeit, meine Sachen zusammenzusuchen. Grégoire war bereits dabei, sich mit Taschen zu behängen, als ein klitzekleiner Sonnenstrahl aus einer Blätterluke weit über mir - Walhalla müßte da oben sein - direkt in meine Kaffeetasse fiel.
»Wir haben bestimmt fünf Stunden Marsch vor uns. Dafür können wir uns ja morgen ein bißchen ausruhen«, schlug Adalbert vor und nickte uns kurz zu. Eiligst machte ich mich an die Vorbereitungen. Vor allen Dingen wollte ich hier noch zur »Toilette«. Später, im verwucherten Urwald, mochte ich meinen Po nicht so gern in die Blätter halten.
Diesmal ging ich den Pinkelpfad bis zum Ende, bog die feuchten, tropfenbeladenen Zweige auseinander, versuchte mich durchzuschlängeln und ließ es hinter mir wieder zusammenschnellen.
Innerhalb von zehn Stunden war dieser Weg wieder mit diversen Schlingpflanzen zugewachsen. Wenn sie mich vorn nicht erwischten, streiften sie mich naßkalt an der Seite, und was mich unten nicht zu fassen bekam, packte mich am Kopf, legte sich quer wie glitschige Krakenfinger, und als ich mich von den Kletten löste, schlang sich mir Pelziges um den Hals. In panischer Angst riß ich an dem Grünzeug. Mein Hemd zerriß, doch war ich befreit. Nun konnte ich kaum noch an mich halten. Endlich tauchte der gefällte Baum auf. Jetzt sah ich erst, welche große Schneise er in den Wald geschlagen hatte und wie wunderbar er sich als Donnerbalken aus all den absterbenden Ästen und Lianen heraushob. Schon saß ich auf ihm und zielte in die darunter ausgehobene Grube. Uhhaahhh, da drinnen brummte und summte es schon. Genaueres wollte ich nicht sehen. Die Sonne erwärmte mich rundum, als der tosende Wasserfall auf das Gewusel herniederbrach und eine mittlere Dampfwolke zurückließ. Erlöst! Dankbar richtete sich mein Blick gen Himmel, erstarrte aber auf halber Höhe: Ein bebendes Netz, großzügig in der Breite eines Kutscherrades zwischen weitverzweigten Ästen gewebt und bis zur kleinsten Masche durchgehäkelt, erzitterte bei jedem fallenden Tautropfen, blieb jedoch straff gespannt. Ein harmlos spazierender Käfer näherte sich ihm und war auch schon gefangen. Festklebend strampelte er um sein Leben. Nun sah ich auch die dicke Wirtin. Lauernd schielte sie am anderen Ende in meine Richtung und bewegte sich leise wippend auf das Netz. Anhopsen ließ ich mich jedoch auf keinen Fall, schon gar nicht bei entblößtem Hinterteil. Doch genau dies schien sie im Sinne zu haben. Eiligst zog ich die Wäsche hoch und ließ die Spinne dabei nicht aus den Augen, sah ihre schwarzbehaarten, kräftigen Beine, den schillernden langen Körper ... Mir reichte es. Hastig duckte ich mich unter ihr weg, zum gefällten Baum, durch die Krakenarme und endlich ins Lager. Uff!
Felsfurch hielt bereits hof. Kurz warf er einen irritierten Blick auf mein zerrissenes Shirt und die wirren Haare. »Wir haben ab heute einen neuen Pisteur, Mungo, erster Jäger der Pygmäen. Alle, die hier für uns arbeiten, werden auch bezahlt. Mit dem Geld können sie sich Macheten oder Messer bei den Bantu kaufen. Die Verwaltung dieser Bezahlung wäre Frauenarbeit.« Ich glaube, er hatte noch nie meinen Namen ausgesprochen, wohl aus Angst, daß es zu persönlich würde. »Frauenarbeit« bedeutete natürlich »Julias Aufgabe«.
Um 7 Uhr 30 brachen wir auf, wobei ich gleich versuchte, in die Mitte des Zuges zu kommen, Grégoire vor mir, Nossi mit dem Schmetterlingskescher hinter mir. Insgesamt waren wir sieben, alle bepackt und die Pygmäen zusätzlich mit Armbrust und Speeren ausgerüstet. Felsfurchs Stimme dröhnte irgendwo aus dem Wald. Anscheinend marschierte er schon weiter vorn. Mungo, dem ich noch schnell meinen Rucksack aufgehängt hatte, arbeitete an der Spitze und schlug mit der Machete einen Weg in das Dickicht. Auch hier hatten wir gestern erst eine Schneise geschlagen, doch war sie wieder so zugewachsen, als hätte es uns nie gegeben. Beängstigend.
Wir kamen gut voran. Weit entfernt wiederholte sich ständig ein trauriger, hohl klingender Vogelruf, unterbrochen von frechem Meckern. Das schrille Gekreisch von Affen verstummte, als wir uns ihnen näherten, und Mungo machte uns Zeichen stehenzubleiben. Mit leuchtenden Augen deutete er nach vorn und besprach sich mit Sabango. Es wurde uns übersetzt, daß da eine Schimpansengruppe unterwegs sei und er leider nicht die richtigen Pfeile bei sich hatte. War ich froh über dieses Mißgeschick! Vorsichtshalber aber hustete ich laut los, denn vielleicht hatte ja Grégoire etwas Passendes dabei und sie erlegten doch noch einen Affen. Prompt erntete ich mißtrauische Blicke, aber die Affenhorde sprang eilig davon. Froh sah ich ihren rötlich-weißen Silhouetten nach. Zur Strafe - wie mir schien - griff ich gleich darauf in einen langen Dornenast, der meine Finger unverzüglich mit gelben Pusteln überzog, was höllisch brannte.
Überall lauerten hier unbekannte Gefahren, und ausgerechnet ich mußte in alle hineintappen. Für einen Jodtupfer konnte ich jetzt nicht anhalten, denn die Gruppe wäre sicher wieder ohne mich weitergezogen. Da machte mich Nosbusch auch schon auf einen Schwarm türkisblauer Schmetterlinge aufmerksam, die auf Katzenurin saßen und heftig auf der Stelle flatterten. Er erklärte, daß sie in solch starken Ansammlungen äußerst gestreßt seien und durch Flügelschlagen versuchten, den Nachbarn zu bedrohen. Bosso, ein anderer Träger, der plötzlich aus dem Nichts auftauchte, zeigte uns den Kot einer Goldkatze, die während ihrer nächtlichen Tour wohl auch hier uriniert hatte. »Nd.ouk.ou, ja bot’e.«
Sabango übersetzte: »Goldkatze, komm her.«
Da ich ständig den Blick streng auf jede Art von Ameisenbewegung gerichtet hielt, entging mir nicht, daß da gerade ein satter schwarzer Strang entlangzog. Nur knapp davor kam ich zum Stehen und suchte Anfang oder Ende dieses langen Schlauches. Bosso hatte mich beobachtet und wies in eine Richtung, in der ich gar nichts vermutete. Ungläubig sah ich hinüber. So ein langer Zug? Bosso lachte und nickte bekräftigend. Er hatte gemerkt, daß ich ihm nicht glaubte. Ein netter Bursche, aber ziemlich häßlich mit seiner breiten Nase.
Er war mir schon im Lager mit seiner aparten, sehr selbstbewußten Frau aufgefallen. Von Anfang an hatte ich den selbstverständlichen Stolz der Pygmäenfrauen bewundert. Das Laub wurde langsam durchsichtiger, und die Hitze nahm dermaßen zu, daß mir der Schweiß in Bächen am Körper entlangrann, durch Furchen und Spalten bis in die Stiefel. Das Shirt klebte an mir, und Mücken stachen bestialisch durch den feuchten Stoff. Eine kleine unregelmäßige Lichtung tat sich auf. Im Näherkommen entdeckte ich drei zusammengefallene Laubhütten. Neugierig bog ich die alten Blätter zurück, um Entdeckerin eines grauslichen Fundes oder außergewöhnlichen Schatzes zu werden.
Felsfurch ernüchterte mich: »Bleibt bloß nicht zu lange auf demselben Platz, und kommt den Hütten nicht zu nahe!« Erschrocken sprang ich sofort in den Wald zurück, doch da war es ja auch nicht sicherer. Wie ein ausgesetzter Hund suchte ich nach einem heimeligen Plätzchen, und schon hörte ich auch Herrchens Stimme wieder: »Die verlassenen Lager wimmeln von hungrigen Flöhen und Zecken, die sich auf alles stürzen, was sich bewegt.«
Während Nosbusch sich beiläufig die Hosenbeine ausschüttelte, bemerkte er interessiert: »Da schau her!« Sein blasser Zeigefinger deutete auf eine zitronenfarbige Schmetterlingsansammlung, die sich auf der Weggabelung ausgebreitet hatte. »Aus der Gruppe der Hartflüglercharaxes«, fügte er erläuternd hinzu.
»Dachte ich mir’s doch«, feixte ich leise. Diese Wissenschaftler vergaßen alles andere um sich herum. »Wunderschön, und habt ihr auch den kleinen Roten gesehen?« hörte ich nun den entzückten Adalbert, während Nossi bereits den Kescher ausgezogen hatte. Faltermörder vom Linzer See! Als der tänzelnde, bärenhafte Nosbusch jetzt jedoch seine Fänge ausstreckte und mit tolpatschigen Bewegungen hinter dem kleinen Roten herjagte, dabei zierlich die großen Füße auf den Zehenspitzen balancierte und zu einer seitlich versetzten Pirouette anhob, sah ich, wie Mungo die Hände vor das Gesicht schlug und in die Knie ging. Als er gleich noch einmal zurückschielte, liefen ihm die Tränen über die Wangen. Ungläubig sah er zu mir, merkte, wie ich mühsam gegen ein Lachen kämpfte, und brach nun völlig zusammen. Inzwischen war Nosbusch in einer Liane hängengeblieben und fluchte hinter dem roten Flieger her, der bereits in sicherem Abstand eine Ehrenrunde drehte. Mut Mut, diese fiesen kleinen Bienen, krochen mir wieder in Nasenlöcher und Ohren, ich fühlte mich rundherum unwohl. Weit vorn erklärte Sabango etwas, indem er auf eine mehrfarbige Liane zeigte. Nosbusch klärte mich auf (hätte ich bloß nicht gefragt):«Er hat dort gerade eine Viper gesehen, die von einer Liane kaum zu unterscheiden war, und erklärt, daß sie außerdem sehr gefährlich sei.«
»Was meint er mit ›sehr gefährliche« fragte ich leicht gereizt.
»Na, ziemlich tödlich, wenn sie beißt. Hier wird es sehr sumpfig, und das ist ihr bevorzugter Lebensraum.«
Wie ich den Laden hier kannte, hing sie jetzt wahrscheinlich genau über mir. Warum konnte ich mich nicht auch an so einem dusseligen Schmetterling ergötzen, so daß ich alles andere vergaß? Ich war so in Gedanken, daß ich auf Grégoire auflief, der plötzlich stehengeblieben war. Alle waren stehengeblieben und hatten beschlossen, Mittag zu machen. Bonne idée.
»Werft bloß keine Büchsen hier herum.« Natürlich, das Ekel vom Dienst, hatte ich ganz vergessen. Strafend sah ich zu ihm hinüber. Als ob wir hier irgendwelche Reste wegwerfen würden. Ich teilte meine Ölsardinen mit Sabango, und schon ging es weiter.
Bald dachte ich an nichts anderes mehr als daran, wie ich hier wieder heil herauskäme. Es war das dichteste Lianengewirr, das wir jemals erleben sollten. Der Dschungel war so zugewachsen, daß hier mit Sicherheit noch kein menschliches Wesen vor uns durchgekommen war. Auch Mungo und Bosso hatten vorn Schwierigkeiten. Sie fanden kaum Platz, um die Macheten zu schwingen und das Unterholz zu lichten. Ich konnte mich nur hockend vorwärts bewegen, kroch mehr, als daß ich lief, blieb ständig in Ästen hängen oder rutschte auf den feuchten, knorrigen Wurzeln aus. Hier wuchsen Lianen in Leibesdicke, eine um die andere geschlungen, unendlich lange Arme, die sich den Weg in das Licht suchten, und weiße, keimende Sprossen, die ihnen aus der stickigen Feuchtigkeit hinterher rankten.
Plötzlich rutschte ich quer in eine Wurzelverzweigung. Mein Fuß hatte sich dabei so schmerzhaft verdreht, daß ich nicht wußte, wie ich ihn heraus bekommen sollte. Grégoire versuchte zu helfen, doch da rutschte ich bis zur Wade tiefer hinein. Vor Schmerz stieß ich den Atem pfeifend aus. Schließlich hielt der Zug, und die anderen halfen, mich zu befreien. Adalbert, der Lange, robbte auf allen vieren aus dem Unterholz, und ich mußte bei dem Anblick trotz der Schmerzen lachen. Nossi legte den inzwischen völlig zerlöcherten Kescher ab und zersägte die Wurzel mit einem Sägedraht, den er aus seinem raffinierten Taschenmesser zog. Endlich kam ich frei. Mein Fuß wies mindestens vierzig Grad gen Osten ... oder war es Westen ...? Jedenfalls tat er, als sei er so auf die Welt gekommen. Vorsichtig bogen wir ihn zurück. Verdammt, war das qualvoll! Nossi legte noch eine schlammige Bandage an, und dann versuchte ich vorwärts zu humpeln. Mein Traum war natürlich, von starken Armen in das Camp zurückgetragen zu werden. Statt dessen fiel mein Blick auf Felsfurch, der grimmig durch die Blätter sah. »Können wir bald weiter, oder hat sich jemand was gebrochen?«
»Nein, noch nicht«, antwortete ich patzig, warum mußte er nur immer so garstig sein, und immer zu mir? Bei den Männern traute er sich nie, so zu meckern.
»Geht’s wieder ein bißchen, Julia?« erkundigte sich Adalbert immer noch flach hockend, anscheinend kam er nicht mehr hoch.
»Wunderbar, besser als je zuvor«, stöhnte ich zwischen zusammengebissenen Zähnen. »Ist es denn noch weit?« Sabango erkundigte sich bei Mungo. »Nein, er meint, wir sind ziemlich nahe.«
Hätte ich geahnt, was mich nun erwartete, hätte ich nie das Camp verlassen. Schweigend ging es weiter. Die vorderen Stimmen wurden immer leiser, meine Verletzung war vergessen, und schließlich bildete ich durch meine Humpelei mal wieder das Schlußlicht. Es war wirklich zum Heulen, noch dazu schienen wir jetzt in die Ursuppe aller Sumpfgebiete zu kommen. Die Fußspuren meiner Vordermänner hatten sich bereits mit Wasser gefüllt, und ich sank bei jedem Schritt tiefer in den grünen Morast. Ich hatte panische Angst und mußte ständig an die Vipern denken, da sah ich auch schon das schuppige Hinterteil eines Warans im Schlamm verschwinden. Noch einmal wand er sich mit einer peitschenden Bewegung, bevor er verschwand. Verdammt! Wohin war er abgetaucht? In panischer Hast versuchte ich aufzuholen. Moskitos zerstachen mich an Hals und Unterarmen, und langsam mischte sich Zorn in meine Furcht. Wie ich sie haßte, diese ständige Angst! Eigentlich war ich doch gar kein Angsthase. Aber hier, wo ständig etwas lauerte, in raffinierte Tarnfarben gehüllt, unbeweglich und zu tödlichem Biß bereit, waren anscheinend alle meine mutigen Zellen zu Hasenschiß mutiert.
Endlich sah ich die anderen wieder, sie standen am Rande eines ekligen Baches, den ich schon vom Ansehen her verdammte. Matschig, schlammig, mit surrenden Insekten, die in zuckenden Bewegungen über dem Schlick standen.
Mungo rief mir etwas zu, während er das Ufer beobachtete: »Lo ’ke wa, ng’o.«
Sabango übersetzte: »Hier gibt es viele Warane, ihr müßt sehr aufpassen.«
»Merci, ich habe schon einen gesehen, fast so groß wie ein Krokodil.« Verdammt noch mal, wieso denn nun gleich viele! Mir hatte der eine schon gereicht. Ich hatte solchen Schiß, daß es mir Mühe machte, nicht loszuheulen. Statt dessen schrie ich alle Angst hinaus: »Warum sagt mir denn keiner vorher, daß es hier Krokodile gibt! Ihr wißt genau, daß ich eine Höllenangst habe. Hier gehe ich keinen Schritt weiter. Euch ist das alles völlig egal, weil ihr rücksichtslos seid!« Nun heulte ich doch. Ich stand wie gelähmt und wußte nicht mehr, wo ich hintreten oder -fassen konnte. Mungo und Felsfurch waren bereits im Wasser und bewegten sich vorsichtig flußaufwärts. Auch Adalbert beobachtete besorgt die kleinen, tanzenden Wasserblasen, die sich zum Teil zu größer werdenden Ringen schlossen. Wir standen im Morast und sackten von Minute zu Minute tiefer ein.
»Ich werde hier mit Grégoire auf euch warten. Auf gar keinen Fall gehe ich durch dieses Wasser«, rief ich Nosbusch zu, der bereits in der leichten Strömung stand.
»Sie sollten lieber mit uns kommen, denn wir kehren hierher nicht zurück, und der Bach ist der kürzeste Weg«, war Felsfurchs Kommentar zu meinem Ausbruch.
Nun sah ich, daß er die Schuhe um den Hals hängen hatte. Sollte ich sie etwa auch ausziehen? Nosbusch wartete auf mich. »Hier in der Mitte ist ganz klares Wasser, Julia, komm.«
»Du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Angst ich habe! « rief ich ihm verzweifelt zu. »Wie soll ich denn durch den Schlick kommen, ich kann doch nicht ohne Schuhe ... « Da hieb Grégoire direkt neben mir einen Ast mit voller Wucht auf den Boden und schlug immer wieder und wieder darauf ein. Ich sah, wie sich ein dicker, dunkler Schlangenleib aufbäumte, und war mit zwei Sätzen in der Bachmitte und hetzte weiter. Alles Unheil dieser Welt an den Fersen, sah ich nur noch rote Kreise und hörte mein Blut in den Ohren rauschen.
Grégoire schrie hinter mir: »Nouna m’bi machette, yo, yo!« Seine Schreie wurden immer lauter. Blind und taub spurtete ich mit großen Sätzen durch das aufspritzende Wasser, bloß weg! »Hilfe! « Eine feste Hand packte mich. Nosbusch hatte sich meiner angenommen, ahnte vielleicht meine innere Katastrophe.
Im gleichen Augenblick schrie Grégoire wieder auf und erstarrte dann plötzlich. Weit vorn warf Mungo das Gepäck ab und stürmte in langen Sprüngen zu Grégoire, holte mit der Machete wuchtig aus und hieb noch im Sprung der Schlange den Kopf ab. Grégoire atmete tief aus, Leben durchflutete ihn wieder.
Auch ich atmete wieder und merkte jetzt, daß mein Fuß höllisch schmerzte. Doch trotz allen Unheils war ich froh, denn wir hatten verdammtes Glück gehabt, Grégoire und ich. »Merci, Grégoire, du hast mir das Leben gerettet.« Dankbar umarmte ich ihn und schenkte ihm meine letzte Ölsardinenbüchse. Erleichtertes Lachen machte sich breit und erschöpft rasteten wir an einer kleinen Lichtung. Ich war heilfroh, daß auch den anderen der Schreck in die Glieder gefahren war. Meine Fototasche war zwar naß geworden, aber die Kameras waren zum Glück trocken geblieben, und so schoß ich gleich eine Fotoserie. Das regte mich ab und tat mir gut.
Felsfurchs Ausrüstung lag im Wasser und war völlig durchgeweicht. »So ein Scheißdreck«, fluchte er mit einem giftigen Blick zu Mungo. »Warum muß er es denn auch ins Wasser werfen!«
Nun emporte sich Nosbusch endlich einmal. »Hätte er lieber Zusehen sollen, wie Grégoire von der Schlange gebissen wird?« Vor Wut hatte er eine weiße Nasenspitze bekommen, und mir fiel auf, daß er seinen Schmetterlingskescher nicht mehr hatte, aber danach wollte ich jetzt lieber nicht fragen.
»Gehen wir ins Lager zurück, wir haben zuviel Zeit verloren und müssen sehen, daß wir die Kameras retten«, schlug Adalbert vor, und keiner widersprach.
Schweigend machten wir uns auf den Rückweg. Ich glaubte, ich wäre nun in Sicherheit, als plötzlich Mungo abrupt vor mir stoppte, mich festhielt und seitwärts zeigte. Ich erblickte, zum Greifen nahe, eine Grüne Mamba, die sich zufrieden sonnte. Schreck und Faszination fesselten mich zugleich, als sich die Mamba aufrichtete, uns ansah und verharrte. Dann entschloß sie sich zu einem langsamen Rückzug nach oben durch die Blätter.
»Mon Dieu«, entfuhr es Sabango hinter mir, und da kam auch schon Adalbert, doch zu spät, die Schlange war weg. »Ist das schade, so nah habe ich noch keine gesehen. War sie schön, Julia?« fragte er mich ernsthaft.
»Noch nie habe ich etwas Schöneres gesehen, mein lieber Adalbert.« Ich hatte zwar meine Sprache wiedergefunden, aber dafür waren mir die Knie weich geworden. Ich hielt mich an einem Ast fest, von dem sich eine Raupe an einem blassen Faden zu mir hinabbaumeln ließ. Ehe ich sie näher betrachten konnte, stupste Adalbert sie mitsamt Faden heftig zur Seite. »Sehr, sehr giftig.«
» O verdammt, warum kommen sie nur alle zu mir? « rief ich fassungslos aus. Lächelnd versuchte Grégoire mich zu beruhigen: »Gleich sind wir im Lager.«
4
In den folgenden zwei Wochen lernte ich viel dazu. Sabango erzählte mir die außerordentlichsten Geschichten über Pygmäen und klärte mich in einfachen Gleichnissen über den Urwald und seine Bewohner auf. Wir machten einige kleinere Expeditionen und studierten das Jäger- und Sammlerschema unserer Aka-Gruppe, das verschiedenen Zeiten folgte. Der Beginn der Trockensaison war bei ihnen Honigzeit. Die Bienen verließen ihre Nester, weil nun ihre speziellen Bäume zu blühen begannen. Dann folgte die Regenzeit, in der die Aka dreifach ernten, anfangs die Raupen, dann die Früchte und schließlich die Knollen und Wurzeln. Letztere konnten sie auf Vorrat eingraben bis zum nächsten großen Regen.
Ich führte täglich Protokoll über diese Aktivitäten und belegte es mit Zeichnungen. Außerdem kümmerte ich mich um das Wohlbefinden der Pygmäensippe, die ja unseretwegen hier seßhaft wurde, anstatt nomadisierend die Reviere zu wechseln. Unser kleines Dorf hatte nun auch einen Namen. Es hieß Ibengue Mbounsola, »am Ende des Flusses«. Adalbert wies mich auf die praktischen, alltäglichen Aspekte hin, die er bereits von anderen Naturstämmen kannte, wie die Hütte für geschlechtsreife Mädchen, die sich dort meist zu dritt einrichten.
»Außerdem ist es eine gut durchdachte Bauweise«, erläuterte er mir weiter, »da siehst du, wie das Zweiggerippe mit Blättern belegt wird.« Er zeigte auf die kleine süße Esakola und Mokoma, die beiden jüngsten Töchter von Majeke, die gerade an ihrer Mädchenhütte arbeiteten. Esakola knickte den oberen Teil eines Blattes mit Stiel nach innen, Mokoma hängte es dann in die unterste Querstange des Gerüstes ein, dann das nächste daneben und das folgende darüber, so daß die Blätter dicht überlappten. Ein Regenguß würde so an den Blättern entlangfließen. Als die Mädchen merkten, daß ich sie beobachtete, versteckten sie sich kichernd hinter dem hoch aufgetürmten Blätterhaufen.
Andere Pygmäen kamen von weit her zu Besuch, doch wurde ich nie so vertraut mit ihnen wie mit »meinen«, die ich täglich sah und die mich langsam in ihr Leben einbezogen. Allmählich freundeten wir uns an und lernten uns näher kennen. Ich war begeistert von den kleinen Frauen, die mit ihren viereckigen Körpern, langen Fladenbrüsten und den abstehenden Faserröckchen sehr eigentümlich aussahen. Sie hatten hier im Lager das Sagen, und wenn sie nach ihren Kindern schrien, rannten alle los, um sie zu suchen. Überhaupt drehte sich das ganze Leben um die Kinder, die mit viel Zärtlichkeit bedacht wurden. Männer tanzten innig versunken mit ihrem Säugling auf den Armen und summten monotone Lieder dazu. Große Geschwister schaukelten die Kleineren in schwindelnd hohen Lianenkonstruktionen, sangen dabei das traurige Lied von Tole, dem Bösen, und seiner guten Schwester, die im Himmel war. Es endete mit dem schrillen Refrain ma dende ja und hatte ungefähr sechzig Strophen.
Ich schrieb alles auf, was ich erlebte und in Erfahrung bringen konnte. So erfuhr ich von Maseke und dem alten Bole, daß sich die Welt der Aka in zwei fundamentale Bereiche aufteilt, den Himmel und die Erde. Dazwischen lebt der Sturm. Im Himmel, zwischen Sonne und Mond, lebt Ko’mba, ihr Gott. Ich schrieb und schrieb: über ihre Geschichte, ihre Mythen, ihr soziales Gefüge, ihre Ängste, ihre cri cris und Geister und über die Kunst des Heilens mit den immensen Schätzen des Urwaldes.
Wenn irgendwo ein Leid geschah, teilten es alle in der Sippe miteinander. Ansonsten war dies eine Gesellschaft, die sich intensiver Muße hingab. Soziale Körperpflege wurde hier ganz groß geschrieben. Man lauste sich, hintereinander in einer Reihe hockend, immer der Hintere den Vorderen. Bis zu sieben Personen wurden so bearbeitet. Zur Belohnung gab es dann die Laus, die genüßlich zwischen den Zähnen geknackt und gegessen wurde.
Am dreizehnten Tag der Expedition, den ich nun schon überlebt hatte, saßen wir abends alle beim Tee zusammen und besprachen unser Programm. Den ganzen Tag lang waren die dumpfen Tamtams zu hören gewesen. Für den nächsten Tag wurde viel Pygmäenbesuch erwartet, von Verwandten, die weiter unten bei Be’ranzoko ihr Revier hatten. Am Tag darauf wollten wir uns noch einmal auf den langen Marsch zum Raffiapalmenwald machen, denn Mungo hatte wieder Elefantenspuren in dieser Richtung gesichtet. Ich war sehr aufgeregt und leider immer noch sehr ängstlich nach dem letzten Sumpfabenteuer. Mein Fuß war gerade erst geheilt. Zudem hatte ich weitere Konfrontationen mit Vipern gehabt, die meine Furcht schürten. Ich sah die Biester in ihrer perfekten Tarnung einfach nicht und war einmal nur knapp einem fatalen Biß entkommen.
Während ich den Kochtopf für das Abendessen bereitstellte, fragte ich in die Runde: »Was soll ich denn heute kochen?« »Reis und Büchsenfleisch«, erklang es einstimmig.
»Wo ist eigentlich das Wasser?« wollte ich noch wissen. »Wo ist eigentlich das Wasser!« äffte mich eine Stimme nach, »wenn man bei euch nicht an alles denken würde, würdet ihr dumm aus der Wäsche schauen.« Felsfurch warf einen vollen Wasserkanister neben meinen Kochtopf. Erschrocken sprang ich zur Seite. »Was ist denn das für ein Ton?« fauchte ich zurück.
Adalbert drehte sich zu Felsfurch: »Laß es gut sein, wir sind alle ein bißchen müde und nicht so fit wie du.« Mit dem schokoladensüßen Lächeln einer Sachertorte winkte er Felsfurch an den Tisch.
Auch das noch, sollte das Ekel bloß im Dunkeln bleiben! Ich öffnete Büchsen, vermischte deren Inhalt mit Tütensoße, füllte alles mit Wasser auf und stellte es ins Lagerfeuer, daneben einen kleinen Topf mit dem Reis. Dann verschwand ich eilig zum Örtchen. Vorsichtig stelzte ich ins Gebüsch und hoffte, daß mich die anderen nicht hörten, weil es so dicht am Lager war. Der Weg zum Klo war mir nachts einfach ein Greuel, lieber riskierte ich wieder den Strahl in die Stiefel. Auf dem Rückweg hörte ich schon die nörgelnde Stimme:
»Wie lange muß man hier eigentlich auf das verdammte Essen warten?«
Ich wurde wütend. »Na, hören Sie mal, Sie haben doch gesehen, daß ich es eben erst aufgesetzt habe. Was soll das denn?«
»Wenigstens den Reis hätten Sie schon fertig machen können«, schnauzte er weiter und wartete stur wie ein Pascha am Tisch, während Nosbusch die Teller deckte.
Ich knallte den glühenden Fleischtopf auf den Tisch. Felsfurch richtete sich erschrocken auf und sah mich böse an. »Außerdem haben Sie heute Küchendienst«, wetterte ich los. Ich wollte mir nichts mehr von diesem unzumutbaren Menschen gefallen lassen, der täglich die Lagerstimmung vergiftete. Adalbert schlichtete wieder und reichte den Topf herum, während Nossi den Reis brachte. Doch auch Nossi warf Felsfurch böse Blicke zu, der jetzt schmatzend das Essen in sich hineinschlürfte. Gleich den ersten Bissen spuckte er wieder auf den Teller zurück. »Verdammt, ist das heiß!« Dabei sah er vorwurfsvoll in meine Richtung.
Gereizt mischte sich Nossi ein: »Jetzt iß mal wie wir alle und sei zufrieden, jeder gibt sich hier Mühe.«
Felsfurch lief rot an. »Was heißt denn hier ›Mühe‹, das ist doch nicht genug, hier im Urwald. Ihr müßt mal endlich kochen, was ich euch anschaffe, sonst haue ich ab.«
Betreten sahen sich Nosbusch und Adalbert an, während Felsfurch aufsprang und den Tisch verließ.
»Wie könnt ihr euch das bloß immer bieten lassen? Wir machen doch alles bestens. Wenn sich der Affe das Maul verbrennt, ist das natürlich auch noch unsere Schuld, meine vielmehr!«
Adalbert sah besorgt von einem zum anderen. »Leider sind wir auf ihn angewiesen, sonst würde ich euch das nicht länger zumuten. Ihr müßt euch bitte noch zusammennehmen. «
»Entschuldige, aber ich halte das nicht mehr durch, ich bekomme immer das meiste ab, und mich stört es mehr als euch«, wandte ich ein.
Mir war der Appetit gründlich vergangen, außerdem waren meine Füße wieder taub geworden. So zog ich mich in mein Zelt zurück, begleitet von einem dicken Hüpfer, der mit tiefem »Sssumm« auf meinem Dutt notgelandet war und nun einen satten Klaps auf seinen Panzer bekam, so daß er wieder beim Suppentopf landete.
Etwas später kam Adalbert noch einmal zu meinem Zelt und versuchte, sich zur Hälfte hineinzubücken, wie eine Giraffe mit einem zehn Meter langen, herabgeneigten Hals. Väterlich nickte er mir zu. »Es wird sich schon alles arrangieren, Julia, es muß sich halt noch einspielen.« Plötzlich war er rot angelaufen, da ihm das Blut in den gesenkten Kopf lief. Gequält sah er mich an, und ich bekam Angst, daß er platzen würde ... in meinem Zelt.
»Ist schon gut, lieber Hofrat, ich habe mich fast wieder im Griff. Also, bis morgen.« Ich wollte ihn keineswegs beunruhigen, auch wenn mir die Konflikte bis zum Hals standen und ich nichts mehr verabscheute als die andauernde Mißstimmung.
»Bist ein guter Kumpel, Julia, bis morgen.« Damit verschwand er zu seinem Zelt.
Am nächsten Tag gingen die Männer zur Papageien-Saline. Ich wollte dies ein anderes Mal allein tun, um in Ruhe Fotos zu machen und nicht ständig irgendwo hinterherzuhecheln. Also blieb ich im Camp und bekam eine Kostprobe des ausgeprägten Humors meiner kleinen Freunde, der dem meinen sehr ähnlich war.
Sabango hatte um mein kleines Zelt eine Hütte bauen lassen, die genauso wie die der Pygmäen war. Dadurch verfügte ich über weitere Ablagefläche. Auch besaß ich nun einen kleinen Tisch mit Bank. Dort interviewte ich häufig Maseke und setzte gleichzeitig meine Aufzeichnungen fort, so auch heute. Mungo und Mada saßen mit ihren Kindern in einiger Entfernung und beobachteten mich freundlich wie immer. Boleba, die alte, zauberhafte Frau von Bole kam hinzu, auch Bosso erschien plötzlich, und dann tauchte noch Esakola auf, die ich gern in meiner Nähe hatte. Sie zierte sich so süß, wenn ich ihr etwas schenkte. Mokoma, ihre kleine Freundin, kam nach, dann noch Mussala, Majekes älteste Tochter, die mir durch ihren starken Schnurrbart auffiel. Etwas später erschien Bole mit noch ein paar Männern und setzte sich ebenfalls zu den anderen. Noch dachte ich mir nichts dabei, denn so saßen sie öfter abends beisammen. Dann rauchten sie gemütlich und sahen uns zu. Manchmal wunderten sie sich, daß wir Krümel aus der Tüte aßen, anstatt fette weiße Raupen zu braten, oder auch daß wir mit rosa Rollen in den Wald verschwanden.
Gerade hatte ich meine Eintragungen beendet und war dabei, in der Hütte den Reißverschluß meines Zeltes aufzuziehen, um darin meine Sachen zu verstauen. Wie immer wollte ich mit einem Satz hineinspringen und in fliegender Umdrehung den Reißverschluß hinter mir sofort wieder hochziehen, damit mir kein Kriech- oder Flugtier folgte. Heute aber kam es nicht soweit, denn hinten in der Hütte sah ich plötzlich die schuppige Haut einer langen, graugefleckten Schlange. Mit dem schrillsten Schrei meines Lebens schoß ich postwendend wieder zurück durch die Tür.
» Un serpent!« schrie ich den Pygmäen zu, während ich hart auf dem Po landete und in affenartiger Geschwindigkeit weiter robbte. »Hilfe!« Entsetzt hielt ich den Eingang im Auge. »HIILFFE!«
Ich wunderte mich, daß niemand half. Sonst kam immer jemand, egal in welcher Sprache ich schrie. Ich sah mich um. Da saßen, ordentlich nebeneinander, wie im Kino in der ersten Reihe, alle Pygmäen und hielten sich den Bauch vor Lachen. Maseke krächzte vor Vergnügen und schlug sich ständig auf die Schenkel, und die Kinder tanzten übermütig auf der Stelle. Mada hielt sich die Hand vor den Mund und biß sich fast in die Finger, so sehr lachte sie.
Das konnte doch nicht sein, daß meine Angst sie so amüsierte! Ungläubig sah ich wieder zum Zelt, doch die Schlange kam nicht heraus. Ich entspannte mich ein wenig und sah nun, wie Mungo, der sich vor Lachen schüttelte und dabei immer wieder verstohlen zu mir herübersah, in mein Zelt ging. Ich fand ihn sehr mutig. Gebannt starrte ich auf den Eingang, als er mit der Schlange zwischen den Fingern wieder zum Vorschein kam. Das Biest war an einer Lianenkordel befestigt. Erneut fuhr mir der Schreck durch alle Glieder, und ich fand mich in der nächsten Sekunde neben Maseke wieder. Unbewußt hatte ich wohl bei ihm Schutz gesucht, und nun blickten wir uns erstaunt in die Augen. Da schob sich langsam ein Schlangenschwanz zwischen uns, und laut schreiend stob ich zur Feuerstelle, wo ich notfalls ein Scheit ergreifen konnte.
Allmählich aber erfaßte ich die Situation: Ich sah, wie sich Mungo seelenruhig den Schlangenkopf an die Nase hielt. Nun begriff ich endlich, daß die Schlange tot war, wohl von Anfang an schon. Jetzt dämmerte es mir: ein organisierter kleiner Scherz. Wahnsinnig komisch.
»Schweinebande. Das darf doch nicht wahr sein!« Wütend stürzte ich mich auf Mungo, der nun wie der Blitz im Dschungel verschwand. Ein wenig schämte ich mich ja, aber nach und nach mußte ich doch lachen, bis ich mich mit einem schallenden Gelächter von dem Schreck befreite. Dieser Streich wurde der Anfang einer echten Freundschaft zwischen mir und dieser kleinen Bande. Auf einmal waren sie mir vertraut: In den Grundzügen waren wir gleich veranlagt. Trotzdem schwor ich Mungo schlimme Rache, und alle nickten begeistert. Wir freuten uns gemeinsam und legten zum Zeichen der Verschwörung den Zeigefinger auf die geschlossenen Lippen. Am liebsten hätte ich sie alle umarmt, so freute ich mich über die geteilten Gefühle – so menschlich, so schadenfroh, so albern.
Am nächsten Tag wurde ich Zeugin einer schlimmen Prozedur, die an »meiner« kleinen Esakola vorgenommen wurde. Sie hatte morgens eine frische Tätowierung auf die Brust bekommen und lag nun leise winselnd auf meinem Schoß. Auf den Wangen waren noch helle Spuren ihrer Tränen zu sehen.
Diese Prozedur war so schmerzhaft gewesen, daß das kleine Mädchen sich ständig aufbäumte und von seiner Tante festgehalten werden mußte. Es hatte mich viel Überwindung gekostet, nicht einzugreifen, denn Esakolas Schluchzen erbarmte mich sehr. Aber schließlich hielt sie tapfer still, damit die Einkerbungen des Bambusmessers gut gelangen. Bosso hielt das Messer mit beiden Händen umschlossen und schlitzte langsam die blutigen Spuren in die zarte Haut: zwei Reihen Dreiecke mit kleinen Pünktchen. Als er mittags endlieh fertig war, schluchzte Esakola noch einmal tief, und auch die Umstehenden atmeten erleichtert auf. Es wurde noch Asche in die frischen Wunden gestreut, was der glatten Vernarbung dienen sollte. Ich streichelte der Kleinen tröstend über die Wange, und Mada pustete ihr vorsichtig die restliche Asche von der Haut.
Der Abend verlief gemütlich, abgesehen davon, daß sich Felsfurch wie so oft mal wieder vor dem Küchendienst drückte. Er machte, was er wollte, verlangte aber von uns eiserne Disziplin. Ich war ziemlich sauer, aber schließlich opferte ich mich doch. In der Dunkelheit untersuchte ich auf dem Weg zu dem Gestell mit dem Wassereimer bei jedem Schritt den Boden, damit mich nichts beißen konnte. An der hell flackernden Feuerstelle angekommen, spülte ich dann erleichtert unsere Teller, schüttete das restliche Wasser darüber und ließ sie im Regal abtropfen. Adalbert putzte sich etwas abseits gerade die Zähne, prustend, schnaubend und spuckend. Zwischen Zahnpasta und Bürste grinste er mich an. Ich lachte zurück. Er hatte immer so etwas liebenswert Altmodisches an sich, war stets bemüht, Haltung und Freundlichkeit zu bewahren. Er erinnerte mich an Edelmänner, Ritter hoch zu Roß ... doch sein österreichischer Dialekt brachte ihn leider stets auf den Boden eines einfachen Infanteristen zurück.
Gerade stellte ich mit lautem Scheppern die letzten Gläser in den Blecheimer, als ein markerschütternder Schrei durch das Gebüsch gellte. Der Eimer stürzte um, und die Gläser klirrten durcheinander. Adalbert fiel vor Entsetzen das Zahnputzglas aus der Hand, und Nosbusch kam von irgendwoher angerannt.
»Ist dir etwas passiert?« fragte er mich besorgt.
»Wieso denn mir?« gab ich entnervt zurück.
»Na, ich dachte, weil es so gekreischt hat.«
»Unverschämt! Nein, mich hat einer von da oben furchtbar angeschrien, als ich die Gläser so laut in den Eimer stellte. Was war das bloß?« Fragend sah ich zu Adalbert, der feixend sein Glas suchte.
»Irgendein Nachträuber hat sich offensichtlich über deinen Krach geärgert«, lautete seine Antwort durch den Zahnpastaschaum.
Auch Felsfurch kam neugierig heran. Ich bemerkte spitz: »Sie können ruhig in Ihrem Zelt bleiben, die Sachen sind alle bereits abgewaschen.«
»Stellen Sie sich bloß nicht so an«, polterte er los. »Ich leiste meinen Beitrag, indem ich euch sicher durch den Urwald führe. Aber ein Greenhorn wie Sie gefährdet die gesamte Expedition durch seine Unwissenheit. Sie haben heute unser Trinkwasser falsch gefiltert, und wenn ich das nicht rechtzeitig gemerkt hätte, wären wir alle hochgradig erkrankt.« Er zog die Schultern zusammen, räusperte sich und verschwand in der Dunkelheit.
»Na, das kann man auch in einem anderen Ton sagen«, schimpfte ich hinter ihm her. Ich war wütend. Andererseits tat mir die Geschichte sehr leid, und ich entschuldigte mich bei meinen anderen beiden Gefährten.
Ich hatte meine Filme archiviert und war mit dem Fotomaterial sehr zufrieden. Ich hoffte auf einmalige Schnappschüsse, auch von der großen Netzjagd mit Duckern, Bongos und Riesenwaldschweinen. Meine Urwaldängste bekam ich zwar nicht in den Griff, aber sie wurden durch das zauberhafte Völkchen, das ich immer besser kennenlernte, ein wenig verdrängt. Was sich aber gar nicht verdrängen ließ, waren die ständigen Aggressionen des Grantlers Felsfurch. Er machte mir das ohnehin gefährliche Urwaldleben zu einer unerträglichen Tortur, und am nächsten Tag geschah es ...
Eigentlich war es ein Dschungelmorgen wie jeder andere.
Ich wurde von einem lauten Chor aus zirpenden, schnarrenden, keckernden und schreienden Stimmen aus dem Schlaf gerissen. Kurz darauf hörte ich die blecherne Stimme Felsfurchs, der mit Adalbert und Nosbusch diskutierte. Verschlafen kam ich aus dem Zelt und gesellte mich dazu. Felsfurch nahm dies zur Kenntnis, indem er kurz das Kinn anhob, was wohl soviel wie »Guten Morgen« heißen sollte. »Wir machen heute die Exkursion zum Raffiapalmenwald. Sie können ja inzwischen das Lager aufräumen und abends das Essen kochen. Wenn Sie hierbleiben, ist das Risiko geringer, daß was passiert.«
Mir blieb die Spucke weg. Adalbert grinste verhohlen, und Nosbusch machte sich aus dem Staub.
»Also, jetzt hören Sie mal, Sie Mistkerl, ich mach’ hier nicht das Heimchen für euch! Das war jetzt das letzte Mal, daß Sie mich so blöde anquatschen. Ab sofort könnt ihr euren Mist allein machen!« Vor Wut sah ich nur noch tanzende Sterne. Ich rannte in mein Zelt, warf in Windeseile alle meine Sachen zusammen, verpackte die Kameras und schrie nach Sabango. Der stand sofort neben mir.
»Los, such mir einen Träger und einen Pisteur, ich breche sofort nach Bangui auf.«
»Bangui, Madame? Das ist weit, und wir haben doch später gar keinen Wagen.« Entgeistert sah er auf mein Gepäck. Ich brüllte ihn an: »Los, such die Leute zusammen!« Verschreckt verschwand er, und jetzt kam Adalbert eilig zu mir herüber. »Du kannst doch unmöglich allein zurück, das ist viel zu gefährlich ...«
Ich unterbrach ihn: »Ach was, schlimmer als hier kann es gar nicht werden.«
Ich verabschiedete mich von ihm und Nossi. Dann fiel mein Blick zum Lagerausgang, wo sich Felsfurch herumdrückte. Er sah aus, als ob ihm ziemlich mulmig zumute sei. Ich winkte meiner kleinen Freundin Mada und schenkte ihr meine Wäsche. Die Jeans bekam Majeke, und Esakola erhielt meine Tasse. Liebevoll drückte ich sie alle zum Abschied an mich, da kam auch schon der verstörte Sabango mit Mungo und Bosso zurück. Wunderbar, meine beiden Jägerfreunde! Ich zeigte auf das Gepäck, schnappte meinen Rucksack und stapfte los.
»Viel Spaß noch mit dem Arschloch, wir sehen uns in Bangui!« rief ich zurück. Dann machte ich beiden Pygmäen Zeichen, daß ich es sehr eilig hätte.
Es war ein beschwerlicher Rückweg, aber ich fühlte mich gut, lief sehr schnell, und wir kamen zügig voran. So erreichten wir bereits am Nachmittag die große Kongo-Trasse. Hier machten wir zum erstenmal Rast im roten Sand der breiten Straße und teilten die einzige Ölsardinenbüchse. Plötzlich kam aus der Ferne mit lautem Getöse ein Lkw in einer dicken Staubwolke angedonnert. Gott war mir gnädig. Ich stoppte ihn, verabschiedete mich von Mungo und Bosso und stieg zu dem verdutzten Fahrer ins Cockpit. »A Bangui, s’il vous plait!« gab ich meine Bestellung auf. Ein breites Grinsen erhellte das schwarze Gesicht, und der Mann gab Gas. So schnell, wie meine kleinen Freunde im Rückspiegel verschwanden, so schnell verlief auch der restliche Tag. Hallelujah, endlich war ich frei von allen Ängsten und Gemeinheiten! Glücklich atmete ich tief durch. Doch meine innere Stimme prophezeite mir, daß ich irgendwie, irgendwann auf diese staubige Straße zurückkehren sollte ...
5
Abends war ich in Bangui und wurde respektvoll von Ernesto - so hieß der Fahrer - an meinem alten Hotel abgesetzt. Der große Lkw hüllte den armen Portier in eine dichte Staubwolke, aus der ich nur noch das Weiß seiner Augen erblickte. Trotzdem begrüßte er mich mit einem freundlichen »Bonjour madame, ça va?«
An der Rezeption bat ich, den nächsten Flug nach Paris reservieren zu lassen. Dann bekam ich mein altes Zimmer wieder. Gott sei Dank war so weit alles glatt gelaufen, und Urwald mitsamt Felsfurch war fast schon Vergangenheit. Meine Gedanken flogen zurück in meine heile Welt, zur Glockenbauerstraße und zu Mami. Sicherlich machte sie sich große Sorgen, und ich beschloß, sie gleich morgen anzurufen.
Jetzt aber telefonierte ich mit dem Botschafter und verabredete mich zum Abendessen. Er war mein einziger Verbündeter hier im Land.
Er war überrascht und begeistert, daß ich ganz allein war. »Respekt, meine Verehrte, für dieses Solo.«
Ich versprach ihm, meine Geschichte in allen Einzelheiten zu erzählen, wenn wir uns später sehen würden, und beendete unser Gespräch: »Bis später also und vielen Dank, daß Sie Zeit für mich haben.«
Während des Telefonats hatte ich mich schon halb entblättert, schlüpfte nur noch aus dem Slip, und schon verschmolz ich mit dem lauen Strahl der Dusche. Fast eine Stunde brauchte ich, bis endlich sauberes Wasser an mir herabfloß, doch dann fühlte ich mich wie neugeboren. Ich zog den Seidenfummel glatt und schlüpfte hinein, tupfte den Rest des geschmolzenen Lippenstiftes auf und fuhr mir noch einmal durch die wallenden Haare.
Im Spiegel strahlte mich eine wunderschöne Julia an. Das Leben fand wieder statt ... Und ich sprang voll hinein. An der Rezeption wartete bereits Hans Schnell und sah auch genauso aus, wie Hans Schnell aussehen sollte: ordentlich deutsch, mit graublauem Hemd und Nummersicherkrawatte mit kleinen Pünktchen, leichtem, schilfigem Leinenanzug und blank gewienerten Schuhen.
»Donnerwetter, Julia, so bildschön. Ich hatte erwartet, Sie blaß und elend wiederzusehen.« Dabei musterte er mich unverhohlen.
»Und wie geht es Ihrer Frau, kommt sie nicht mit zum Essen?«
Er lachte ertappt. Der Rest interessierte mich herzlich wenig, denn wir waren im Restaurant gegenüber angekommen. Wonnige Wellen der Vorfreude auf ein köstliches Essen - seit fast drei Wochen das erste - machten mir den Mund wäßrig. Ich konnte es kaum erwarten, bis die Speisekarte kam, und suchte eilig ein Steak aus. Schnell überbrückte charmanterweise diese Pause mit einer Flasche Champagner. In großen Schlucken schüttete ich diesen in wenigen Zügen hinunter, welch ein Genuß!
»Nach all den Ölsardinen, verrußten Antilopenschenkeln, hundertfüßigen Raupen, dünnen Tütensuppen und labberigem Tee werde ich dieses ›Abendmahl‹ besonders schätzen«, entschuldigte ich meine Hast angesichts des verblüfften Schnell.
»Raupen? Igitt! Wollen wir trotzdem einmal zusammen anstoßen?« fragte er lachend.
»Verzeihen Sie, natürlich. Ich bin ein wenig verwildert. Auf eine außergewöhnliche Expedition!«
Vergnügt prosteten wir uns zu, und ich erzählte ihm den Verlauf meiner Reise im Fahrwasser eines vom Leben gebeutelten Felsfurch. Da kam das lang ersehnte Steak, pommes vapeur, grüne Böhnchen ... und schon war alles verputzt.
»Das Beste, was ich seit meiner letzten Sülze mit Bratkartoffeln, 1998, zu mir genommen habe. Mein Leibgericht.« »Da gibt es noch diverse Desserts ... Oder noch einmal das Gleiche? Wozu darf ich Sie einladen, Julia?«
»Nein, danke, ich bin vollauf zufrieden. Ich muß mich bald um meinen Abflug und die ganzen Formalitäten kümmern, umbuchen usw.«
»Das hat aber noch drei Tage Zeit: Am Sonntag geht der einzige Flug in der Woche. Ich helfe Ihnen natürlich dabei. Wollen wir noch einen Digestif an der Bar nehmen?«
Ich war einverstanden und richtig übermütig nach der Flasche Champagner, die ich fast allein geleert hatte.
An der Bar tummelte sich ein buntes Männergemisch: Araber, abenteuerlich aussehende Weiße, einige Schwarze in prall sitzenden Anzügen und ein freundlicher Gitarrenspieler, der irgend etwas über »moustiques« sang zu seinem traurigen Spiel. Im Hintergrund plärrte eine Radiodurchsage, und aus der Herrentoilette dicht neben uns wehte der scharfe Geruch eines Desinfektionsmittels herüber, gepaart mit einer Brise süßlichen Deosprays. Ein paar Männer sahen neugierig zu uns herüber.
»Morgen früh möchte ich gern auf dem Markt herumstöbern und unbedingt im Künstlerviertel noch ein paar Geschenke kaufen. Wissen Sie eine nette Dame, die mich begleiten könnte?«
»Wenn Sie nichts dagegen hätten, würde ich gerne diese Dame sein. Es wäre mir eine große Ehre, eine so außergewöhnliche Frau zu begleiten. Ich empfehle, zuerst zum Marché Artisanal aufzubrechen. Ich würde Sie gegen neun Uhr abholen, wenn es Ihnen recht ist.«
»Wunderbar. Übrigens brauche ich von Ihnen die Adresse des Mannes mit dem Landhaus im Saland. Ich möchte mich bei ihm für den wunderbaren Empfang bedanken. Ein alter Syrer oder so ähnlich.«
»Na, wenn das kein Zufall ist!« Schnell machte große Augen. »Da kommt er gerade höchstpersönlich, der alte Syrer.« Lachend deutete er hinter mich.
Als ich mich zum Eingang drehte, sah ich einen imposanten mittelgroßen Mann mit dem Gesicht eines hungrigen Raubvogels. Er bewegte sich auf uns zu, und während er näherkam, musterten mich seine dunklen, wachsamen Augen unter den buschigen Brauen. Wie magnetisch angezogen landete er direkt bei uns: der geheimnisvolle Fremde vom Flughafen!
Auch er hatte mich wiedererkannt und begrüßte mich mit viel Charme. »Madame, quel plaisir!« Während er meine Hand küßte, ließen seine Augen nicht von mir, und ich hatte das Gefühl, ich hätte vergessen, ein Kleid anzuziehen. »Tahim Sadar«, stellte er sich vor.
»Je m’appelle Julia von Laue.« Ich strahlte zurück.
Er fand meinen Namen sehr schön, natürlich. Dann begrüßte er Schnell, und nebenbei orderte er Champagner, natürlich.
Ich sah verblüfft zu Schnell und fragte leise: »Sie sind sicher, daß dies der Mann ist, der ...«
Schnell nickte amüsiert. Ich war neugierig auf diesen attraktiven Fremden. In der letzten Zeit hatte sich mein Französisch verbessert, und ich konnte mich nun gut unterhalten. »Leben Sie schon lange in Bangui, Monsieur Sadar?« fragte ich ihn.
»Seit meiner Geburt praktisch. Genau gesagt, seit 48 Jahren. Meine Eltern sind Libanesen und haben mich im Alter von drei Jahren nach Bangui mitgebracht. Seitdem habe ich dieses Land nie mehr verlassen.«
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Neuausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2012
- ISBN (eBook)
- 9783942822022
- DOI
- 10.3239/9783942822022
- Dateigröße
- 1.4 MB
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2012 (Oktober)
- Schlagworte
- Afrika Zentralafrikanische Republik Kongo Deutsche Frau Photographin Forschungsreise Pygmäen