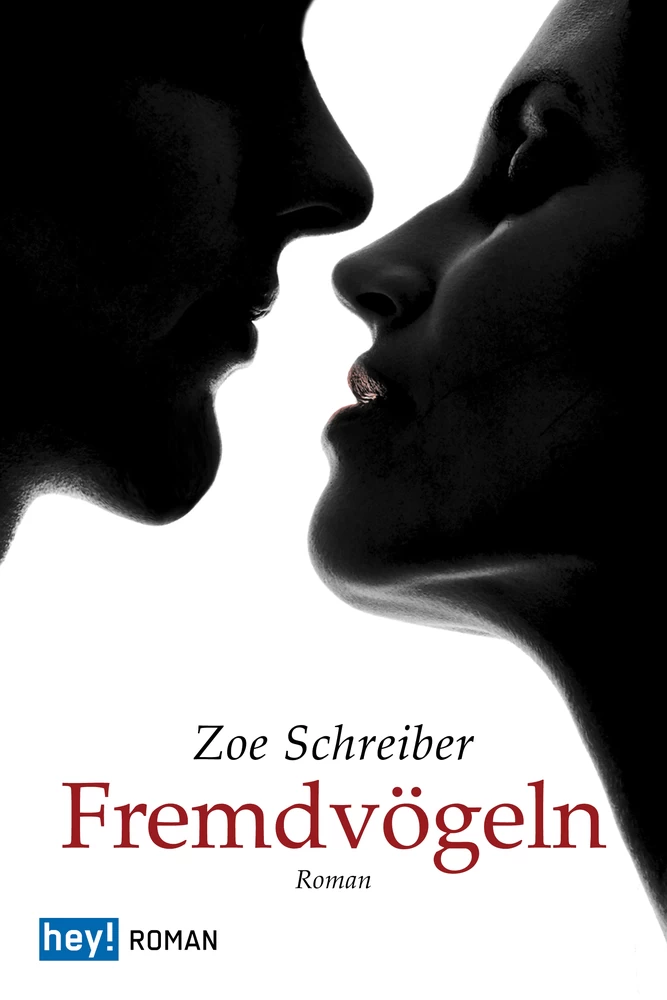Zusammenfassung
Eines Abends trifft sie auf eine flüchtige Jugendbekanntschaft. Daniela lässt sich mit Tom auf eine leidenschaftliche Affäre ein, in der sie sich mehr und mehr verliert. Hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch nach emotionaler und erotischer Erfüllung und dem Bedürfnis nach Sicherheit und einem geregelten Leben, muss sie eine folgenschwere Entscheidung treffen …
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL 1
Ich wusste vom ersten Moment an, dass ich ihm verfallen würde. Dass ich verloren wäre, wenn er mich nur einmal küsste. Dass ich mich ihm ausliefern und nicht zögern würde, mein bisheriges Leben gegen die Wand zu fahren. Dass er mein Ruin sein würde. Ich wusste es nach dieser ersten Umarmung, die so gefühlvoll und innig war und so gar nicht zu seiner coolen Optik passte. Aber ich wollte es nicht wahrhaben, denn ich wollte ja nur ein bisschen fremdvögeln.
Wir waren in der „Insel“, einem Club an der Alster, in den ich schon zu Abi-Zeiten gegangen war. Damals hatte ich mich zu jung gefühlt. Heute, mit Mitte dreißig, schien ich hier genau richtig zu sein. Oder war ich schon zu alt, um in Nightclubs zu viel Sekt auf Eis zu trinken, selbstverliebt zu tanzen und zu flirten, was das Zeug hielt? Ein letztes Aufbäumen, bevor die magische 40 überschritten war, ein letztes Zucken der Fortpflanzungsorgane im Hormonrausch?
„Ich muss gehen“, sagte ich zu ihm. Er stand am Rand der Tanzfläche, nippte an einem Wodka Tonic und zog an einer Zigarette. Warum stand ich immer noch auf solche Typen? Seine Haare waren etwas zu lang, blond und fein. Er trug einen grauen Anzug zu Jeanshemd und Cowboystiefeln. Ich starrte auf das Schlangenmuster und die ramponierten Spitzen. Schon mit zwanzig hatte ich Jungs mit Cowboystiefeln gemocht. Hatte ich nichts dazugelernt?
„Sehe ich dich nächste Woche wieder?“, fragte er. Seine Augen, hellblau oder grau, so genau konnte ich das in dem Licht nicht erkennen, musterten mich intensiv. Ich zuckte mit den Schultern. „Mal sehen. Vielleicht gehen wir ins Bereuther.“
Ein Austausch von Banalitäten, ein Tänzeln an der Oberfläche.
Eine Blondine mit Endlosbeinen in einem engen Top, das ihre Brüste betonte, ging vorbei und warf ihm ein laszives Lächeln zu. Barbie sah aus, als hätte sie sich gern länger mit ihm unterhalten – was auch immer „unterhalten“ in Diskos wie dieser bedeuten mochte. Mich behandelte sie wie Luft. Schlimmer, wie luftleeren Raum.
„Na, dann“, sagte er und warf die Zigarette auf den Boden, wo er sie mit einer knappen Drehung seiner Stiefelspitze austrat. Unversehens breitete er die Arme aus, zog mich an sich und umarmte mich auf eine Weise, die mich in die Knie zwang. Zart, weich und fest zugleich, zärtlich und liebevoll, fast beschützend drückte er mich an seine breite Brust. Mit Stiefeln war er bestimmt über 1,90 Meter groß. Mein Gesicht sank an seinen Hals, der Geruch nach Rauch, einem herben Parfum, Wodka und einem schwachen Minzduft machte mich benommen. Darunter lag noch etwas anderes, ein vages, aber reizvolles Versprechen, über das ich nicht so genau nachdenken durfte. Ich vergrub meine Nase zwischen Anzugrevers und Haut. Sein Haar kitzelte mich in der Nase. Ich hätte Stunden so stehen können. Es war wie nach Hause kommen und ein Sprung in schwindelerregende Tiefen zugleich. Fast stiegen mir Tränen in die Augen. Warum hatte mich in den letzten 35 Jahren nie jemand so umarmt? Mich von ihm zu lösen kostete enorme Kraft. Tapfer lächelte ich ihn an.
„Bis dann.“
Er grinste zurück und fuhr sich durch die Haare. Vor fünfzehn Jahren waren sie noch viel länger gewesen. Meine alte Schulfreundin Britta und ich hatten ihn deshalb Blondie genannt. Blondie kam immer erst ins Madhouse, die damalige In-Disco, wenn es proppenvoll war oder wir schon los mussten, weil die letzte Bahn in die Vorstadt ging. Er kannte alle, die wichtig, cool und schön waren, wurde von jedem begrüßt und hatte sofort ein Getränk in der Hand, während wir konsequent vom Barkeeper ignoriert wurden. Im Schlepptau hatte er stets die hübschesten Mädchen. Uns Landeier nahm er gar nicht wahr. Aber Blondie war uns sowieso viel zu alt, und er gefiel uns auch nicht, denn er war kein süßer Junge wie die Sänger von Wham, Spandau Ballett oder Depeche Mode.
„Du musst los“, erinnerte er mich. „Oder willst du doch noch was trinken?“
Er trank sein Glas aus und gab dem Barkeeper ein Zeichen. Wie früher schien der nur darauf zu warten, dass Tom etwas bestellte.
„Nein, es ist schon viel zu spät für mich.“
Suchend sah ich mich nach Carina um, mit der ich hergekommen war. Ich erblickte sie auf der Tanzfläche, wo sie sich, scheinbar selbstversunken, in Wahrheit jedoch mit wohlkalkulierter Sinnlichkeit, zur Musik bewegte. Sie hatte das wirklich drauf. Einige Typen starrten sie an wie hungrige Wölfe, ein anderer tanzte sehr dicht neben ihr. Wenn ich tanzte, bemühte ich mich immer, sie unauffällig zu imitieren. Peinlich, wenn man es nie geschafft hatte, sich einen eigenen Tanzstil zuzulegen. Ich winkte ihr kurz zu, sie winkte zurück und wandte sich dann wieder ihrem Aufriss zu. Offenbar wollte sie noch bleiben. Noch einmal lächelte ich Tom an, der mir zum Abschied zuzwinkerte. Dann wankte ich so schnell ich konnte durch den Raum, der von Stimmengewirr, hysterischem Frauenlachen und den neuesten Dancefloor-Hits vibrierte, drängte mich durch alkoholisiertes Partyvolk, das an diesem x-beliebigen Donnerstag im Oktober feierte, als gäbe es kein Morgen. Oder jedenfalls keinen trüben Freitagmorgen mit Kater und Kopfschmerzen. Meine Beine waren so wabbelig, dass sie mich kaum auf meinen zu hohen Absätzen sicher und wenigstens halbwegs elegant zum Ausgang trugen. Ich konnte nicht fassen, dass diese Umarmung und dieses letzte Zwinkern mich so verunsichert hatten.
An der Garderobe löste ich meinen Mantel aus und verließ den Club. Der Türsteher nickte mir zu: „Bis nächste Woche.“ Das sagte er nur, weil ich mit Tom gekommen war, direkt aus dem Bereuther. Plötzlich kannte er mich, nachdem er mein schüchternes „Tschüss“ monatelang ignoriert hatte.
Durch matschiges Herbstlaub glitschte ich zu meinem Cabrio, schloss auf und ließ mich auf den Sitz fallen. Zwei Uhr, schon wieder viel zu spät. Mein Kopf summte wie ein ganzer Bienenstock und auf meinen Lippen lag der Geschmack von Zigaretten und Weißwein. Ich redete mir ein, dass ich noch fahren konnte. Dass ich nur von Toms Umarmung so durch den Wind war. Wahrscheinlich würde ich sowieso nicht kontrolliert werden. Das letzte Mal war ich angehalten worden, als ich meine Führerscheinprüfung gerade bestanden hatte. Ich schob mir ein Kaugummi in den Mund und startete den Wagen. Mein Handy piepste.
„Ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Tom.“
Ich starrte das Display einige Sekunden an, bevor hinter mir ungeduldig gehupt wurde. Jemand wollte meinen Parkplatz übernehmen. Mit schwitzenden Händen packte ich das Lenkrad und fuhr los.
Ich sollte die SMS löschen, bevor ich nach Hause komme, dachte ich. Bevor sie Stefan findet. Kein Ehemann der Welt würde sich über eine solche Nachricht freuen.
Zu Hause, im idyllischen Sasel, im kreditfinanzierten Einfamilienhaus direkt im Alstertal, wartete meine Familie auf mich. Natürlich schliefen zu dieser Zeit alle. Meine zuckersüße Tochter Milena, neun, und mein entzückender Sohn Noah, vier, schon fast fünf Jahre alt.
Welches unbefriedigte Bedürfnis trieb mich eigentlich Woche für Woche „in die Stadt“, wie man bei uns im Vorort so sagte, nach Eppendorf, in eine Bar, in der hungrige Singles nach Liebesabenteuern Ausschau hielten, wo ich doch hier alles hatte?
Ich fuhr den Wagen ein wenig zu schwungvoll in den Carport und schrammte dabei an einem der Holzpfähle entlang. „Mist“, zischte ich. Das Licht, eigentlich von einem Bewegungsmelder aktiviert, ging nicht an, sodass ich mich im Dunkeln aus der Tür zwängen musste. Ich würde mir die Schramme morgen anschauen.
Die Eingangstür knarrte und ich stolperte über Schuhe, die verstreut im Flur lagen. Aus dem Schlafzimmer erklang Stefans sattes Schnarchen, und sofort meldete sich der gewohnte Groll, ein unterschwelliger Ärger, den ich länger mit mir herumschleppte, als ich zugeben wollte. Ich schlich ins Bad, schminkte mich ab und putzte mir die Zähne. Im Spiegel begegnete mir leicht verschwommen ein frecher Blick, gekrönt von einem gutgelaunten Funkeln. Oh ja, das Aufstehen in nicht ganz vier Stunden würde hart werden. Und ich würde Kopfschmerzen haben. Mich schlapp durch den Tag mit Haushalt und Kindern kämpfen. Aber es lohnte sich. Denn ich fühlte mich endlich wieder lebendig.
Der Fußboden war kalt. Ich tappte vorsichtig über die Fliesen im Flur, bog dann auf den nur unwesentlich wärmeren Parkett des Schlafzimmers ein. Wir heizten dort nie, aus Energiespargründen. Der 60er-Jahre-Bungalow war schlecht isoliert und man heizte buchstäblich aus dem Fenster. Es war stockdunkel. Das Schnarchen meines Ehemannes war einige Sekunden lang leiser geworden, als warte es ab, während ich mich vorsichtig unter die Bettdecke schob, und dröhnte nun wieder in voller Lautstärke los. Ich stopfte mir Ohropax in den Gehörgang, drehte mich auf die Seite und zog mir die Bettdecke über den Kopf.
KAPITEL 2
„Wann warst du denn gestern Abend zu Hause?“
Ich schmierte gerade das Schulbrot für Milena, die erörterungsbedürftige Sonderwünsche für den Belag hatte. Das gab mir einige Minuten, um zu überlegen. Wahrscheinlich hatte er mich nicht gehört. Das Schnarchen hatte überzeugend geklungen.
„So gegen eins. Genau weiß ich das nicht. Hab nicht auf die Uhr gesehen“, log ich. Er schluckte es anstandslos.
„Und, war es schön?“, erkundigte Stefan sich, während er genussvoll in sein Brötchen biss.
„Na ja“, wiegelte ich ab. „Wie immer. War ganz lustig. Carina ist natürlich länger geblieben.“
Er wusste, dass Carina unglücklich verheiratet war. Ihr Mann Sven hatte laufend Affären, vorwiegend mit jungen Aushilfen, die in ihrem Eiscafé jobbten, oder der jungen, hübschen Babysitterin. Sie blieben nur wegen der Kinder, die noch kleiner waren als unsere, und wegen des gemeinsamen Unternehmens zusammen. Angeblich hatten sie sich arrangiert. Auch Carina vergnügte sich außerehelich.
„Aha. Hoffentlich hast du nicht zu viel getrunken?“
„Nein. Nur zwei Weinschorlen. Aber zu viel geraucht.“
„Geht schon“, fügte ich knapp hinzu, als ich sein süffisantes Grinsen sah, und konzentrierte mich auf Noahs Proviant für den Vormittag. Ich sehnte mich danach, endlich alleine zu sein.
„Hast du meinen Schlüssel gesehen?“, fragte Stefan. Sachen zu verlegen und zu suchen war ein Hobby von ihm, in das er mich gern einbezog.
Ich zuckte die Schultern. „Wenn er nicht im Schlüsselkasten hängt, weiß ich auch nicht.“
Bevor Milena davon stürmte, drückte ich ihr die Dose mit den Pausenbroten in die Hand. Milenas Schule lag nur wenige hundert Meter entfernt. Oft nahm Stefan sie auf dem Weg zur Praxis mit. Das war ihr allerdings in letzter Zeit zu peinlich geworden.
„Welche Schuhe, welche Jacke?“, fragte sie. Ich wies auf die Halbschuhe und reichte ihr eine Steppjacke. Sofort verzog sie das Gesicht.
„Nee, die ist hässlich!“, beschied sie und rupfte einen kurzen Blouson vom Haken, der ihr ein wenig zu klein war. Dazu schlüpfte sie in ausgelatschte Turnschuhe. Mein Kopf dröhnte und ich hatte keine Lust, mich auf sinnlose Diskussionen einzulassen.
„Das sieht komisch aus!“, kicherte Noah, der sich an mich schmiegte.
Milena warf ihm einen bösen Blick zu. „Muss er nicht in den Kindergarten?“
Noah schüttelte den Kopf.
„Doch“, widersprach ich. „Heute ist ‚drinnen‘.“ Noah war in einem Waldkindergarten und hatte zwei Tage die Woche „draußen“ im Wald und zwei Tage „drinnen“ im Gebäude.
„Dann kann ich ja mit meinem unsichtbaren Computer spielen“, gab Noah befriedigt zurück.
Milena verdreht die Augen und packte ihren Ranzen. „Tschüss, Mama!“
Ich gab ihr schnell einen Kuss, bevor sie flüchten konnte. Dann verabschiedete ich mich von meinem Mann, der seinen Autoschlüssel endlich gefunden hatte. Er schmatzte mir einen flüchtigen Kuss auf die Wange.
Schon in der offenen Tür stehend sagte er: „Wird nicht so spät heute. Ich bin wahrscheinlich so gegen drei wieder da.“ Er knuffte Noah liebevoll zum Abschied.
„Dann wollte ich aber noch eine Runde fahren, meinst du, das geht?“
Sein Blick schweifte sehnsüchtig zur Garage. Zwei Motorräder, eins davon im nicht abgeschlossenen Reparaturzustand, besetzten den Stellplatz für das Auto. Nur die Fahrräder passten noch hinein – wenn sie Glück hatten.
„Klar“, sagte ich ergeben. Was sollte ich sonst sagen? Wenn ich mir die Abende in einer Bar um die Ohren schlug, konnte ich meinem schwer arbeitenden Mann ja wohl kaum die unschuldige Runde auf seinem geliebten Motorrad verbieten.
Nachdem ich Noah im Kindergarten abgeliefert und den Wochenendeinkauf erledigt hatte, kannte ich nur noch ein Ziel: mein Bett. Mein Kopf dröhnte. Die blöde Tablette hatte rein gar nichts bewirkt. Durch meine Adern pulsierten Restalkohol und Nikotin. Was den Abend zum lustvollen Versprechen gemacht hatte, hatte nun seinen schillernden Kokon der Täuschung verloren. Im grauen Oktobertageslicht wirkten die Stunden meiner Familienflucht geradezu absurd. Was tat ich da bloß? Und warum? Ich musste einen Dachschaden haben, wie meine ebenfalls verheiratete Freundin Tina gern sagte.
Mit ihrem Mann Holger hatte ich beinahe eine Affäre gehabt. Vorletztes Jahr hatte es zu knistern begonnen. Eigentlich hatte ich Holger bis dahin kaum wahrgenommen – nur als blondes, durchtrainiertes, aber etwas langweiliges Anhängsel von Tina. Dann feierten wir meinen 33. Geburtstag, ich trug ein schwarzes Kleid von Jil Sander, und Holger küsste mich fast auf den Mund. Plötzlich sah ich ihn zum ersten Mal wirklich und erblickte einen attraktiven Mann, neben dem Tina knittrig aussah. Auf einmal begannen meine Gedanken um ihn zu kreisen. Bei harmlosen Kaffee-und-Kuchen-Treffen samt Kindern bekam ich feuchte Hände. Wenn ich Tina zum Weintrinken abholte, hoffte ich, ihn zu sehen. Immer wieder gab es Blicke und Begrüßungsumarmungen, die einen Tick zu lange dauerten. Bei Stefans Geburtstag hockte ich fast die ganze Zeit auf der Sofalehne neben Holger, fast an ihn geschmiegt, während Stefan mit seinen Motorradfreunden am Esstisch über die schnellste Rennstrecke diskutierte. Zum Abschied folgte wieder eine innige Umarmung, die jeden hätte stutzig machen müssen. Es sah aber keiner. Nachts, weinbeduselt, schickte ich ihm eine Mail: „Can you feel it`s magic?“, anknüpfend an einen alten Song, und schämte mich am nächsten Tag dafür. Herzklopfend überwachte ich meinen E-Mail-Eingang. Nichts geschah. Ich hatte mich lächerlich gemacht.
Viel später begriff ich, dass Holger ein Feigling war. Vor dieser Einsicht folgten Monate inneren Aufruhrs. Als ich fast nicht mehr dran glaubte, hatte ich ihn zufällig am Telefon, als ich Tina sprechen wollte. Plötzlich wollte er mich sehen. Wir trafen uns in einer Bar in Winterhude. Es prickelte sofort. Er aß einen Antipasti-Teller im Stehen, ich bekam keinen Bissen herunter, sondern trank stattdessen zwei Gläser Wein. Dann packte ihn die Panik, weil er eine Bekannte von Tina zu sehen glaubte. Wir gingen zu meinem Auto. Als ich ihn zu Hause absetzte, schlug er vor, noch ein letztes Gläschen zusammen zu trinken. Naiv willigte ich ein. Oder wusste ich, was kam? Kaum hatten wir den Flur betreten, fiel er über mich her. Er küsste mich leidenschaftlich, biss mich in die Lippe, drängte mich an die Wand, umschlang mich, hob mich hoch, als wöge ich nichts, ich spürte seine sehnigen Rückenmuskeln. Hände überall, hochgezerrte Kleidungsstücke. Es fühlte sich wahnsinnig und gut an. Stufe für Stufe schob er mich die Treppe in den ersten Stock hoch, und bugsierte mich ins Schlafzimmer, legte mich auf das Ehebett. Ich würde meinen Mann erschießen, wenn er so etwas täte. Und es verstehen, wenn er dasselbe täte. Den Gedanken, dass ich neben meinem Mann auch meine Freundin betrog, verdrängte ich. Stattdessen wälzte ich mich mit Holger im Bett, alle Nervenenden aufgestellt, elektrisiert. Nur mit Mühe zog ich die Notbremse und schlief nicht mit ihm. Ein Teil meines Gehirns schien noch zu funktionieren und sagte mir, dass ich nicht schwanger werden dürfe, wo mein Ehemann doch sterilisiert war. Also besorgte ich es ihm mit der Hand. Nachdem er zum Orgasmus gekommen war – ich hatte keinen gehabt – gingen wir nach unten. Er trank ein Glas Saft und wünschte mir einen guten Heimweg, als wäre nichts gewesen. Zittrig stieg ich ins Auto. Kein Wort über ein Wiedersehen. Kein Wort über Gefühle. Wie ein Judas schlüpfte ich zu Hause ins Bett. Einmal noch sahen wir uns, knutschten in einem mexikanischen Restaurant. Arm in Arm fuhren wir durch Hamburg. Ich war wie auf Drogen. Dann verlief es wortlos im Sand. Ich konnte nicht fassen, was für ein Blödmann er war. Nicht einmal gesprochen hatten wir über den Status unserer Nicht-Beziehung.
Also ging ich wieder mit Tina Wein trinken, mit schlechtem Gewissen lud ich sie ein. Mein erster Ausflug ins Land des Ehebrechens war noch einmal glimpflich abgelaufen. Keiner war zu Schaden gekommen. Aber wenn die Dämme erst brechen, kann man der Flut kaum noch Einhalt gebieten. Innerlich Abbitte tuend, war ich reumütig zu Stefan zurückgekommen, der ja gar nicht gemerkt hatte, dass ich kurz davor gewesen war, ihn zu verlassen. Wochen und Monate vergingen, bis wieder die Unzufriedenheit über meine mittelmäßige Ehe in mir hoch kam. Sie trieb mich in Bars, mit Carina und ihren Single-Freundinnen. Ich genoss es, wenigstens einen Abend die Woche ein böses Mädchen zu sein – zumindest in meiner Fantasie. Ich könnte mich doch eigentlich glücklich schätzen. Eigentlich.
Während ich zwei Gläser Wasser in der Küche trank, starrte ich in unseren stillen, friedvollen Garten. Ich sehnte mich nach ungestörten Stunden nur für mich. Kein Schnarchen, keine Kinder, keine Haushaltspflichten, von der Praxisbuchführung ganz zu schweigen. Ich sehnte mich nach Schlaf und Vergessen. Aber ich konnte nie schlafen, einfach so. Auch wenn ich noch so kaputt und gerädert war.
Müde stellte ich das Glas in die Spüle, nahm mir aus dem Apothekerschrank einen Schokoriegel und ging ins Schlafzimmer. Nur die Jeans zog ich aus, bevor ich fröstelnd unter die Decke schlüpfte. Ich schloss die Augen und bemühte mich, das unentwegte Brausen meiner Gedanken zwischen Selbstvorwürfen, Rechtfertigungen und Verlangen zu ignorieren. Doch immer wieder kehrten sie zu Tom, seiner Umarmung und seiner SMS zurück. Ich würde wohl nicht wieder einschlafen können.
KAPITEL 3
Irgendwann war ich doch eingeschlafen. Als ich aufwachte, war mir schwindelig und übel. Dann schoss ich hoch: Noah! Ich stolperte in die Küche und sah auf die Backofenuhr. Erst zwanzig nach zwölf. Glück gehabt, noch zehn Minuten bis Kindergartenschluss. Ich wusch mir schnell das Gesicht, schlüpfte in Jeans und Schuhe und rannte zum Auto. Während ich die lange Auffahrt rückwärts hinunterfuhr machte ich mir Vorwürfe. Wenn ich wie eine ordentliche Mutter früh zu Bett gegangen wäre und den Vormittag mit Hausarbeit verbracht hätte, wäre das nicht passiert. Nur weil ich mir die Nächte in Bars um die Ohren schlug, hungrig auf die Blicke fremder Männer hoffend, war ich zu spät dran.
Zu allem Überfluss klingelte auch noch mein Handy. Ich warf einen nervösen Blick auf das Display, zwischen Panik und Freude schwankend. Konnte es Blondie sein? Tom, verbesserte ich mich. Aber es war mein Mann. Enttäuschung und Erleichterung mischten sich.
„Hallo?“
„Na, was machst du gerade?“
Ich hörte, wie er eine Zeitung umblätterte. Einerseits schien es lieb, dass er mich immer noch täglich anrief, andererseits verband er es meistens mit einer Kaffee-, Brötchen- und Zeitungspause, was bedeutete, dass er mich eigentlich nicht hörte.
„Ich hole Noah vom Kindergarten ab, wie immer um diese Zeit.“ Ich hörte, wie gereizt das klang.
Er biss krachend in ein Brötchen, kaute und schluckte. „Nicht erst um eins?“
„Freitags ist immer eine halbe Stunde früher Schluss“, gab ich zurück. Wieso konnte er sich das nie merken? „Und du, viel zu tun?“
„Heute Morgen eine größere Wurzelbehandlung, sonst nur Kleinkram. Sag mal, was haben wir eigentlich am Wochenende vor?“
Ich ahnte, worauf die Frage abzielte. „Wir treffen uns Samstag mit Birgit, Andreas und den Kindern. Wieso?“
„Och, schade.“
„Warum?“ Ich spürte altbekannten Ärger in mir aufsteigen. Mit Sicherheit fragte er nicht, weil er eine tolle Idee für uns hatte. Weil er Zeit mit mir oder unseren Kindern verbringen wollte.
„Na, ich dachte, ich könnte nochmal zum Nürburgring fahren. Sozusagen als Saisonabschluss.“
Motorradfahren, seine große Leidenschaft. Die einzige. Die Kinder, ich, die Praxis – wir waren Pflichten für ihn. Aber das Motorrad war die Kür, die große Liebe, das brachte sein Blut in Wallung und sein Herz zum Pochen.
„Ach, so.“
„Du hast doch nichts dagegen, oder?“
Hoffnung und Begeisterung schwangen in seiner Stimme mit. Warum fragte er überhaupt? War ich seine Mutter? Kam es mir zu, ihm etwas zu erlauben oder zu verbieten? Konnte man auf ein Motorrad eifersüchtig sein? Was wirklich wehtat war, dass er mir nicht halb so viel Leidenschaft entgegen brachte wie seinen Maschinen.
„Mach doch. Dann sage ich das Kaffeetrinken eben ab.“ Wieder ein einsames Wochenende mit den Kindern. Und genau das war es, was mich störte, was mich in Bars trieb, fort von ihm.
„Super, danke! Dann sag ich Jörn Bescheid, dass das klappt. Bis nachher, Schatz!“ Er konnte gar nicht schnell genug auflegen.
Ich bog auf den Parkplatz ab. Mein Sohn rannte mir entgegen. Er sah verweint aus. Ich nahm ihn in die Arme, drückte ihn fest an mich und steckte die Nase in sein weiches blondes Haar. Mein Baby, mein Süßer, mein Kleiner. Wie ich seinen Geruch liebte.
„Was ist denn los mit dir?“
„Julian hat mir die Schaufel weggenommen und mich gehauen“, jammerte er und zeigte auf einen Zweijährigen, der mindestens einen Kopf kleiner war als er. Der Zwerg grinste frech zu uns herüber.
„Aber der ist doch viel kleiner als du“, sagte ich und strich Noah über den Kopf. „Warum wehrst du dich denn nicht?“
„Ich kann doch keine Kleineren hauen“, gab er zu bedenken.
„Schon – aber halte doch die Schaufel nächstes Mal einfach fest und sag ihm deutlich, dass du sie nicht hergibst.“
„Dann holt er seinen großen Bruder“, entgegnete Noah und wies auf Christian, der mit fast sechs Jahren unangefochtener Anführer der Kindergartentruppe war.
Die Welt war eben ungerecht.
*
Mein Ehemann platzte fast vor guter Laune, als er nach Hause kam. Ich lag entkräftet auf dem Sofa und versuchte zu lesen, während aus beiden Kinderzimmern CDs dröhnten.
„Na, was machen die Mäuse?“, sagte er zur Begrüßung und gab mir einen schmatzenden Kuss auf die Wange. Ich verkniff mir die Antwort – es war ja deutlich zu hören.
„Ist noch Essen da?“
Schon stand er in der Küche und schaufelte den Rest der Reispfanne in sich hinein. Ich schleppte mich pflichtschuldig hinter ihm her.
„Soll ich es dir warm machen?“
„Nö, geht schon.“ Er warf einen Blick zur Uhr. „Ich muss noch was an der Kupplung machen, bevor Jörn kommt.“
Ich seufzte. Insgeheim hatte ich gehofft, er würde doch zu Hause bleiben. Wenn Jörn nicht gekonnt hätte, wäre Stefan auch nicht gefahren. Aber Jörn, ein Gesamtschullehrer, der optisch in den 80er Jahren stehen geblieben war, nur dass sein Haupthaar schütter wurde, nahm sich jede Freiheit. Naja, kein Wunder: Seine Frau hatte kurze Haare, war moppelig und immer vollkommen ungeschminkt in Birkenstocksandalen unterwegs. Da konnte man ja einsehen, dass Jörn fast jedes Wochenende flüchtete und die Erziehung seiner Blagen seiner Ehefrau überließ. Aber offensichtlich war ich ja für meinen Mann genauso unattraktiv. Jedenfalls war sein Interesse an mir seit Noahs Geburt merklich gesunken - seitdem fuhr er wieder exzessiv Motorrad.
Oder war ich es vielleicht nie gewesen? Ich erinnerte mich an die Anfangszeit unserer Beziehung: Wir lagen in meiner Ein-Zimmer-Wohnung auf dem Bett und streichelten einander. Der Fernseher lief nebenbei. Stefan wollte ihn nie ausstellen, sprach von einer „angenehmen Geräuschkulisse“. Anscheinend war schon damals der Sex mit einer zweiundzwanzigjährigen, willigen Blondine nicht interessant genug. Wir küssten uns, doch er schielte zum Bildschirm, auf dem gerade eine Wiederholung von Kojak lief.
„Guckst du etwa nebenbei fern?“, fragte ich erbost.
„Wo denkst du hin?“
Ich stellte das Gerät aus. „Das kann ja wohl nicht angehen!“, moserte ich.
„Komm wieder her!“
Er zog mich aufs Bett, das neben meinem Schreibtischstuhl das einzige Möbelstück im Zimmer war. Willig ließ ich mich sinken. Das Streicheln ging weiter, bis ich merkte, dass seine Hand immer dieselbe Bewegung auf meinem Rücken vollführte.
„Was ist denn?“
Er gähnte vernehmlich. „Tut mir Leid. Ich bin auf einmal sooo müde!“
Soviel zur Leidenschaft des Anfangs.
Zum Motorradfahren war er jedenfalls nie zu müde. Ich sah vom Küchenfenster aus zu, wie er pfeifend in der Garage herum räumte, um all das seltsame Spiel- und Werkzeug, das man für ein Wochenende auf der Rennpiste brauchte, im Anhänger zu verstauen. Die Kinder ließen sich nicht blicken. Erst als Jörn klingelte, kamen sie neugierig aus ihren Zimmern. Jörn winkte ihnen und mir lustlos zu, offensichtlich froh, dass ich ihm kein Gespräch aufdrängte, und stapfte mit Stefan in den Keller. Unten hörte ich sie fachsimpeln, aber da das Thema Motorrad eine ähnlich einschläfernde Wirkung auf mich hatte wie das Thema Sex auf meinen Ehemann, kroch ich entkräftet auf meine Couch zurück.
KAPITEL 4
Konnte es sein, dass mir mein Leben irgendwo abhanden gekommen war? Das fragte ich mich, nachdem Stefan und Jörn mit dem VW-Bus samt Motorradanhänger vom Hof gerollt waren. Zwei große Jungs, die zufällig Nachkommen produziert hatten, auf dem Weg zu ihrem Abenteuerspielplatz. Und Mami blieb schön zu Hause und passte auf Heim, Herd und Kinder auf. Der Abschied war entsprechend kühl ausgefallen. Ich hatte Stefan die Wange zum Kuss hingehalten und seine penetrant gute Laune ignoriert. Er hatte so getan, als merke er nicht, dass ich sauer war. Es gab sowieso nur noch Wangenküsse oder spitzmündige trockene Küsschen, keine leidenschaftlichen Zungenküsse mehr. Die Kinder hatten den Abschied ihres Vaters stoisch hingenommen. Ob er am Wochenende da war oder nicht schien sie nicht sonderlich zu interessieren. Meist quälte er sich sowieso nur auf mein Drängen in ihre Kinderzimmer, um lustlos Türmchen zu bauen. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit verschwand er mal kurz im Wohnzimmer, um den aktuellen Rundenstand bei der Formel Eins – ersatzweise beim Motorrad- oder Radrennen – in Erfahrung zu bringen. Oder er sackte entkräftet auf dem Teppichboden zusammen, um ein Schläfchen zu halten. Nein, man konnte nicht sagen, dass er ein leidenschaftlicher Vater wäre. Es ging ihm um die Fassade: Da wurde vor Patienten, Bekannten und der weiteren Familie gern mit der schönen und intelligenten Frau und den niedlichen klugen Kindern geprahlt. Aber intern hielt sich die Begeisterung in Grenzen …
Trotzdem vermisste ich ihn.
Ich vermisste seine Leidenschaft, seine Hingabe. Moment. Wirklich seine? Oder Hingabe und Leidenschaft als solche? Machte ich mir nicht schon lange etwas vor? Wann war er denn überhaupt einmal richtig leidenschaftlich gewesen? War er eigentlich je in mich verliebt gewesen?
Und ich? Ich war auf dem besten Weg, eine frustrierte Hausfrau und Mama zu werden, die ihr eigenes Leben vergaß, deren Körper eintrocknete und deren Mundwinkel absackten. War ich überhaupt noch begehrenswert?
Mein Handy piepste, eine SMS. Noch war ich nicht wirklich mit der Technik vertraut, die schon wenig später das Gerüst meines Lebens darstellen würde. Ich wühlte das Gerät aus den Tiefen meiner Handtasche heraus, wo es zwischen Kekskrümeln und Bilderbüchern ein trostloses Leben fristete.
Tom. Mein Herz schlug schneller. „Hast du Lust, heut Abend etwas essen zu gehen?“ Sofort fühlte ich mich lebendig, mein Selbstmitleid verflüchtigte sich augenblicklich. Der Reiz des Verbotenen elektrisierte mich, sogar mein Kater war wie weggeblasen.
Lust ja, aber keinen Babysitter! Hektisch durchwühlte ich meine Schreibtischschublade – mein „Arbeitsplatz“ befand sich in einer Nische des Wohnzimmers, wo ich immer einen Blick auf die Kinder hatte – nach der Telefonnummer der Babysitterin. Tanjas Mutter meldete sich nach dem dritten Klingeln und holte ihre Tochter ans Telefon.
„Kannst du heute Abend auf die Kinder aufpassen? Ich weiß, es ist ein bisschen kurzfristig …“
„Tut mir leid, ich habe Musicalprobe“, flötete sie.
„Schade. Geht es wirklich nicht …?“ Meine Stimme klang schmeichelnd, fast bettelnd.
„Nein! Tut mir sehr leid.“
„Naja. Nicht so wichtig.“
„Na gut, dann komme ich Dienstag wieder!“, sagte Tanja. Dienstags gingen mein Mann und ich immer zum Tanzkurs, Standard-Latein. Ein Versuch, unsere Ehe zu beleben. Gemeinsam tanzen, hatten wir uns gedacht, wäre das richtige, um der Sinnlichkeit auf die Sprünge zu helfen. Hatte ich mir gedacht, um ehrlich zu sein, und dabei eher von Tango Argentino als von Standard geträumt.
Ich legte auf. Was tun? Meine Mutter fragen? Die konnte an einem Freitagabend so spontan garantiert nicht. Sie war immer schon Wochen im Voraus verplant, Theater, Tennis, Restaurant. Und Babysitten gehörte sowieso nicht zu den Dingen, die sie gern tat. Außerdem musste ich mir unangenehme Fragen gefallen lassen, wenn ich sie um Hilfe bat. Was ich denn ohne die Kinder tun wolle. Wo mein Ehemann denn sei.
Ich beschloss, meine Nachbarin zu fragen, ob ich nicht einfach das Babyfon bei ihr hinterlegen dürfte. Sie war zwar skeptisch, aber bereit.
„Gern! Acht Uhr? Wo?“, schrieb ich Tom schließlich zurück und kam mir unendlich verrucht vor. Zwei Abende hintereinander weggehen! Mein schlechtes Gewissen wegen der Kinder ignorierte ich einfach.
Was sollte ich nur anziehen? Ich probierte mindestens zehn Outfits an. Es sollte schlank machen, sexy aussehen, aber nicht zu bemüht, eher cool und lässig. Um zwanzig vor sieben hatte ich etwas gefunden, das mir gefiel. Schwarzes schlichtes Kleid, tiefer Ausschnitt, hohe Stiefel und offene Haare. Ich posierte vor dem Spiegel, drehte mich nach links und rechts. Perfekt!
„Mama! Mir ist schlecht …“
Ich stürzte aus dem Schlafzimmer, als ich Würggeräusche hörte, gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie Milena sich auf den Teppich im Flur erbrach. Bandnudeln mit Spinat vermischt, der typische Kotzgestank, verströmt von einem kreidebleichen Kind.
„Ach, du Ärmste!“
Mit wenigen Schritten war ich bei ihr, half ihr ins Badezimmer und dabei, sich den Mund auszuspülen und das Gesicht zu waschen.
„Geht’s wieder?“, fragte ich.
„Weiß nicht.“ Sie schüttelte sich. Ich brachte sie zu Bett, servierte Fencheltee und stellte zur Not noch eine Schüssel neben sie, falls sich das Malheur wiederholte. Dann machte ich mich in meinem schwarzen Kleid ans Aufwischen.
Der Abend war gelaufen. In diesem Zustand konnte ich sie auf keinen Fall alleinlassen. Meine Euphorie war wie weggeblasen. Ich rief Tom schweren Herzens an.
„Tut mir leid, aber heute wird es nichts. Meine Tochter hat sich übergeben.“
Hatte ich ihm überhaupt gesagt, dass ich Kinder hatte? Jedenfalls ließ er sich kein Erstaunen anmerken.
„Macht doch nichts. Ist eben so mit Kindern“, erwiderte er gelassen.
„Ja“, sagte ich. Ich hätte heulen können vor Enttäuschung. Nur mit Mühe schaffte ich es, Milena nicht die Schuld an dem verdorbenen Abend zu geben.
„Wie geht’s ihr denn jetzt?“, fragte er. Ich hörte, wie er den Rauch seiner Zigarette ausblies.
„Eigentlich nicht so schlecht. Aber ich kann sie nicht allein lassen, wer weiß, ob es noch mal passiert.“ Ich machte eine Pause, fragte dann unsicher: „Verstehst du?“
„Nein, das geht natürlich nicht. Mach die Kleine schnell wieder gesund!“
Ich atmete auf. Er klang gar nicht nach dem coolen Typ mit spitzen Stiefeln und langen Haaren, der sich die Nächte in Clubs um die Ohren schlug, sondern wie ein verständnisvoller Vater.
„Schade, ich hätte dich gern gesehen.“
„Ein anderes Mal.“
„Ja.“
Wir verabschiedeten uns und legten auf.
Natürlich erholte Milena sich schnell. Es ging ihr gut, sie hatte schon wieder Appetit. Ich machte ihr etwas zu essen, fütterte Noah und ging zu Bett. Allerdings nicht, ohne zuvor noch zwei Gläser Wein zu trinken und etliche Zigaretten zu rauchen, auf der Terrasse, nur in Gesellschaft meiner trüben Gedanken.
Stefan rief nicht mehr an.
KAPITEL 5
Als Stefan am Sonntagabend wieder kam, strotzte er vor guter Laune. Meine hingegen war auf dem Tiefpunkt. Er hatte das ganze Wochenende für sich gehabt und in Rennpausen ein-, zweimal pflichtschuldig angerufen, war aber nicht wirklich an den Geschehnissen zu Hause interessiert. Stattdessen erzählte er von Rundenzeiten und davon, in welchen Kurven er mit einem Knie auf dem Boden entlang geschrammt war. Im Hintergrund lärmten die Motorräder wie adrenalingeschwängerte Monsterhummeln. Ich konnte ihn kaum verstehen. Er mich noch viel weniger. Aber das lag nicht nur an der Lautstärke.
Ich saß mal wieder auf der Terrasse, ohne Wein, dafür mit Wasser und der ersten Zigarette des Tages. Den ganzen Sonntag über hatte ich mich kasteit. Ich hatte mit den Kindern eine Fahrradtour gemacht, war mit ihnen Eis essen gewesen – Milenas Bauch war wieder vollkommen in Ordnung. Nach einem langen Tag hatte ich den Kleinen noch gebadet und dann beide ins Bett gebracht.
Stefan stapfte um die Ecke, in seiner grün-rot-schwarzem Rennkombi, breitbeinig, den Helm in der Hand. Er strahlte, während ich griesgrämig die Mundwinkel nach unten zog.
„Hi! Na, wie geht’s?“
Mit kratzigen Bartstoppeln schrammte er mir über das Gesicht, als er versuchte, mich auf den Mund zu küssen. Ich drehte mich unter seinen Lippen weg.
„Wie soll es schon gehen? Super. War ein einsames Wochenende. Nur ich und die Kinder. Ich komme mir vor wie alleinerziehend!“, blaffte ich. „Hauptsache, du hattest Spaß!“
Ich wusste, dass das unfair war. Aber in diesem Moment konnte ich einfach nicht anders. Die Worte platzten förmlich aus mir heraus.
„Meine Güte, man könnte meinen, du hasst mich!“, erwiderte er heftig. „Nur weil ich mal nicht das mache, was du willst!“
„Was ich will?“, explodierte ich. „Als wenn es darum ginge. Du hast eine Familie, ist es da zu viel verlangt, Zeit mit ihr zu verbringen?“
„Tue ich doch! Bloß nicht an diesem Wochenende. Du bist so was von kleinkariert.“
„Ach, wann denn dann? Morgen bist du doch den ganzen Tag in der Praxis und siehst die Kinder auch nicht. Und was heißt hier eigentlich kleinkariert?“
Ich dämpfte meine Lautstärke. Vor den Kinderzimmern waren zwar Rollläden herabgelassen, die Fenster gingen aber zur Terrasse hin. Ich wollte nicht, dass sie zum Abschluss des vaterlosen Wochenendes unseren Streit mit anhören mussten.
„Ach so, klar, ich gehe ja immer in die Praxis, um mich dort selbst zu verwirklichen.“ Er betonte die letzten drei Worte genüsslich.
„Ist mir schon klar, dass das keine reine Selbstverwirklichung ist, aber immerhin hast du noch ein Leben! Erfolg, Anerkennung – und verdienst Geld!“
War das wirklich mein Problem? Dass ich mich minderwertig fühlte, weil ich nur mit den Kindern zu Hause hockte, trotz meines abgeschlossenen BWL-Studiums?
„Das ist schwer genug verdient“, zischte er und ließ sich neben mich auf die Bank fallen. „Das solltest du wissen! Sieh es mal andersherum: Du hast das Privileg, die Kinder aufwachsen zu sehen.“
„Wenn du schon die ganze Woche weg bist, sollte man ja meinen, dass du dich besonders auf die Zeit freust, wenn du sie sehen darfst. Stattdessen flüchtest du auf die Rennstrecke!“
Wir drehten uns im Kreis. Keiner wollte den anderen verstehen. Die Vorwürfe machten mich müde und mürbe.
„Darf ich nicht mal mehr ein Hobby haben? Willst du mich zu deinem Sklaven machen?“ Er sprang wieder auf und stampfte wütend auf der Terrasse herum.
„Bitte? Ich bin doch diejenige, die in Leibeigenschaft gehalten wird!“
Ich wollte jetzt doch ein Glas Wein trinken, nein, besser noch: Eine ganze Flasche. Er zerrte sich die Jacke von den Schultern und ließ sie zu Boden fallen. Darunter trug er ein durchgeschwitztes T-Shirt mit dem Aufdruck „Ich bin achtunddreißig, bitte helfen Sie mir aufs Motorrad.“
„Das ist mir alles zu blöd. Ich geh duschen. Gibt’s noch was zu essen?“
Er schob sich durch die Terrassentür und stampfte in seinen Motorradstiefeln über den Parkettboden Richtung Küche. Fassungslos starrte ich ihm nach und beobachtete, wie verkrusteter Dreck bei jedem Schritt von seinen Füßen fiel.
Die Woche ging dahin mit ihren üblichen Pflichten und Routinen. Kinder wecken, für die Schule fertig machen, sie zu ihren Hobbys fahren, Streit schlichten, Tränen trocknen, Einkaufen, Kochen, Waschen, Putzen. Wobei letzteres mangels akuter Antriebslosigkeit auf das Notwendigste beschränkt wurde. Einmal in der Woche fuhr ich zu Stefan in die Praxis, um dort seine Buchführung zu machen. Auch das war eine Rolle, in die ich mehr oder minder hinein gefallen war, als wir das Haus kaufen wollten, die Praxiseinnahmen zurückgingen und er eine Abrechnungshelferin entlassen musste. Über unseren Streit verloren wir kein Wort mehr.
In meinen erwachenden sexuellen Träumen hatte stets ein Arzt im weißen Kittel die Hauptrolle gespielt. Wählte ich daher einen angehenden Zahnarzt zum Mann, um diese Fantasien umzusetzen? Fest steht, dass Stefan eigentlich nicht in mein Beuteschema passte: Vor ihm waren es meist Jungs gewesen, die eine starke männliche Sinnlichkeit ausstrahlten. Sie trugen lange Haare, knutschen gern und viel und hatten schon mit 17 Jahren hundert Cocktails in ihrem Mixprogramm, während sie mich zum Rauchen und sexuellen Ausschweifungen verführten. Wie der besitzergreifende und extrem eifersüchtige Halbspanier, im Heim aufgewachsen und Staubsaugervertreter. Nachdem er mich vor dem Madhouse grundlos so heftig geohrfeigt hatte, dass mir das Trommelfell platzte, hatte ich genug. Der Nächste sollte vernünftig sein. Einer zum Heiraten und Kinder kriegen. So albern es klingt: Ich hatte Torschlusspanik.
Ich lernte Stefan in derselben Disko kennen. Er trug Jeansjacke, war dünn und Brillenträger. Ich fand ihn nichtssagend.
„Na, auch öfter hier?“, fragte er. Er trank eine Cola und gab vor, Zahnarzt zu sein. Als ich das nicht glaubte, sagte er: „Fast jedenfalls. Ich studiere Zahnmedizin.“
„Ich bin immer hier“, behauptete ich an dem Abend.
Dann verbrachte ich drei Monate an der Côte d’Azur als Au Pair. Als ich zurückkehrte, traf ich Stefan wieder. Er stand im Madhouse und sagte zur Begrüßung: „Du hast mich angelogen.“
„Bitte?“ Ich starrte ihn pikiert an.
„Du hast gesagt, du bist immer hier. Ich war jeden Samstag hier und hab dich nie getroffen.“
Langsam dämmerte mir, wer der Kerl war. Der Möchtegern-Zahnarzt mit der Cola. Heute trank er sogar ein Bier. Wie verwegen.
„Willst du auch eins?“ Er wackelte mit der Flasche.
Ich nickte. Schon damals mochte ich Bier nicht, fand es aber cool, an einer Flasche zu nuckeln. Zum Rauchen kam das auch besser als ein Longdrink.
Er sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Auf einmal gefiel mir das Akademische, der intellektuelle Touch an ihm. Dass er sich unser Gespräch so genau gemerkt hatte, beeindruckte mich.
„Gibst du mir deine Telefonnummer?“, fragte er zum Abschied.
Wir hatten nichts zu schreiben. Der Barkeeper sah uns nur verächtlich an, als wir ihn um einen Stift baten. Stefan wiederholte die Nummer zweimal. Wenn er sich die merken kann, gehe ich mit ihm ins Kino, dachte ich.
Am nächsten Tag rief er an.
Jahre später, wir waren schon verheiratet, hatten zwei Kinder und ein hoch belastetes Eigenheim, haben wir es ein, zweimal auf dem Behandlungsstuhl getrieben. Er gab den Arzt, ich die Patientin. Er trug seine weiße Hose, von der er nur den Reißverschluss öffnete. Ich war nicht so scharf, wie ich es sein wollte, übertünchte es aber mit umso leidenschaftlicher gespielter Begierde: „Los, Herr Doktor – besorgen Sie es mir endlich!“
Es war nicht schlecht. Aber manchmal ist es besser, wenn sich Fantasien nicht erfüllen.
KAPITEL 6
Was passiert in einer Ehe, die auf ihre Auflösung zusteuert? Ist sie wie ein leckgeschlagenes Schiff, das unweigerlich sinken wird, oder kann sie noch in der Werft repariert werden? Kann ein Blick, ein Gespräch, eine Berührung alles ändern? Oder viele Gespräche, unter professioneller Anleitung, eine Therapie, wie ich sie Jahre zuvor vorschlug?
Wir hätten zusammenbleiben können. Vielleicht hätten wir es auch sollen, der Kinder wegen, des Versprechens wegen. Immer, wenn Probleme auftraten, waren wir ein gutes Team, wenn Anfeindungen von außen auftauchten, Gefahren. Aber nicht, wenn alles dahin plätscherte. Dann suchten wir das Abenteuer, aber jeder für sich. Der eine auf der Rennstrecke, im Adrenalinrausch, die andere in der Bar, wo egostreichelnde Männerblicke und Endorphine lauerten.
„Lass uns eine Eheberatung machen“, hatte ich gebeten, als der Sex immer seltener und schaler, die wahren Gespräche immer weniger wurden.
„Warum das denn? Finde ich unnötig. Aber wenn du darauf bestehst.“ Er blätterte weiter in der Motorradzeitung, während er darauf wartete, dass die Tour de France übertragen wurde.
Ich bestand nicht darauf.
*
Eine wahre Berührung kann alles ändern. Nur kam diese nicht von Stefan.
Ich konnte nicht aufhören, an Tom zu denken. Erschwerend kam hinzu, dass ich ein obsessiver Charakter war. Egal welcher Gedanke, welches Gefühl sich in meinem Kopf festsetzte, er wuchs, wurde bestimmend, dominierte mich.
Am Donnerstag ging ich wieder ins Bereuther. Meine Freundin Carina hatte drei ehemalige Stewardessen-Kolleginnen mitgebracht, Nicole, Betty und Andrea. Sex and the City live in Hamburg. Ich bestellte eine Weinschorle, denn ich musste ja noch fahren. Die anderen drei tranken Wodka Red Bull.
Der Freund von Nicole kam immer mittwochs und sonntags zum Vögeln vorbei, sonst sahen sie sich kaum. Sie gingen nie essen, nie aus, nie war sie bei ihm. Dafür brachte er ihr von seinen zahlreichen Reisen immer Bulgari-Schmuck mit. Lief das schon unter Gefälligkeitsprostitution? Aber was wusste ich schon mit meinem biederen Leben im Vorort. Einem Leben, das ich so gewollt hatte, und das mir nun zu eng wurde wie ein eingelaufener Wollpullover, der zwickte und kratzte.
Andrea hatte sich gerade frisch die Brust vergrößern lassen. „Für Wurst-Fesche!“, lästerten die anderen, wenn sie auf dem Klo war, und starrten ihr dennoch neidisch ins Dekolleté, wenn sie zurückkam. Sie präsentierte ihre Brüste wie Trophäen.
„Wer?“ Ich war mal wieder nicht auf dem Laufenden.
„Na, ihr Kerl. Der hat eine Würstchenbude. Scheffelt ordentlich Geld“, klärte mich Carina auf.
Die dritte, Betty, hatte gar keinen Typen. Stattdessen träumte sie davon, endlich einen echten Flugkapitän aufzureißen, den sie schnellstens heiraten und mit ihm Kinder kriegen konnte. Ob sie den hier finden würde, war fraglich.
„Du musst unsere Geschichten aufschreiben!“ hatte Nicole gefordert, als Carina ihr, Betty und Andrea von meiner Schreiberei erzählt hatte. Ich grinste säuerlich, als die anderen drei mit einstimmten und mir klar wurde, dass jeder Part vergeben war und sie mich langweiliges Ehefrauchen nur als Protokollantin ihrer sexuellen Eskapaden wollten. Nicole ließ sich für Bulgari-Schmuck von ihrem dicklichen Investmentbanker vögeln, die andere ließ ihre Doppel-Ds von Wurst-Fesche befummeln, und Betty versuchte zu krampfhaft, sich ihren Piloten-Traum zu erfüllen.
Carina führte eine durch und durch unglückliche Ehe, deren erotisches Brachland sie nur überlebte, indem sie sich Trost gönnte. Also pflegte sie eine Mittwochvormittag-Vögelei mit einem Studenten.
„Mit einem Studenten?“, fragten die anderen entsetzt, als handele es sich um eine ansteckende Krankheit.
„Na, ja, er ist schon 28. Aber studiert halt noch. Jura. Es ist ein bisschen blöd, weil er in einer Studentenbude mit nur einem Zimmer haust. Aber Mittwoch ist sein Mitbewohner nicht da und ich gehe offiziell zum Sport. Dann lasse ich mich so richtig verwöhnen.“
Sie nahm einen großen Schluck und lächelte dem Barkeeper zu, der ihr ungefragt einen neuen Drink servierte.
„Ich verstehe sowieso nicht, warum du so einen Akt daraus machst, damit Lars nichts spitzkriegt“, sagte Andrea. „Der verarscht dich doch sowieso nach Strich und Faden.“
Lars hatte sie schon einmal mit der Babysitterin betrogen, einem 20-jährigen Mädchen, die Carina als Ersatzmama unter ihre Fittiche genommen hatte. Sie war der Überzeugung, dass es ein einmaliger Ausrutscher gewesen war. Alle anderen hingegen glaubten, dass es weiterlief.
„Genau, lass dich endlich scheiden!“, bekräftigte Andrea.
Carina seufzte. „Aber wenn ich mich scheiden lasse, bekomme ich kein oder höchstens nur sehr wenig Geld.“
„Wieso, ich denke, eure Eisdielen laufen so gut?“, warf ich ein. Sie prahlte immer mit den grandiosen Umsätzen des gemeinsamen Unternehmens.
Carina antwortete nicht, sondern wandte sich einem ihrer zahlreichen Bewunderer zu, die jeden Donnerstag wie die Motten zum Licht der Eppendorfer In-Bar zustrebten. Er lächelte und legte den Arm um sie, bevor er ihr einen neuen Drink bestellte.
Ich schaute mich um. Ein langer Bartresen, umlagert von den Reichen und Schönen der Stadt oder denen, die sich dafür hielten. Der Laden brummte. Es wurde getrunken und geraucht, was das Zeug hielt. Man versuchte, sich über den Lärm hinweg halbwegs sinnvoll zu unterhalten. Die Musik wurde gerade noch einmal lauter gedreht, die Barkeeper, die sich für Stars hielten, machten irgendeinen Firlefanz mit Shakern und Servietten. Im Bereuther arbeiteten nur die coolsten Barkeeper, jung, hip und sexy, eigentlich Schauspieler, Models oder Künstler in Spe. Sie wirbelten hinter der von allen Seiten zugänglichen Bar herum, schwangen Flaschen und Cocktailshaker, warfen mit Servietten, ignorierten die Geldsäcke, um die süßen Mädels – Stewardessen, Musicaldarstellerinnen, Models und Erbinnen – vorzuziehen. Wer es sich einmal mit ihnen verscherzte, konnte wochenlang nichts bestellen.
Da sah ich ihn plötzlich auf der anderen Seite der Bar. Tom. Mein Herz machte einen Sprung, Röte schoss mir ins Gesicht. Neben ihm stand die Blondine aus dem Club an der Alster. Lange hellblonde Locken, Claudia-Schiffer-Attitüde, ein blutrotes Outfit, das man nicht anders als gewagt bezeichnen konnte. Sie redete eindringlich auf ihn ein, den Mund dicht an seinem Ohr. Mir schoss mir ein Gefühl durch die Adern, das sich wie Eifersucht anfühlte. Oder ein erwachender Jagdtrieb? Er stand seitlich zum Tresen geneigt, einen Ellbogen aufgestützt. Weißes Hemd, nach hinten gekämmte Haare, Zigarette in der Hand. Manche Kerle brauchen einfach nur irgendwo zu stehen und zu rauchen, um sexy zu wirken.
Er sah mich nicht.
Ich murmelte etwas in Carinas Richtung, die mich sowieso nicht verstand, stürzte meine Weinschorle hinunter und schob mich zur Toilette vor. Dort war es noch heißer. Ich ließ mir kaltes Wasser über die Handgelenke laufen und starrte mich im Spiegel an. Für meine 35 war ich immer noch ganz hübsch, zumindest wurde das behauptet. Ich könnte als jünger durchgehen. Meine Wangen waren gerötet, ich spürte den Wein etwas.
„Herrgott, was machst du!“, sagte ich zu mir. Ich antwortete mir mit einem aufmüpfigen Blick. Hat bei mir eigentlich jemals irgendein Appell zur Mäßigung genützt?
Als ich herauskam, stand er neben der Tür. Er grinste. Ich lächelte, wie ich hoffte, cool und gelassen zurück.
„Na, sind die Kleinen wieder fit?“
„Schon lange. Wo ist deine Begleitung geblieben?“ Ich konnte es nicht lassen.
Er lachte auf. „Ach, du hast sie gesehen?“
„Sie war ja kaum zu übersehen. Schien ja ein sehr wichtiges Gespräch zu sein.“ Ich war mir selbst peinlich.
„Ach was, die will nur mit mir weggehen. Ich weiß auch nicht, wieso. Komm, was willst du trinken?“
Ich nahm eine weitere Weinschorle, die hier immer sehr groß und extrem lecker war. Er trank Wodka Tonic. Als er mir das Glas reichte, berührten sich unsere Hände. Er schaute mir tief in die Augen und zwinkerte mir zu. Seine Augen waren von einem irritierenden Blau. Ich dachte bisher, Zwinkern hätte etwas Onkelhaftes. Nicht bei ihm.
Weil es in der Bar so eng war, mussten wir dicht beieinander stehen. Wir plauderten über Belangloses. Was gibt es schon zu sagen, wenn die Hormone ihren Tanz aufführen? Wenn er sich aus der Höhe seiner 1,90 Meter zu mir hinab beugte, umwehte mich sein Duft wie ein laues Lüftchen und machte mich schier besinnungslos. Irgendein belangloser Herrenduft entfaltete sich bei ihm zu olfaktorischen Lockstoffen, gemischt mit Zigarettenrauch und Tom-pur. Meine Knie bebten. Ich war ein verdammtes Opfer. Und irgendwie hatte ich verpasst, dass es schon längst zu spät für mich war.
Ich hatte mal gelesen, dass Verlieben vor allem mit Geruch zu tun hat. Intuitiv erkennen wir, wer zu uns passt, irgendein archaisches Muster greift, das damit zu tun hat, dass sich gegensätzliche Genpools finden sollen, um gesunde Nachfahren zu zeugen. Durch die Pille wird dieses biologische Gesetz unglücklicherweise umgekehrt. Dann erschnuppern wir nicht mehr den Gegenpol, sondern den Gleichgesinnten zur Paarung.
War das der Grund für meine Ehe? Ich hatte damals die Pille genommen. Und auf Babybildern und Kleinkinderporträts sahen Stefan und ich uns geradezu verblüffend ähnlich. Hatte es daher bei uns in Krisenzeiten immer so gut geklappt, während wir in vermeintlich guten Perioden wie explodierende Galaxien auseinanderstrebten?
„Gehst du am nächsten Donnerstag mit mir essen?“, fragte Tom. „Dann musst du keine Ausrede für deinen Mann erfinden, wenn du weggehst.“
Ich überlegte. Ich will mich auf keinen Fall verlieben, hämmerte ich mir wieder ein. Das war mein Mantra. Ich wollte mit Stefan verheiratet bleiben, allein schon um der Kinder willen. Außerdem bot er mir die Sicherheit, die ich brauchte. Also wäre ein „Nein“ die richtige Antwort. Tom war zu gefährlich. Und in mich verliebt – angeblich.
„Gern!“, hörte ich mich stattdessen antworten. „Wo und wann?“
Die Begeisterung ließ meine Stimme höher klingen. Ich kiekste wie ein kleines Mädchen. Andererseits, sagte ich mir, war es doch nur ein harmloses Dinner. Das schon mal ausgefallen war, dem ich also schon zugestimmt hatte. Dass ich diese Woche über nicht mehr so sauer auf Stefan war wie zu dem Zeitpunkt, als ich der Verabredung zugestimmt hatte, spielte jetzt ja auch keine Rolle mehr. Zurechtgebastelte Logik.
„Um acht Uhr im Dexter‘s? Wir können uns aber auch irgendwo anders treffen, wenn du willst.“
„Nein, kein Problem, das finde ich. Was gibt’s denn dort zu essen?“
„Das ist ein amerikanisches Restaurant. Keine Angst, es gibt dort nicht nur Burger! Obwohl die auch sehr lecker sind.“
„Hört sich toll an.“
Ich schaute auf die Uhr. Schon fast ein Uhr. Die langbeinige Blondine hatte schon vor einer guten Stunde mit beleidigtem Blick das Weite gesucht.
„Ich muss los“, sagte ich bedauernd.
„Klar. Ist ja schon spät genug. Ich bring dich noch zum Auto. Wo stehst du?“
Zusammen verließen wir das Lokal. Wer uns sah, dachte vermutlich, Tom würde mich abschleppen. Der Weg zur Tür gestaltete sich als Spießrutenlauf, weil er noch von mindestens fünf Leuten angesprochen wurde. Katja winkte mir mit einem anzüglichen Grinsen zu. Ich lächelte zurück.
Auch der Türsteher wechselte ein paar Worte mit Tom, verabschiedete ihn mit einem „Bis morgen!“
„Bist du etwa jeden Abend hier?“, fragte ich.
„Na ja, nicht jeden. Aber da ich um die Ecke wohne, eigentlich gleich im nächsten Haus, ist das hier mehr oder weniger mein Wohnzimmer.“
Aha. Und statt einem gemütlichen Glas Wein vorm Fernseher gab es hier laute Musik und willige Frauen. Ich fing an, meine spontane Zusage zur Essenseinladung zu bereuen.
Schweigend gingen wir Richtung Isestraße, ich auf Abstand bedacht. Ich parkte unter der U-Bahnbrücke. Die Bahn polterte direkt an den schicken Altbauwohnungen vorbei, was das Wohnen hier nicht weniger teuer machte. Wenn ich – was selten genug vorkam – mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt fuhr, versuchte ich immer, in die opulent ausgestatteten Wohnungen zu schauen, Blicke in fremde Leben zu erheischen.
„Woran denkst du?“, fragte Tom.
Er hatte sich schon wieder eine Zigarette angezündet. Mir fiel nichts Besseres ein als: „Wie viele rauchst du eigentlich so am Tag?“ Lieber hätte ich fragen wollen: „Mit wie vielen Frauen schläfst du eigentlich so pro Woche?“
Er grinste amüsiert. „Knappe Schachtel. Zu viel.“
„Ich rauche drei bis fünf Stück“, gab ich zurück. Toll, wie ich mit der Beherrschung meiner Sucht prahlte, ich Kontrollfreak.
„Na, da hast du wohl heute den Vorrat für morgen gleich mitgeraucht?“, bemerkte er. Tatsächlich hatte ich quasi eine Zigarette an der anderen angezündet, immer wenn Tom mir eine anbot.
„Gut aufgepasst. Zusammen mit Alkohol verliere ich die Kontrolle übers Rauchen. Und mit Zigaretten verliere ich die Kontrolle über den Alkohol.“ Und über mich selbst auch …
„Kannst du denn noch fahren? Sonst lass dein Auto lieber stehen und nimm dir ein Taxi!“
Seine Besorgnis schmeichelte mir. Aber was sollte ich Stefan sagen? Dass ich mir die Kante gegeben hatte und mich von einem langhaarigen Bombenleger, zu dem ich mich ausgesprochen hingezogen fühlte, in ein Taxi hatte verfrachten lassen? Wohl kaum. Außerdem waren es ja nur drei Weinschorlen gewesen.
„Klar!“ Ich hatte mein Auto, das sich zwischen zwei Porsche Cayenne versteckte, endlich gefunden. Harvestehude war wirklich nur von den Reichen und Schönen bevölkert – oder zumindest nur von den Reichen, den Autos nach zu urteilen.
Wir standen uns gegenüber und schauten uns an. Ich wusste nicht wohin mit meinen Händen. Es war einsam und dunkel, doch anders als im Club an der Alster, wo ich mich willig in seine Umarmung geschmiegt hatte, war ich nun befangen.
„Danke für den netten Abend und die Getränke“, sagte ich förmlich.
„Dafür nicht. War schön mit dir. Komm gut nach Hause“, gab er zurück. Sein Duft hüllte mich ein und machte mich ganz schwindelig. Er beugte sich vor und umarmte mich so vorsichtig, als wäre ich ein frisch geschlüpftes Küken. Ich saugte seine Nähe auf. Ich hätte noch die halbe Nacht so hier stehen können, löste mich aber wieder von ihm. Behutsam küsste er mich auf die Wange. Dabei fiel mir auf, dass er entweder frisch rasiert war oder wenig Bartwuchs hatte. Stefan kratzte abends schon wieder, wenn er sich morgens rasiert hatte.
Der Gedanke an Stefan ließ mich schnell ins Auto steigen. Plötzlich hatte ich es eilig, zu meiner hoffentlich fest schlafenden, nichts Böses ahnenden Familie zurückzukehren. Während sie selig schlummerten, trieb sich ihre Mutter und Ehefrau in dunklen Bars herum, aufgeheizt von Genussdrogen und verbotenen Gedanken.
Im Rückspiegel sah ich ihn dort stehen, in seinem weißen Hemd hatte er etwas Leuchtturmartiges. Er war so groß, dass ich mir neben ihm mädchenhaft zart vorkam … Ich stellte den CD-Player an, drehte voll auf und fuhr davon, ohne es mir noch einmal zu erlauben, in den Rückspiegel zu sehen.
KAPITEL 7
Die Woche ging schneller vorüber als gedacht. Milena lag drei Tage mit einer schweren Erkältung im Bett, ich maß Fieber, kochte Tee und Lieblingsessen, besorgte Zeitschriften und CDs, verabreichte Hustensaft und nötigte sie zu inhalieren. Mittwoch ging es ihr besser, Donnerstag wollte sie wieder zur Schule. Noah mit seinen Bombenabwehrkräften dank langem Stillen steckte sich nicht an. Dafür Stefan, obwohl er kaum Kontakt zu Milena gehabt hatte. Er hatte zwar kein Fieber, schniefte, hustete und litt jedoch um so heftiger. Nachts schnarchte er noch mehr als sonst, sodass ich ihn durch meine fast den gesamten Gehörgang ausfüllenden Ohropax immer noch deutlich hören konnte. Wenn ich nachts zum x-ten Mal erwachte, versuchte ich ihn dazu zu bewegen, sich vom Rücken auf die Seite zu drehen, was er im Halbschlaf mit unwilligem Murren quittierte.
Manchmal war ich so geschafft und wütend zugleich, dass ich ihn trat. Wachte er dann auf, wusste er meistens nicht, was ihn geweckt hatte, und drehte sich lammfromm um.
Am Donnerstagnachmittag stand ich wieder unschlüssig vor meinem Kleiderschrank, bevor ich mich für das Outfit entschied, das ich schon für unsere geplatzte Essensverabredung vorgesehen hatte.
Ich bereitete den Kindern ihr Abendbrot zu, aß selbst nur einen Joghurt. Während die Kinder sich um die Fernbedienung zankten – Milena setzte sich wie fast immer durch – verschwand ich im Schlafzimmer, um mich aufzuhübschen. Stefan rief an und sagte, dass er später käme. Normalerweise regte ich mich darüber oft auf, aber als er sagte: „Bin in zehn Minuten da, du kannst ja schon mal losfahren“, war ich erleichtert, ihn vorher nicht mehr sehen zu müssen. Ich wollte keine Fragen beantworten, er sollte mich nicht sehen … je weniger Möglichkeiten zu lügen, desto besser. Offiziell ging ich heute mit den Mädels essen.
Ich küsste die Kinder, die mich kaum ansahen, und fuhr los. Auf dem Weg in die Stadt versuchte ich mir einzubilden, jung und ungebunden zu sein, das Leben verheißungsvoll vor mir liegen zu haben. Als wenn die Weichen noch nicht gestellt wären und eine Vielzahl möglicher Wege offen stünden.
Erstaunlicherweise fand ich nach kurzem Suchen einen Parkplatz am Mittelweg. Hier, in einer von Hamburgs Top-Lagen, wohnte die Upper Class. Alle anderen statteten den Bars, Restaurants und Geschäften nur einen kurzen Besuch ab, um dann wieder zu verschwinden. Einst hatte ich davon geträumt, hier auch mal zu wohnen.
Als ich die Tür zum Dexter‘s öffnete, sah ich ihn sofort. Er saß an einem kleinen Tisch vor einer türkis gestrichenen Wand und spielte mit seinem Handy. Er trug ein verwaschenes Hemd und zerrissene Jeans, die langen Beine vorgestreckt, an den Füßen die unvermeidlichen Cowboystiefel, diesmal in Hellbeige – wie viele Paar hatte er eigentlich davon? Seine Haare schimmerten noch feucht vom Duschen. Er sah auf und lächelte mir entgegen. Ich fühlte mich falsch angezogen. Overdressed. Alle anderen Gäste trugen irgendetwas Lässiges, Jeans, Hemden, Blusen. Nur ich hatte ein schwarzes Kleid an und kniehohe, spitze Stiefel. Zu aufgetakelt, zu gewollt. Am liebsten wäre ich umgekehrt. Aber ich ging weiter auf ihn zu. Er erhob sich zur Begrüßung, küsste mich auf die Wange. Keine Umarmung, nur eine flüchtige Duftdusche. Wir setzten uns einander gegenüber.
Mir fiel auf, dass er etwas von einem Fuchs hatte, die Nase, das etwas spitze Gesicht. Auf einmal fand ich ihn gar nicht mehr so attraktiv. Er war kein schöner Mann, eher hatte er etwas Eigenes, Unverkennbares, das ihn von der Masse der einheitlich gestylten Bürohengste abhob, die sich sonst gern in Bars herumtrieben.
„Und, heute alle fit zu Hause?“
„Ja, gesund und munter“, gab ich zurück.
Er trank schon einen Caipirinha und winkte dem Barkeeper, um für mich auch einen zu bestellen. Wir rauchten und plauderten über dies und das, seine Arbeit, meine Kinder. Nur Stefan mieden wir, obwohl er wusste, dass ich verheiratet war. Bei unserem ersten längeren Flirt hatte ich reflexartig versucht, mich hinter Stefan und dem Image der braven Hausfrau, die einmal die Woche in die große Stadt durfte, zu verstecken. Hatte wohl nicht viel genützt. Langsam entspannte ich mich.
Als das Essen kam – er hatte eine Vorspeisenplatte für uns beide zusammen bestellt –, merkte ich den Alkohol schon. Es gab hauptsächlich frittierte Sachen, die alle gleich aussahen. Blumenkohl und Zwiebelringe in einer dicken, leicht muffig schmeckenden Teigkruste, scharfe Hähnchenteile und Spareribs, die man in seltsame Soßen stippte.
„Schmeckt es dir nicht?“, fragte er.
„Na ja, geht so, ist nicht so ganz mein Fall.“
„Das tut mir leid. Sollen wir was anderes bestellen?“ Dabei winkte er dem Barkeeper zu, der prompt zwei neue Caipis vor uns abstellte.
„Das bisschen, was ich esse, kann ich auch trinken!“, lachte ich.
Sein Handy piepte. Er warf keinen Blick aus Display.
„Willst du gar nicht wissen, wer dir schreibt?“, fragte ich.
„Nee, aber du scheinbar!“
Er öffnete die Nachricht und zeigte sie mir: „Sehen wir uns nachher? Absender: Brigitta.“
Bestimmt der B-Movie mit den langen blonden Haaren. Meine Stimmung verdüsterte sich.
„Hast du was mit der?“
„Ach was. Nicht wirklich. Das ist nur freundschaftlich.“
Ich erinnerte mich an das Telefonat, das wir Montag geführt hatten. Wir hatten ein bisschen herumgeflachst. Er war noch verabredet, sagte aber nicht, mit wem. Ich hatte ihn auf möglichen Drogenkonsum angesprochen und er hatte scherzhaft geantwortet, er träfe sich mit seiner Dealerin. Mir schwante, wer diese Dealerin war.
„Triffst du dich noch mit anderen Frauen?“, fragte ich in möglichst lockerem Tonfall.
„Na ja, mit der kleinen Blonden war ich eine Zeitlang zusammen. Nichts Ernstes. Sie war es sogar, die zu mir gesagt hat, ich solle doch mal zu dir hingehen, weil ich dich immer angeschaut habe.“
„Wie, deine Freundin schlägt dir so was vor?“
Ich trank mein Glas aus und nahm noch eine Zigarette aus der Packung.
„Zu dem Zeitpunkt lief da schon nichts mehr. Ich sagte dir ja, dass ich seit der Trennung von Anja nichts Festes habe.“
Er stieß den Rauch aus und beobachtete mich. „Noch einen?“ Er zeigte auf die leeren Gläser.
Ich zögerte. Mein benebelter Verstand sagte Nein, wurde aber von dem Strudel aus mehr Alkohol, mehr Zigaretten überstimmt. Ich nickte. Er zog mich unvermittelt auf dem Stuhl zu sich heran und küsste mich ganz zart auf die Lippen. Ich wehrte mich nicht.
„Ich konnte mich nicht mehr richtig verlieben, verstehst du?“ Er lächelte mich an, streichelte mir über den Unterarm, dessen Härchen sich sofort aufrichteten.
„Aha. Und mit dieser Brigitta, was ist nun mit der?“
„Nichts! Wir haben uns ein, zweimal gesehen, das war alles.“
Ich schielte auf sein Handy.
„Hier, du kannst es ruhig lesen, was sie mir geschrieben hat. Ist kein Geheimnis.“ Er klappte das Telefon auf, blätterte durch den Posteingang.
„Nein!“, wehrte ich ab, linste aber doch neugierig auf das Display. Die vorletzte SMS endete mit den Worten „ich wär jetzt auch gern in deinem arm.“ Ich schluckte. Mein Mund war trocken. Von wegen „nichts“!
„Na, zufrieden?“, fragte er.
„Klar“, gab ich mich cool. Eigentlich wollte ich nun nichts mehr trinken, in meinem Kopf sauste eine Achterbahn, die mich dunkel daran erinnerte, dass ich noch fahren musste. „Was meint sie denn mit dem letzten Satz?“
„Keine Ahnung.“
„Na, wenn sie ‚auch‘ schreibt, musst du ihr ja vorher dasselbe geschrieben haben, oder etwas ähnliches.“
Er zuckte die Achseln. „Kann mich nicht erinnern.“
Ich stütze mich auf dem Tisch ab und fixierte das übrig gebliebene Essen. Das meiste hatte er davon gegessen. Kein Wunder, dass er vom Alkohol nichts zu merken schien, während ich nahezu betrunken war. Die Champignons tanzten auf dem Teller. Ich schnappte mir einen davon und steckte ihn in den Mund. Kalt, aber gar nicht so übel, wenn man von der dicken Panade absah. Ich aß noch einen und noch einen. Amüsiert sah er mir zu.
„Noch Hunger?“
Ich schüttelte den Kopf. Sein Gesicht war plötzlich ganz nah. So nah, dass ich seine irritierend hellblauen Augen hinter den Brillengläsern und die etwas zu groß geratene, leicht gerötete Nase sah. Er hatte ziemlich schmale Lippen, fiel mir bei näherer Betrachtung auf. Ich kam nicht dazu, länger darüber nachzudenken, denn die Lippen küssten mich plötzlich. Es war ein langer Kuss, den ich nicht willenlos geschehen ließ, sondern eifrig erwiderte, wie mir nach geraumer Zeit bewusst wurde. Es war ein sehr guter Kuss.
Danach grinsten wir einander verschwörerisch zu. Es war mir ein bisschen peinlich, in einem Lokal zu knutschen, aber anscheinend interessierte es niemanden. Also beugte ich mich vor, um ihn gleich noch mal zu küssen.
Als wir damit fertig waren, hatte ich vergessen, was ich fragen wollte. Komischerweise war ich auch gar nicht mehr sauer wegen der SMS, sondern eher belustigt. Und außerdem: Was ging es mich an? Ich war diejenige, die verheiratet war.
„Wollen wir noch woanders hin?“, fragte er.
Ich erschrak. Kam jetzt die Stelle mit dem Abschleppen? Oh Gott! Wieso hatte ich ihn geküsst, ihm damit zu verstehen gegeben, dass ich bereit dafür war?
„Ins Curio-Haus, meine ich? Da ist donnerstags auch immer eine Party, zu der ich schon länger mal wollte. Aber bisher bin ich immer in meinem Wohnzimmer hängen geblieben und habe gehofft, dass du auftauchst“, ergänzte er.
Ich atmete auf. „Ja, warum nicht. Aber ich kann nicht so lange.“
„Klar, aber es ist ja erst halb elf. Sonst kommst du doch auch nicht so früh nach Hause – wir wollen doch deinen Mann nicht beunruhigen.“
Wir standen auf. Der Boden schwankte gewaltig. Ich strauchelte auf den kippeligen Stiefeln hinter Tom her, der bezahlte und mir dann in den Mantel half. Draußen pustete uns eine steife Brise beinah um.
„Kalt!“, jaulte ich auf, als mir der Wind unter das Kleid fuhr. Wie selbstverständlich legte er mir den Arm um die Taille. Meine Schulter passte unter seine Achsel. Wir torkelten den Weg entlang, wobei wir unterwegs ein paarmal anhielten, um den Kuss zu wiederholen. Im Stehen, an ihn gelehnt, fühlte es sich noch besser an. Und die Skrupel nahmen von Kuss zu Kuss ab: Ist nun eh schon passiert, da schadet ein weiteres Mal ja auch nicht, sagte ich mir jedes Mal danach. Alkohol wirkt enthemmend, überlegte ich schwerfällig, während wir uns aneinander lehnten. Aber wenn ich ehrlich war, hatte ich das doch geahnt, wenn nicht gar gewollt, als ich hierher gefahren war.
Ein kleines Abenteuer.
Wir erreichten seinen Wagen, einen schwarzen PT Cruiser, der wie die Neuauflage eines antiquierten Taxis wirkte und irgendwie so gar nicht zu ihm passte. Er öffnete mir die Tür, reichte mir den Gurt, bevor er auf seine Seite ging und seine langen Beine ins Wageninnere faltete.
„Seltsames Auto“, bemerkte ich.
Er lachte. „Inwiefern seltsam?“
„Na ja, irgendwie passt sowas eher zu Frauen aus dem Alstertal.“
„Firmenwagen. Ich fand den süß, mal was anderes.“
Ich kicherte albern über das Wort ‚süß‘.
Als wir beim Curio-Haus ankamen, war dort nicht mehr viel los. Komischerweise war es auch schon halb zwölf und ich rätselte, wo die Zeit geblieben war. War der Weg so lang gewesen? Hatten wir so ausgiebig geknutscht? Ich wusste es nicht. Wir küssten uns weiter. Es war, als hätten wir vorher nur füreinander geübt. Die perfekten Küsse. Normalerweise muss man sich erst aufeinander einküssen, weil der andere entweder die Zunge zu wenig einsetzt, oder zu nass oder zu spitzmündig küsst. Vielleicht saugt er auch an den Lippen, oder der Kuss wird papiertrocken wie eine verstaubte Akte. Manche stülpen einem auch ihren Mund über, als würden sie an einer Orangensaftflasche nuckeln, andere vollführen akrobatische Kunststücke mit ihren Zungen. Es gibt tausend Arten, einen Kuss zu verderben.
Entweder hatten wir dieselbe Vorstellung davon, wie ein perfekter Kuss sein müsste, oder wir passten außergewöhnlich gut zueinander. Oder er war sehr geübt und extrem feinfühlig. Küsse lügen nie.
Als ich am nächsten Morgen erwachte, fühlte ich mich wie gerädert. Ich hatte mich hin- und her gewälzt, geschwitzt und mit der Decke gekämpft, immer wieder Wasser getrunken wie eine Verdurstende, während meine Leber mit den Verfehlungen des vorangegangenen Abends fertig zu werden versuchte. Ich wälzte mich aus dem Bett und verfluchte mich. Wie viele Caipis waren es eigentlich gewesen? Und wie hatte ich in diesem Zustand noch Auto fahren können? Ich erinnerte mich, wie ich angestrengt auf die Straße gestarrt hatte, die immer wieder zur Seite wegzukippen schien, als wäre sie aus flüssigem Quecksilber. Ich war absolut verantwortungslos gewesen. Menschen hätten zu Schaden kommen können! Als ich endlich zu Hause ankam, war der Carport geschrumpft, sodass ich mein Auto regelrecht hinein quetschen musste.
Nun dröhnte mein Kopf, als würden dort permanent Bauarbeiten durchgeführt. Die Vorarbeiter schrien einander über den Lärm hinweg an, während der Betonmischer sich rasselnd drehte.
„War es schön?“, erkundigte sich Stefan, während er seinen Tee schlürfte, mit süffisantem Grinsen. Diesmal konnte ich den Kater nicht verbergen.
„Ja, ganz nett“, gab ich zurück, während ich meine Hände zwang, sinnvolle Dinge mit dem Pausenbrot der Kinder zu veranstalten.
Milena war heute Morgen ungewöhnlich schweigsam und schaufelte mit grimmigem Gesichtsausdruck Schokoflakes in sich hinein, während Noah die Pistazienstücke aus der Wurst puhlte.
„Wo wart ihr?“
War es meinem schlechten Gewissen geschuldet, oder war Stefan heute interessierter als sonst? Er schaute mich mit Röntgenblick an.
„Essen im Lentini, und dann im Bereuther, wie immer.“
Ich goss mir noch ein Glas Wasser ein. Milena war auf dem Grund ihrer Schüssel angekommen und quietschte mit dem Löffel über den Boden, ein Geräusch, das die Bauarbeiter in meinem Kopf dazu veranlasste, den Presslufthammer anzuwerfen.
„Milena, bitte“, jammerte ich.
„Mama hat Kopfschmerzen“, konstatierte Stefan süffisant.
Ich biss die Zähne zusammen und packte lächelnd Brote in die Plastikboxen. Ich musste nur noch eine Viertelstunde durchhalten.
„Echt, warum?“ fragte Milena.
„Mama hat gestern zu viel Wein getrunken“, erklärte Stefan. Alle blickten mich so entsetzt an, als hinge mir noch die Nadel vom letzten Schuss im Arm.
„Allohol?“, fragte Noah.
„Ein bisschen“, gab ich kleinlaut zu.
„Das ist aber nicht gut. Hatten wir gerade in der Schule. Man wird sehr schnell abhängig“, warnte Milena.
„Du hast Recht. Das war leichtsinnig von mir. Aber jetzt musst du in die Schule“, beendete ich das Gespräch, bevor meine Familie mir noch nahelegte, ein Treffen der Anonymen Alkoholiker aufzusuchen.
Als die drei weg waren, konnte ich mich endlich hemmungslos meinem selbstverursachten Leid hingeben. Schon der Gedanke an Wein oder Zigaretten löste spontane Übelkeitsattacken aus. Ich trank noch einen Liter Wasser, nahm zwei Kopfschmerztabletten, stellte die Waschmaschine an, räumte die Küche auf und schleppte mich dann ins Bett. Dort begrub ich meine Stirn unter einem Eisbeutel und hoffte, damit auch die Gedanken zu betäuben, die mich hartnäckig bedrängten.
Ich hatte mit einem anderen Mann geknutscht. Und zwar ausschweifend. Es hatte sich gut angefühlt, doch nun schien alles falsch. Wie konnte ich nur? Mein innerer Moralapostel begann, mir einen langen und komplizierten Vortrag zu halten, über gebrochene Versprechen, Lügen und Betrug. Doch auf der anderen Seite saß der respektlose Klassenclown, breit grinsend und sich auf die Schenkel klopfend. Ich hätte doch fremdvögeln wollen – und nun mache ich schon nach ein bisschen Knutschen schlapp? Er kommentierte den Vortrag des Moralapostels so lange mit sarkastischen Bemerkungen, bis dieser rot anlief, seine Unterlagen zusammenpackte und empört das Rednerpult verließ. Ich fiel in einen Dämmerzustand, in dem ich vor mich hinvegetierte, während die Aufräumarbeiten in meinem Körper andauerten.
Das Summen meines Handys weckte mich. Ich hatte das Gerät im Lautlosmodus in meine Nachttischschublade gepackt, aus Angst, dass Stefan eine SMS von Tom entdecken könnte, die den Betrug aufdeckte, bevor er richtig begonnen hatte. Ich war eine verdammt schlechte Lügnerin, die schon bei der kleinsten Unwahrheit rot wurde, zu Boden blickte, ungeschickte Ablenkungsmanöver vollführte. Jeder mit ein wenig psychologischer Menschenkenntnis hätte mich sofort entlarvt. Zum Glück hatte Stefan das nicht. Püschologen, wie er sie verächtlich nannte, waren in seinen Augen Spinner und Weicheier, die in der Vergangenheit ihrer Patienten herumkramten und nur bemüht waren, Probleme zu kreieren, die es gar nicht gab.
Ich nahm das Handy aus der Schublade. „wie geht es dir? bist du gut nach haus gekommen? küsschen“, lautete die SMS von Tom.
„wir haben gestern geknutscht … das leben ist schön“, schrieb ich zurück, sank mit einem zufriedenen Grinsen zurück auf das Kissen und schloss die Augen.
Abends fand das Laternenfest in Noahs Kindergarten statt. Zu viert stiegen wir in Stefans Wagen, ausgerüstet mit herbstfester Kleidung und mehreren Laternen. Noah und Milena hatten auf Batterielichter bestanden, weil sie Angst hatten, dass ihre Laternen in Brand geraten könnten. In der Dämmerung, die sich bald in Dunkelheit verwandelte, stapften wir durch den Wald. Stefan nahm meine Hand und wir schlenderten plaudernd dahin. Man hätte uns für ein ganz normales, sogar glückliches Ehepaar halten können, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, dass auf meiner Stirn „Ehebrecherin“ stand, in einer Farbe geschrieben, die sichtbar wurde, wenn man nur das richtige Licht anknipste – so, wie bei Schwarzlicht Kontaktlinsenträger zu Aliens wurden und jeder Fussel auf der Kleidung leuchtete.
Doch anscheinend hatte niemand eine entsprechende Lampe dabei. Alle behandelten mich normal, sodass ich mich allmählich entspannte und mir selbst vorzugaukeln begann, dass eigentlich gar nichts geschehen wäre. Wenn nur nicht immer wieder Erinnerungen aufblitzen würden, Schlaglichter unserer Knutscherei.
„Möchtest du auch ein Glas Wein?“, fragte Stefan. Wir waren beim Kindergarten-Bauwagen angekommen. Die Kindergartenmütter hatten Gulaschkanonen voller Kürbis- und Tomatensuppe gekocht, auf mit Papiertischdecken geschmückten Tapeziertischen standen Schüsseln voller Nudelsalat. Hotte, der Leiter des Waldkindergartens, lief aufgeregt um einen behelfsmäßigen Grill herum und ließ eine mit Brennspiritus induzierte Stichflamme auflodern, weil er zu ungeduldig war, um auf das langsame Anglimmen des Feuers zu warten. Fünf oder sechs Kinder sprangen mit einem Aufschrei zurück und retteten ihre Marshmallows, die an angespitzten Stöcken steckten.
„Wein, hmm, ich weiß nicht.“
Mein Kopf war gerade wieder etwas klarer geworden, nachdem ich den ganzen Tag Mühe gehabt hatte, ihn durch die Türrahmen zu kriegen.
Stefan ging zu dem Getränketisch. Ich hörte, wie er sich mit einem anderen Vater über die Vor- und Nachteile des Motorradfahrens auf der Straße und auf der Rennstrecke unterhielt.
„Auf der Rennstrecke ist es viel sicherer“, hörte ich ihn im Brustton der Überzeugung sagen. „Da fahren nämlich nur Leute, die es können.“
Der andere erwiderte irgendetwas.
„Nein, ich fahre fast gar nicht mehr Straße“, behauptete Stefan. Da verdrängte er wohl die zahlreichen Wochenenden, wenn er sehnsüchtig aus dem Fenster starrte und gutes Motorradwetter abwartete, um dann los zu düsen.
„… noch eine weitere Duc … 948.“ Nur noch Wortfetzen drangen zu mir. Ich winkte Noah zu, der mit einem kleinen Mädchen am Rand der Sandkiste saß und an einer Laugenbrezel knabberte.
„Mir ist langweilig“, nölte Milena. Ich konnte sie ja verstehen, außer Hottes Tochter waren fast nur Kleinkinder und ihre Eltern da.
„Wir bleiben nicht mehr lange“, versprach ich.
Annett, eine andere Mutter, ließ sich neben mich plumpsen. Ihr Sohn war einer der Rabauken, die Noah nicht mochte. Trotzdem hatten wir uns schon ein paarmal nachmittags getroffen, weil wir Mütter einander nett fanden. Wenn er mit Noah allein war, benahm Kilian sich sogar halbwegs erträglich, wenn man von gelegentlichen Schreiattacken absah, in denen er seine Mutter auf das Übelste beschimpfte. Annett, die früher Chefeinkäuferin bei Otto gewesen und durch die ganze Welt gejettet war, ließ sich das mit einem resignierten Lächeln gefallen.
„Puh“, stieß sie aus und zündete sich eine Zigarette an. „Kilian ist heute echt schlecht drauf.“
Ich hatte keine Lust, nachzufragen, sondern nickte nur verständnisvoll. Kilian rannte gerade mit einem Stock bewaffnet hinter Philipp her und ahmte ein Maschinengewehr nach. Hotte, der Kindergärtner, schritt ein und entwaffnete ihn, gerade als er das Gewehr in eine Machete umfunktionieren wollte. Er redete auf Kilian ein, der sich heulend und um sich schlagend in seinem Griff wand. Der Vater, ein gutmütiger Riese von fast zwei Metern, kam hinzu und nahm seinen Sohn in Obhut, der sich wie ein rotschöpfiges Äffchen an ihn klammerte und Hotte die Zunge herausstreckte.
„Ich brauch ein Glas Wein“, seufzte Annett, die alles beobachtet hatte.
Gerade kam Stefan zurück, bewaffnet mit zwei Plastikbechern voll Weißwein. Ich überließ Annett meinen Becher und beschloss, die Kürbissuppe zu probieren. Die Kindergartenmütter hatten sich selbst übertroffen, sie schmeckte hervorragend, so gut, dass ich mir doch noch einen Becher Wein genehmigte. Komischerweise schmeckte sogar die Zigarette dazu.
KAPITEL 8
Mein Herz probierte neue Tanzschritte aus, als ich wieder und wieder die letzte SMS von Tom las. Er schlug vor, dass ich ihn am Samstagabend auf ein Glas Wein besuchen käme. Nach der Knutscherei von Donnerstag konnte es eigentlich nur noch gefährlicher werden. Oder besser.
Vorsorglich kaufte ich Kondome und versteckte sie in einer Kaugummidose. Die Packung warf ich weg, nachdem ich mich mehrmals umgeschaut hatte, ob mich auch niemand beobachtete.
Carina rief an. Ich erzählte ihr von dem Caipi-Knutschabend.
„Ich weiß nicht, ob ich wirklich zu ihm gehen soll“, gab ich zu.
„Natürlich gehst du hin!“, erwiderte sie. „Los, Motte, was soll denn groß passieren?“
„Na ja …“
„Also bitte. Das wolltest du doch! Du wolltest doch eine kleine Affäre! Du hast es selbst oft genug gesagt!“
„Schon. Aber ich bin hin- und hergerissen und fühle mich böse. Ich betrüge meinen Ehemann!“
„Ach Quatsch. Ist doch gar nichts passiert. Und wenn du irgendwas nicht willst, kannst du doch ‚Nein‘ sagen. Wir sind doch nicht mehr fünfzehn.“
„Hmmm. Ich brauch‘ dich aber als Alibi.“
„Kein Problem, dann können wir uns gegenseitig eins geben. Ich bin auch verabredet.“
„Mit Mittwoch?“ Ich hatte den Namen des Jurastudenten vergessen.
Sie lachte. „Nein, viel besser. Ich hab jemand kennen gelernt, der ist total süß …“
Sie geriet ins Schwärmen und beschrieb ausführlich den aktuellen Traumtypen. Es waren grundsätzlich Märchenprinzen, die sie kennen lernte, schön, klug, reich, und ihr vollkommen verfallen, bis das Blatt sich wendete und herauskam, dass er entweder verheiratet, pleite, bösartig oder betrügerisch war. Ich kannte das schon zur Genüge und hörte nicht mehr zu. Stattdessen dachte ich an Tom und an kommenden Samstag. Meine Entscheidung stand längst fest: Ich würde zu ihm fahren. Ich konnte gar nicht anders, es war wie mit Wein und Zigaretten: Ich war gefangen in einem Sog, der mich stetig zu ihm hinzog. Und gleichzeitig hoffte ich, wider besseren Wissens, dass es hinterher keinen Katzenjammer gab.
Samstag war der 8. November. Die Kinder spielten in ihren Zimmern und Stefan schaltete den Fernseher ein. Ich hatte befürchtet, dass er es nicht gut finden würde, wenn ich schon wieder ausging, aber es war ihm egal. Ich zog mich um, bemüht, nicht zu aufgetakelt zu erscheinen. Ein schwarzes Kleid? Nein, Bluse und Jeans zu Stiefeln mit hohen Absätzen. Als ich mich von Stefan verabschiedete, sah er mich kaum an. Im Gegenteil, er linste an mir vorbei, weil ich ihm kurzfristig den Blick auf den Bildschirm versperrte. Ärger schnürte mir die Kehle zu.
„Ich geh dann jetzt!“, sagte ich.
Er gab mir geistesabwesend einen Kuss auf die Wange. „Ja, viel Spaß. Wen triffst du noch gleich?“
„Carina.“
„Grüß schön. Boah! Hast du das gesehen!“
Er sprang von der Couch auf. Auf dem Bildschirm hatte sich gerade ein besonders spektakuläres Überholmanöver ereignet. Ich seufzte und drehte mich um. Ohne einen Blick zurück verließ ich das Haus.
Als ich ins Auto stieg, zitterten meine Beine vor Aufregung. Das Bibbern hielt die ganze Fahrt über an, erst, als ich einen Parkplatz gefunden hatte – wie durch ein Wunder fuhr gerade jemand vor dem Haus weg – hörte es auf. Ich ging in den Innenhof, von dem mehrere kleine Apartmenthäuser abzweigten, zwei- und dreigeschossig, efeuberankt, romantisch beleuchtet. Hinter einigen Fenstern sah man Menschen, andere waren dunkel. Ich betrachtete mich wie von außen. Eine nicht mehr ganz junge, aber noch recht attraktive Frau mit einem Ehering, der auf dem Ringfinger der Hand brannte, die den Klingelknopf des Hinterhauses in Eppendorf drückte, auf dem Weg zum geplanten Ehebruch. Ich redete mir ein, dass alles ganz harmlos wäre, nur ein Glas Wein unter Freunden, ein wenig Prickeln und Knutschen vielleicht, eine kleine, völlig unbedeutende Affäre mit einmaligem Fremdvögeln irgendwann.
Mir wurde die Banalität der Situation, in der ich mich gerade befand, bewusst. Tausende von Ehefrauen, die ihrer Ehe überdrüssig sind, deren Leidenschaft sich angesichts von Bergen benutzter Unterhosen, vollgekackter Babywindeln, sarkastischer Bemerkungen und liebloser Gesten abgekühlt war, taten in diesem Moment dasselbe. Sie klingelten an der Haustür ihres Liebhabers und brachen aus ihrem Leben aus. In meinem Fall war es noch der potenzielle Liebhaber, ein Mann, von dem ich nicht viel mehr wusste, als dass er auf merkwürdige Art attraktiv war, einen hohen Frauenverschleiß und Alkoholkonsum hatte, der rauchte, seitdem er dreizehn war, keine Kinder hatte, nie verheiratet gewesen war und beruflich irgendwie selbstständig ohne umwerfenden materiellen Erfolg. Genau das Richtige für mich, Mrs. Perfect, mit durchgeplantem Leben. Für jemanden wie mich, die sogar ihre Garderobe eine Woche im Voraus festlegte und sich mit 17 Gedanken darüber gemacht hatte, dass es für den großen Lebenserfolg schon zu spät war, jemanden wie mich, die mit 25 aus Torschlusspanik und Vernunftgründen geheiratet hatte – einen Mann, der zum Versorger taugte und ihren Eltern gefiel.
Ich klingelte. Der Türöffner summte und ich trat in das schummrig beleuchtete Treppenhaus. Weiße Wände, der Geruch nach frisch gekochtem Essen, hinter der Tür im Erdgeschoss erklangen leise Stimmen, Gläserklirren. Ich stieg die Treppe hinauf in den ersten Stock.
Er lehnte im Türrahmen, lässig die Beine gekreuzt, zerrissene Jeans und Jeanshemd, die Haare aus der Stirn gekämmt und noch feucht vom Duschen, und lächelte mir entgegen. Er wirkte groß und fremd. Plötzlich kam es mir seltsam vor, dass ich mit diesem Fremden geknutscht hatte und ihn an einem Samstagabend freiwillig in seiner Wohnung besuchte. Ich fühlte mich fehl am Platze, uncool und spießig, die Mami aus der Vorstadt, und wusste nichts Besseres zu sagen als „Hallo“. Sein „Hallo“ klang weich und warm. Er wollte mich zur Begrüßung umarmen, doch ich zuckte – ungewollt? – zurück und gab ihm ein steifes Küsschen auf die Wange.
„Hier wohnst du also“, sagte ich überflüssigerweise.
„Ja, übergangsweise. Die Wohnung gehört eigentlich der Mutter eines Freundes und war gerade frei. Daher ist sie auch möbliert – die Einrichtung ist nicht so ganz mein Fall.“
Er führte mich an einer kleinen Küche vorbei, die ich nur flüchtig wahrnahm, am Schlafzimmer, das offenstand – ich sah eine auf dem Boden liegende Doppelmatratze – ins Wohnzimmer.
„Sind nur zwei Zimmer“, sagte er entschuldigend.
Links waren ein kleiner Tisch und ein Regal, rechts ein weißes Sofa mit einem niedrigen Couchtisch davor. Kerzen, die überall standen, selbst auf der Fensterbank, erleuchteten den Raum. Leise lief eine ruhige Lounge-Musik, ein Beamer warf einen tonlosen Film an die weiße Wand. Ich stand verlegen im Zimmer herum und wusste nicht, wohin mit meinen Händen.
„Hübsch“, sagte ich.
„Findest du? Na ja, wie gesagt, ist nur übergangsweise. Ich suche was eigenes, denn ich weiß ja nicht, wann Frank die Wohnung zurück haben will.“
Er lächelte und machte einen Schritt auf mich zu. Mir wurde mulmig, ich wich zurück.
„Setz dich doch!“
Er wies auf das weiße Sofa. Wenn ihm meine Distanziertheit auffiel, wusste er das jedenfalls zu überspielen. Ich setzte mich. Sofort sank ich ein. Was so massiv ausgesehen hatte, erwies sich als schwabbeliges Schaumstoffmonstrum von der Konsistenz eines Marshmallows. Es war auch nicht wirklich weiß, er hatte nur ein Laken darüber gebreitet. Er setzte sich neben mich und goss Wein ein. Seine pure Nähe trieb meinen Puls in die Höhe. Am liebsten hätte ich an ihm geschnuppert. Er roch wieder so gut.
„Du trinkst doch noch Wein, oder?“, fragte er und reichte mir das Glas.
„Klar!“ Ich lächelte, wie ich hoffte, kokett und erhob mein Glas. Leise klirrte er mit seinem dagegen.
Wir tranken ein paar Schlucke, er schenkte nach, wir tranken noch einen Schluck. Wir plauderten über dies und das. Wir rauchten. Er bot mir Zigaretten aus einem Klappspender an, der aus den 50er Jahren stammte. Allmählich entspannte ich mich. Auf einem Nierentischchen stand ein Zigarettenigel, auch aus den Fünfzigern, daneben tummelten sich verschiedene Porzellanaschenbecher. Ich kam mir dekadent und verrucht vor, in der Wohnung zu rauchen. Wir stießen blaue Rauchwolken aus, die sich im Licht des Stummfilms, der immer noch an die Wand geworfen wurde, langsam drehten, sich zu Spiralen umeinander schlangen. Er blies mit geöffnetem Mund Rauchringe aus, kichernd versuchte ich es nachzumachen. Ich fühlte mich wie sechzehn.
Irgendwie waren wir vom Sofa heruntergerutscht und hockten nun auf dem Boden davor, berührten uns an den Schultern. Seine körperliche Präsenz war mir überbewusst. Durch den Alkohol stellte sich die Vertrautheit wieder ein, meine Skrupel, all meine Bedenken waren wie weggeblasen, ertrunken im Wein. Ich wollte vergessen, wer ich war, meinen Alltag mit den beiden Kindern und meinem Ehemann. Es war alles seltsam weit weg, wie ein Traum von einem anderen Leben. Was war real, was nicht? Nichts war wichtig außer diesem Abend, diesem Ping-Pong-Gespräch über Nichtigkeiten. Dem Jetzt, das sich unendlich ausdehnte. Worüber sprachen wir? Unsere Worte hüpften von einem Thema zum anderen, berührten dies und jenes, wie Bienen, die von einer zur anderen Blüte schwirrten. Vielleicht hatte ich einfach keine Übung in diesen Dingen, dass mir alles so besonders vorkam. Ich spürte meinen enormen Appetit, mein erotisches Ausgehungert-Sein.
Irgendwann beendeten wir unsere Sätze mit Küssen statt mit Satzzeichen. Wir ergänzten unsere Worte mit Küssen, garnierten die Schlucke aus dem Weinglas mit Küssen. Ein Wort ergab das andere, ein Kuss den nächsten. Schlückchen für Küsschen, zart, spielerisch, neckend, lockend. Wer lockte wen? Wir redeten und tranken, rauchten und küssten, bis die Worte weniger und die Küsse mehr wurden. Berührungen kamen dazu, Finger, Hände, die warm über die Haut wanderten, forschten, strichen, streichelten. Wir berührten einander, Haut an Haut, Mund an Mund, Fingerkuppen, die Gesichtszüge erforschten, die Nackenlinie nachzeichneten, die Wirbel zählten. Küsse. Lippen, Zungen, die miteinander spielten, und alle Zeit der Welt. Eine Oase aus Zeit und Küssen.
Wir umarmten einander, Arme und Beine ineinander verschlungen, irgendwie landeten wir wieder auf dem Sofa, tranken noch ein Glas Wein, rauchten eine Zigarette, redeten, küssten. Ich hatte noch kein einziges Kleidungsstück ausgezogen. Die Minuten vertropften, unsere Küsse wurden leidenschaftlicher, inniger, die Worte weniger, Hände gingen wieder auf die Reise, eine Bluse fiel, ein Hemd. Irgendwann rutschte auch meine Jeans nach unten. Seine blieb an. Gewissen gerettet, kein Sex. Kein Fremdvögeln. Nur Küssen. Und ein bisschen mehr. Nichts geschah und alles.
Hatten wir nun eine Affäre? Ja, es war eine nette kleine Affäre, beschied ich, als ich es um halb zwei Uhr endlich schaffte, von der Couch aufzustehen. Gerade hatte sein Handy geklingelt, dann das Telefon. Das Signal, das mich zurückholte, das Signal zum Aufbruch. Er wollte nicht rangehen, es sei niemand wichtiges. Bloß irgendjemand, der noch mit ihm weggehen wollte. Er küsste mich wieder sanft, hypnotisch. Ich schmolz dahin wie Schokolade in der Sonne. Nie war die Couchanziehungskraft so stark gewesen wie in diesem Moment. Zwei, drei Mal fiel ich zurück, als ich schon stand, zurück in seine Arme.
„Bleib doch noch …“
„Nur ein paar Minuten…“ Und einige Küsse. Und noch ein paar.
Um halb drei war ich endlich im Auto, eine weitere halbe Stunde wie in einem Luftkissenboot nach Hause gesegelt, ins Bett zu meinem Ehemann. Keine Gedanken, kein schlechtes Gewissen trübten meine Fahrt. Es waren ja nur Hormone, beruhigte ich mich. Das war ja der Sinn einer kleinen harmlosen Affäre: Dass man sich gut fühlte.
KAPITEL 9
Der nächste Morgen stellte hohe Anforderungen an mein schauspielerisches Talent. Ich war nun mal eine grottenschlechte Lügnerin.
„Wie war es denn gestern?“
„Äh. Gut.“
„Und wie geht es Carina? Was macht ihr Verhältnis?“
Meine Alarmglocken schrillten. Was hatte ich ihm erzählt? Nun, da ich selbst auf eine Affäre zusteuerte, kam es mir nicht nur illoyal, sondern vor allem gefährlich vor, ihm davon erzählt zu haben.
„Keine Ahnung. Ich glaube, das ist vorbei.“
„Echt? Hat sie sich wieder mit ihrem Mann vertragen?“
Was sollte ich sagen? Ich wusste, dass er gelegentlich in das Eiscafé fuhr und mit Lars plauderte. Und wenn der ihm sagte, dass Carina gestern Abend gar nicht mit mir unterwegs gewesen war? Schweißausbruch. Aber wir hatten uns ja gegenseitig decken wollen.
„Nee, bisher nicht so wirklich. Aber sie will es scheinbar noch mal mit ihm versuchen.“
„Na, ein Glück, dass sie wieder zur Besinnung gekommen ist. Ein so schlechter Kerl ist er ja nicht, und für die Kinder wäre es ja auch besser, wenn die sich wieder zusammenraufen.“
Wieso war Stefan heute nur so redselig? So interessiert an den Beziehungen anderer? Normalweise kümmerte er sich kaum um seine eigene. Nein, das war ungerecht. Wir waren ihm natürlich nicht egal. Auch ich war ihm nicht egal. Er hatte mich nur einfach als sicher abgehakt. Verheiratet, verhaftet, daran gab es nichts zu rütteln. Und auch nichts zu entwickeln. Ich rührte schon den dritten Löffel Zucker in meinen Tee.
„Seit wann nimmst du so viel Zucker?“
„Da hab ich heut mal Lust drauf.“
„Dann hast du keinen Kater?“, bohrte er.
Nein, ich hatte keinen Kater vom Wein, nicht mal von der Unmenge an Zigaretten. Und schon gar nicht vom Knutschen. Vielleicht war das ein Gegenmittel. Tatsächlich hatte ich mich schon lange nicht mehr so gut gefühlt.
Ich war böse. Aber das waren auch andere. Carina zum Beispiel. Oder Bärbel, eine Urlaubsbekanntschaft, die in der Nähe wohnte und ihren Mann seit Jahren betrog. Sie alle holten sich sinnlichen Input von außen, um ihre Ehe überhaupt durchstehen zu können. Warum sollte es also bei mir anders sein? Was war überhaupt falsch daran? Eigentlich war ja auch noch gar nichts passiert.
Nachmittags kippte meine Stimmung. Die Sonne, die am Vormittag noch spätsommerlich warm geschienen hatte, war nach dem Mittagessen wie beleidigt hinter Wolken verschwunden. Stefan hatte den Vormittag in der Garage verbracht, die Kinder waren in ihren Zimmern geheimnisvollen Beschäftigungen nachgegangen, ich hatte mich ein bisschen mit Wäschewaschen beschäftigt, Essen vorbereiten und viel auf mein Handy gestarrt. Keine SMS von ihm. Wahrscheinlich schlief er noch. Ich wusste, dass er gern lange schlief.
Davon abgesehen – konnte, durfte ich zuerst schreiben? Wie lautete der Kodex für verheiratete Frauen, die dabei waren, sich einen Liebhaber zuzulegen? Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, dass ich wie besessen auf eine SMS wartete. Hungerte. Gierte. Nach dem Essen wollten wir mit den Kindern ein Eis essen gehen, einen Cappuccino trinken, und ich meine erste Zigarette an diesem Tag rauchen.
Als ich im Badezimmer war und mich schminkte, setzte sich auf einmal ein Puzzle zusammen, dessen Teile die ganze Zeit offen vor mir gelegen hatten. Teil 1: Dieses blonde Gift aus der Disko und der Bar, nennen wir sie Barbie. Teil 2: Seine SMS an sie. Teil 3: ihre SMS an ihn mit dem „Im Arm liegen“. Teil 4: die Telefonanrufe. Teil 5: das Klingeln gestern Nacht, als wir uns auf der Couch herumwälzten. Teil 6: sein lachend vorgebrachtes Argument, er würde sich mit seiner „Dealerin“ treffen. Sechs Teile, ein Kinderpuzzle, und ich war zu doof gewesen. Dealerin wofür? Sex! Natürlich! Wie konnte ich nur so blöd sein! Der hatte was mit ihr gehabt! Und das lief immer noch? Kalter Schweiß brach mir aus. Konnte das sein? Fuhr der Kerl wirklich doppelgleisig? Obwohl er angeblich in mich verliebt war? Wurde ich nun schon von meiner Affäre betrogen, bevor sie begonnen hatte? Andererseits: Wer war ich, dass ich darüber urteilen durfte? Und überhaupt: Was kümmerte es mich eigentlich?
Doch, verdammt, es kümmerte mich, und es tat weh.
An dieser Stelle hätte jede vernunftbegabte Frau die Notbremse gezogen und die Mobilnummer des bösen Buben gelöscht. Sie hätte sich den Zahn selbst gezogen, bevor er anfing zu eitern. Potenzielle Affären konnte man in jeder Bar auftun, man musste sich nicht mit jemandem einlassen, der einen verarschte, um seinen Ehemann zu hintergehen.
Aber ich konnte ihn nicht loslassen.
Ich schickte ihm eine SMS. Natürlich kein geschmeidiger Morgengruß nach kuschelig verbrachtem Abend, sondern eine eiskalt formulierte Darlegung meiner Vermutung, dass nicht nur Küsse zwischen ihnen gewesen wären. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Mit zitternden Fingern öffnete ich den kleinen virtuellen Umschlag, der die SMS verpackte: „küsse ... und mehr.“
Mein Hals wurde staubtrocken. Blut rauschte mir in den Ohren. Also stimmte es. Wusste ich es doch. Ich Idiot. Ich dummes, naives Ding. Ich Landei! Hatte geglaubt, mich mit einem Hallodri einzulassen, dessen Finger- und Zungenfertigkeit auf lange, intensive Übung schließen ließen und hatte gehofft, ihn binnen fünf Minuten zu zähmen.
Ich stürmte aus dem Bad und rannte in den Garten. Zum Glück waren die Kinder in ihren Zimmern und Stefan immer noch in der Garage oder im Keller. Ich musste das klären! Natürlich wusste ich, dass es dumm war, ihn jetzt anzurufen, wo ich in einem Gefühlssturm dahin torkelte. Einerseits randvoll mit Endorphinen vom Kussmarathon, andererseits aufgebracht, verletzt. Obwohl meine Familie quasi hinter mir stand und jederzeit aufkreuzen konnte, während ich am Handy mein geheimes Leben verhandelte, rief ich ihn an.
„Wie kannst du nur!“, schrie ich statt einer Begrüßung ins Telefon. Meine Stimme überschlug sich.
„Es tut mir leid. Ich wusste zu dem Zeitpunkt ja nicht, ob aus uns etwas wird“, nuschelte er betreten.
„Ach, und da hast du gedacht, doppelt hält besser? Lieber zwei Eisen im Feuer, besser zwei verheiratete Frauen vögeln, als gar keine!“, krächzte ich wütend.
„Ich habe doch gar nicht mit dir geschlafen.“
Ich schnaubte. „Ein Glück! Ich blöde Kuh hätte es fast getan!“
„Ich aber nicht. Denn mit dir ist es etwas Besonderes.“
„Toll! Super! Dass ich nicht lache! Für wie bescheuert hältst du mich denn? Meinst du, deine zuckersüßen Komplimente funktionieren jetzt noch beim braven Weibchen aus der Vorstadt?“
„Für überhaupt nicht bescheuert, sondern für sehr intelligent und toll und hübsch und süß. Für einen Engel. Für meinen Engel!“
„Spar dir deine Worte! Dein Süßholzgeraspel brauche ich nicht! Ich will diesen Scheiß nicht hören! Und ich Idiotin frage dich x-mal, ob du was mit der hattest. Und du lügst mich immer wieder an. Warum? Das hättest du dir doch sparen können. Am Donnerstag hast du mir noch geschworen, dass nichts ist!“
Ich stampfte wütend um die Rutsche herum und trat das letzte bisschen Rasen platt. Wenn mich nun jemand hörte? Oder sah? Mittlerweile liefen mir die Tränen herunter. Ich warf einen hektischen Blick zu Milenas Fenster, das glücklicherweise geschlossen war.
„Hör zu, es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ich werde das mit ihr sofort beenden.“
Ich hörte sein Feuerzeug klicken, ihn dann an der Zigarette ziehen. Er hatte mich vollkommen verarscht! Und nichts Besseres zu tun, als zu rauchen.
„Brauchst du nicht!“, schnappte ich. „Für dich hätte ich fast meine Ehe aufs Spiel gesetzt. Dass ich das getan hätte! Nach so vielen Jahren! Ich will dich nie wiedersehen!“
„Wirf es nicht weg. Bitte.“
„Doch, genau das tue ich jetzt!“
„Nein, ich bitte dich, ich flehe dich an. Tu das nicht. Geh nicht! Wirf es nicht weg.“ Seine Stimme zitterte. „Mit ihr, das ist nichts. Sie ist nicht so wie du.“
„Wie konnte ich nur so dämlich sein!“
Ich wusste nicht, ob ich mich mehr über mich oder ihn ärgerte.
„Ich kann nur wiederholen, dass es mir unendlich leid tut, dass ich dir nicht die Wahrheit gesagt habe und dass ich ihr heute noch sagen werde, dass ich sie nicht mehr sehen will, weil ich mich in dich verliebt habe.“
„Vergiss es! Verliebt, ja klar! Wie soll ich dir glauben? “
Ich stampfte wie Rumpelstilzchen mit dem Fuß auf, bevor es sich selbst mittendurchreißt.
„Selbst wenn es mit uns nichts wird, werde ich es ihr auf jeden Fall sagen …“, hörte ich ihn sagen. Ich versuchte, mich innerlich zu wappnen, ich wollte ihm nicht mehr zuhören, mich nicht einlullen lassen. „Glaub mir, mein Engel, bitte. Du kannst natürlich wütend sein, aber bitte glaub mir eines: Sie bedeutet mir nichts! …“
Jemand berührte meinen Arm. Ich zuckte zusammen. „Mama?“ Noah stand neben mir und sah mich mit großen Augen an. „Was ist denn?“
Ich schluchzte auf, drückte die Auflegen-Taste, was Toms Liebesschwüre jäh unterbrach, und nahm meinen Kleinen in den Arm, saugte den süßen Duft seines Kinderhaares auf.
„Nicht, mein Süßer. Ich hab mich nur ein bisschen gestritten.“
„Mit wem denn?“
„Mit …“ Jetzt kam der Moment, wo ich meinen Kleinen belügen musste. „Mit Carina. Weil sie gemein zu mir war.“ Etwas Blöderes fiel mir auf die Schnelle nicht ein.
„Wollen wir denn jetzt los?“ Stefan stand in der Terrassentür. Ich wischte mir die Tränen aus dem Gesicht.
Er kam näher, schien aber nicht zu bemerken, in welchem katastrophalen Zustand ich war.
„Mama hat sich mit Carina gestritten“, erklärte Noah.
„Ach ja? Nicht so schlimm“, erwiderte Stefan und tätschelte mir geistesabwesend die Schulter. In diesem Moment war ich dankbar für seine Blindheit. Ein anderer Mann hätte nachgehakt. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht schliff sich die Sensibilität jedes Ehemannes mit den Jahren ab. Ich hatte keine Vergleiche.
„Ich muss nur noch mal kurz ins Bad“, sagte ich. „Zieht doch schon mal Schuhe und Jacken an, wir können gleich los.“
Ich flüchtete ins Bad, wo ich die Heulspuren übertünchte. Das Handy brannte in meiner Hosentasche. Ich zog es hervor und klickte auf das Adressbuch. Ich hatte Tom unter „Tamara“ abgespeichert. Ein alter Trick von Carina, die davor gewarnt hatte, Männer unter ihrem richtigen Namen zu speichern, weil früher oder später jeder misstrauisch gewordene Ehemann das Handy seiner Frau ausspionierte, wie sie sagte. Ich wählte „Eintrag löschen“. Nur ein Druck meines Zeigefingers und alle Spuren wären getilgt. Nicht die in meinem Herzen, natürlich, wo diese Knutscherei schon schlimme Folgen hinterlassen hatte. Ich zögerte. Und klickte. „Eintrag wirklich unwiderruflich löschen?“, insistierte das Handy. Jemand klopfte an die Badezimmertüre.
„Mama! Was machst du denn so lange?“, rief Milena.
„Ja, ich komme!“ Ich zögerte und steckte das Handy wieder in die Tasche.
Hand in Hand gingen wir zum Alstertaleinkaufszentrum. Stefan erzählte die ganze Zeit etwas von Motoren und den dazugehörigen Modellen, überlegte laut, welche Maschine er sich am liebsten kaufen würde, plante seinen nächsten Wochenendtrip auf die Rennstrecke. Ich nickte nur und gab an den richtigen Stellen ein „Aha“ und „Mhhm“ dazu. Falls er sich wunderte, dass ich das ungeliebte Thema nicht im Keim erstickte, ließ er sich nichts anmerken. Ich war nur froh, dass er redete und sagte mir immer wieder, dass ich erleichtert sein könnte, dass ich diesen Affären-Schwindler so schnell enttarnt hatte, dass ich nun wieder mit ganzem Herzen zu meiner Familie zurückkehren würde. Auch wenn Stefan nicht gerade ein hingebungsvoller Liebhaber war, konnte man sich doch auf ihn verlassen. Und gerade weil er sich eben mehr für Motoren als für Frauen interessierte, konnte ich mir sicher sein, dass er mich nicht hintergehen würde. Ich hatte doch alles, ich wollte mich nun zufrieden geben und nicht immer nach den Kirschen in Nachbars Garten lechzen!
Wir fuhren die Rolltreppe in den ersten Stock hinauf, suchten uns einen Tisch und bestellten Cappuccino und Eisbecher. Das Handy vibrierte dabei unentwegt in meiner Hosentasche. Ich hatte es auf stumm geschaltet, aber Anrufe und SMS kamen nicht komplett unbemerkt an.
Ich rauchte eine Zigarette zum Cappuccino, während meine Familie wie immer keinen Hehl daraus machte, dass sie meine Sucht abstoßend bis unerträglich fand. Noah wedelte mir vor dem Gesicht herum, Milena rümpfte die Nase und Stefan hustete demonstrativ. Wenn ich meine Kinder durch mein schlechtes Beispiel zu Nichtrauchern erzog, war das ja auch nicht verkehrt. Aber wahrscheinlich würde Milena als Jugendliche auch anfangen zu rauchen, zu kiffen und Schlimmeres zu tun – und mir die Schuld daran geben.
Die Eisbecher kamen und die Kinder begannen, sich zu kabbeln und zu treten. Ich ließ das Gerangel über mich ergehen, denn es lenkte mich von dem Gefühlswirrwarr in meinem Inneren ab. Einerseits hasste ich Tom und wollte ihn nie wiedersehen, fühlte mich verletzt und enttäuscht, andererseits wollte ich ihn anrufen und ihm sagen, dass ich uns auch nicht aufgeben wollte. In welcher Position war ich denn, von ihm vorweggenommene Treue zu verlangen? Ich hatte von Anfang an kein Geheimnis daraus gemacht, dass ich verheiratet war und an meiner Ehe festzuhalten gedachte. Dass ich ihn höchstens als kleines Abenteuer ansah.
„Mama! Du hast gekleckert!“
Milena wies auf einen dicken Fleck auf meiner Bluse.
„Oh.“ Ich wischte halbherzig mit einer Serviette daran herum.
„Ich mach das mal kurz auf der Toilette weg“, sagte ich und stand auf. In der Kabine hatte ich es eilig mein Handy zu konsultieren. Drei Anrufe in Abwesenheit. Gut so. Eine SMS: „es tut mir so leid. ich bin ein schuft. ich werde das regeln, das verspreche ich. küsschen“
Ich schrieb zurück: „lass mich in ruhe. bin mit meiner familie eis essen.“
Dann rubbelte ich energisch an dem Fleck herum. Er ging nicht weg.
Kaum waren wir zu Hause, schaltete ich das Handy aus, um in Ruhe auf der Couch mit Stefan zu sitzen und Tatort zu schauen. Während der Film über den Bildschirm flimmerte, spulte sich in meinem Kopf eine private Filmrolle ab, unterbrochen von Standbildern: Tom, wie er mich ansah. Sich vorbeugte, im Begriff mich zu küssen. Wie er kurz vor meinen Lippen innehielt und den Moment hinauszögerte. Während Kommissarin Lena Odenthal den Mörder einer Neunjährigen jagte, spürte ich immer wieder seine Lippen, roch seinen Duft, der mich von Anfang an betört hatte. Anscheinend reagierte mein limbisches System auf seins. Niedere Instinkte, versuchte ich mir einzureden. Nur eine körperliche Reaktion.
Als der Abspann kam, merkte ich, dass die Handlung vollkommen an mir vorbeigegangen war. Wer war denn nun der Täter? Stefan schien auch nichts mitbekommen zu haben. Er plapperte vor sich hin, Motorradthemen. Oder? Er sah mich fragend an, anscheinend wartete er auf eine Antwort.
„Was hast du gesagt?“, fragte ich.
„Schatz, du hörst mir ja gar nicht zu!“, imitierte er mich grinsend. Wie oft hatte ich das zu ihm gesagt. Wie oft hatte ich neben ihm gesessen, auf der Couch, im Auto, am Esstisch ihm gegenüber und hatte erzählt und nur diesen geistesabwesenden Blick geerntet, mit dem ich ihn jetzt wahrscheinlich auch ansah.
„Äh, tut mir leid“, murmelte ich.
„Macht ja nichts!“Er war heute wirklich ausnehmend guter Laune. „Ich hatte gefragt, was wir eigentlich im Sommer machen. Willst du aufs Yoga Festival?“
Ich staunte. Seit wann plante er so weit im Voraus? Und seit wann wollte er freiwillig aufs Yoga Festival fahren?
„Keine Ahnung. Ist ja noch lange hin. Warum?“
„Naja … Weil ich endlich mal nach Assen wollte. Und das ist im Juli.“
„Assen?“
„Du weißt doch, dieses Fünf-Tage-Rennen. Da wollte ich schon letztes Jahr hin. Ich war da noch nie!“
Natürlich ging es mal wieder um Motorräder, und nicht um mich. Ich seufzte. Mir war alles egal. Ich hätte mich auch in ein Wohnmobil verpacken und mitsamt den Kindern und einem Karton voller Raviolidosen neben der Rennstrecke parken lassen.
„Wenn du willst.“
So viel Resignation und so wenig Gegenwehr schienen Stefan unheimlich. Er sah mich zweifelnd an, knuffte mich dann aufmunternd in den Oberarm.
„Na, wir können ja mal sehen. War nur so eine Idee!“
Gemeinsam erhoben wir uns und machten uns in unser Ehebett auf, ausnahmsweise mal gleichzeitig. Doch während er in Sekundenschnelle in den tiefen Schlaf derer fiel, die mit sich im Reinen sind, lag ich stundenlang wach. Ein gutes Gewissen ist eben doch das beste Ruhekissen. Und meins war rabenschwarz. Nicht nur das, in meiner Brust kämpften Wut, Eifersucht, Schmerz und Sehnsucht miteinander.
KAPITEL 10
Der Montagmorgen kam und mit ihm fielen meine guten Vorsätze. Das erste, was ich tat, als Stefan und die Kinder aus dem Haus waren, war, das Handy anzuschalten. Tom hatte mir vier SMS geschickt. Ich las sie der Reihe nach.
16.54 h: „es tut mir so leid. ich habe nicht mit dir gespielt. ich will nicht, dass es so endet.“
19.15 h: „ich treff mich gleich mit ihr und werde ihr alles sagen. dass ich mich in dich verliebt habe und sie nicht mehr sehen will.“
22.31 h: „gesagt, getan. bitte melde dich doch. ich möchte wissen, wie es dir geht.“
1.38 h: „du fehlst mir. ich könnte verstehen, wenn du nichts mehr von mir wissen willst. ich küsse und umarme dich.“
Ich ließ mich auf den Badezimmerboden plumpsen, wo ich gerade dabei gewesen war, die Schmutzwäsche zu sortieren. Dort blieb ich sitzen, las die Nachrichten immer wieder und versuchte, meine Gefühle zu ordnen. Ja, ich wollte ihn wiedersehen, ich wollte ihn nicht verlieren.
Wieso eigentlich verlieren? Es war doch nur eine Affäre im Anfangsstadium. Nicht mehr. Es durfte nicht mehr sein. Wenn ich klug war, würde ich erst die SMS löschen, dann seine Nummer, und mich wieder auf mein Leben konzentrieren. Ja, das würde ich tun. Das Übel an der Wurzel ausreißen. Ich löschte die erste SMS, dann die zweite, die dritte. Bei der vierten zögerte ich. Dann löschte ich sie auch. Beim Eintrag in das Telefonbuch dasselbe Spiel wie am Vortag: Löschen, ja, wirklich unwiderruflich löschen, nein. Verdammt!
Ich ging in die Küche und füllte Kaffeepulver in die Maschine. Als ich den Wasserhahn aufdrehte, klingelte mein Handy. Vor Schreck ließ ich es ins Waschbecken fallen und drehte schnell das Wasser zu. Tom. Unter enormer Willensanstrengung ließ ich es klingeln. Zweimal, dreimal. Ich hatte keine Mailbox aktiviert, daher würde es endlos klingeln, so lange, bis er die Geduld verlor. Oder ich die Nerven. Es klingelte achtmal, dann verstummte es. Ich wusste nicht, ob ich enttäuscht oder erleichtert war, und füllte endlich Wasser ein, als es erneut zu klingeln begann.
Diesmal ging ich gleich ran – ich konnte nicht mehr.
„Ja?“ Ich bemühte mich, wenigstens so zu tun, als wäre ich cool.
„Nun bin ich aber erleichtert. Ich dachte schon, du sprichst nicht mehr mit mir. Oder hast meine Nummer gelöscht.“
„Ehrlich gesagt, war ich kurz davor.“ Eigentlich sollte ich gar nicht mit diesem Mann sprechen. Er war gefährlich, gemein und unehrlich.
„Hast du meine Nachrichten bekommen?“
Seine Stimme klang warm, einfühlsam, nach dunkler Schokolade, einem warmen Vollbad, einer Fußmassage.
„Ja.“
Meine Antwort sollte kurz und schnippisch klingen.
„Ich habe alles geklärt“, behauptete er. „Noch gestern Abend habe ich sie getroffen und die Sache bereinigt. Und nun hoffe ich, dass du mir verzeihst. Dass du mir noch eine Chance gibst, dir zu beweisen, wie viel mir an dir liegt.“
„Und wie hat sie reagiert?“, hörte ich mich fragen.
„Na ja … sie war schon enttäuscht. Es tat mir auch leid für sie. Sie hat es ja nicht verdient, so schlecht behandelt zu werden.“
Ich versuchte nicht, Mitgefühl zu heucheln. Ehrlich gesagt, war mir der Seelenzustand von Barbie vollkommen egal. Was machte sie sich auch an einen Kerl ran, den ich zu meinem zukünftigen Liebhaber auserkoren hatte? Mein Seelenzustand hingegen besserte sich mit jedem Satz, den wir wechselten. Ich war bereit, mich wieder um den Finger wickeln zu lassen.
„Wann sehe ich dich denn wieder?“, fragte Tom. Seine erotische Anziehungskraft versagte nicht mal durchs Telefon. Wie sollte ich da standhalten?
„Weiß nicht. Vielleicht irgendwann mal wieder im Bereuther“, zierte ich mich. Dabei wussten wir beide, dass ich schon verloren hatte.
„Diesen Donnerstag? Aber das ist noch so lange hin. Heute ist erst Montag. Drei lange Tage!“
„Diesen Donnerstag habe ich Elternabend“, behauptete ich. Er sollte leiden. „Nächste Woche.“
„Was? Dann soll ich noch länger warten?“, jammerte er. „Das halte ich nicht aus!“
„Tja, musst du wohl.“
Ich goss Kaffee in einen Becher, fügte Milch hinzu und hörte mir an, wie sehr er litt, wenn er mich nicht eher sah. Mein geprügeltes Ego dehnte und streckte sich genüsslich, räkelte sich wie eine Katze in der Sonne.
Wir tändelten noch ein wenig herum. Ich hätte an keinem Abend Zeit, beharrte ich, und nachmittags wären die Kinder da.
„Dann morgen zum Frühstück!“, schlug er vor.
„Morgen gehe ich zum Sport, und überhaupt, Frühstück? Musst du denn gar nicht arbeiten?“
„Ich kann mir das selbst einteilen. Das ist das Gute an der Selbständigkeit!“
Wann hatte Stefan das zuletzt gemacht? Einen Vormittag mit mir verbracht, sich Zeit für mich genommen, während die Kinder in Schule und Kindergarten waren? Hatte er das überhaupt mal getan? Na ja, er musste schließlich auch für eine vierköpfige Familie sorgen, im Gegensatz zu Tom, der nur sich selbst zu ernähren hatte.
Ich zögerte.
„Morgen um neun? Dann ist der Kleine doch im Kindergarten und du hast bis mittags Zeit!“, schmeichelte er.
„Nein, ich sagte doch, morgen geht nicht.“
„Mittwoch? Donnerstag? Sag mir wann.“
„Donnerstag“, gab ich nach. Ich nahm einen großen Schluck Kaffee und verbrannte mir prompt die Zunge.
„Toll! Ich freu mich auf dich. Was magst du? Kaffee, Prosecco, Brötchen, Salate, Käse, Lachs? Warte, ich schreibe gleich einen Einkaufszettel …“
Und so gab ich mich geschlagen. Als wir auflegten, fühlte ich mich beschwingt, beschwipst, leicht wie ein Sommerlüftchen. Mein schlechtes Gewissen packte ich wie einen Wintermantel in die hinterste Kammer meines Kopfes. Stefan und ich hatten alle Krisen in unserer Ehe gemeistert. Jetzt, wo alles lief wie am Schnürchen, hatten wir uns nichts mehr zu sagen, mussten nicht mehr kämpfen, und widmeten uns eben unseren Passionen: Er dem Motorradfahren, ich dem Flirten, dem Verlieben, dem Sex. Einer kleinen Affäre. So lange wir zumindest die Fassade einer glücklichen, erfüllten Ehe aufrechterhielten, war doch nichts dabei, redete ich mir ein. Dabei nagte an den Grundmauern Fäulnis und unterhöhlte das Fundament, bis unsere Ehe nur noch Fassade war.
Andere leben mit solcher Fassade Jahre, Jahrzehnte, arrangieren sich, leben nebeneinander her. Das ist ja nichts Unübliches. Dass Ehe und sexuelle Liebe zusammengehen müssen, ist eine romantisch überfrachtete Vorstellung unserer Zeit. So stellte ich mir das auch vor. Für ihn seine Motorräder, für mich eine kleine Vögelei.
In Wirklichkeit trudelte ich auf einen Abgrund zu. Eigentlich tat ich das schon seit geraumer Zeit. Im Grunde schon, seit mir bewusst wurde, dass ich Stefan zwar liebte, und dass er die beste Wahl als Vater meiner Kinder war, aber niemand, der mein sexuelles Begehren wach halten konnte. Ich hatte einen Teil meiner Selbst verleugnet, und das über Jahre. Ab dem Moment, als ich meine Vernunft wie einen Turbo dazuschaltete, um den stockenden Motor meines Verliebtseins anzukurbeln, hatte ich den verrückten, verspielten Teil meiner Selbst in eine Schublade gepackt, sie gut verschlossen und den Schlüssel weggeworfen.
„Was hast du heut Morgen so vor?“, fragte Stefan am Donnerstag, als wir mit den Kindern am Frühstückstisch saßen.
Ich zuckte innerlich zusammen und bemühte mich, gleichmütig dreinzuschauen. Normalerweise fragte er doch nie, was ich machte!
„Wieso?“, fragte ich zurück.
„Nur so. Gehst du zum Sport?“
Da ich schon gestylt und geschminkt war, konnte ich das ja wohl schlecht behaupten. „Nee, ich wollte nachher ins AEZ, mit Carina einen Kaffee trinken und nach Herbstsachen für die Kinder gucken“, log ich.
„Ah, dann grüß sie mal!“
„Deshalb fahre ich Noah auch selbst in den Kindergarten, dann brauchst du keinen Umweg zu machen“, ergänzte ich.
Stefan schien nicht misstrauisch. Ich musste mir ein bisschen mehr Coolness zulegen, wenn ich diese Lügerei länger als fünf Minuten durchhalten wollte.
Kaum waren Milena und Stefan gegangen, bugsierte ich Noah in seinen Kindersitz. Er lächelte mich an und zog an meinen Haaren, als ich den Sicherheitsgurt um ihn schloss. Ich kitzelte ihn und gab ihm kleine Pusteküsse auf den Hals. Er kicherte und gluckste. Wie ich dieses Kind liebte. Wieder stieg ein dicker Kloß in meiner Kehle auf. Irgendwie betrog ich ja auch den Kleinen. Ich fühlte mich wie der böse Wolf, der sich die Pfote weiß anmalt und mit verstellter Stimme um Einlass begehrt, weil er die Geißlein fressen will.
Um diese Gedanken zu vertreiben, stellte ich Noahs Lieblings-CD auf volle Lautstärke. Während Rolf Zuckowski den „Kleinen Tag“ brüllte, kutschierte ich das Kind zum Kindergarten.
Ich lieferte ihn dort ab und sauste zu meinem Auto. Es war ein sonderbares Gefühl, tagsüber in die Stadt zu fahren, auf dem Weg zu einem Rendezvous. Schlimm genug, so etwas abends zu tun. Aber morgens um halb neun, wenn die anderen Muttis ihre Einkäufe erledigten, den Staubsauger oder höchstens mal den Tennisschläger schwangen, war es besonders verwerflich, dass ich zu einem Lachs-Sekt-Sex-Frühstück nach Eppendorf fuhr, während ich die Kinder untergebracht hatte und der Ehemann für Haus, Weib und Familie schuftete.
In der Hegestraße bekam ich gleich einen Parkplatz. Auch die Eppendorfer schienen Erwerbstätigkeiten nachzugehen. Als ich zum Liebesversteck stapfte, fiel mir auf, wie malerisch der Hinterhof war. Irgendjemand, wahrscheinlich eine Frau, die ihre Tagesfreizeit sinnvoll verwendete, hatte Blumen in zig Kübeln angepflanzt, die üppig sprossen. Rot, weiß, rosa strahlten sie mir entgegen. An mehreren Ziergittern rankten ebenfalls Blumen in die Höhe. Es beschämte mich irgendwie, dass jemand, der in der Stadt wohnte, sich solche Mühe gab, während ich in meinem Riesengarten es nicht mal schaffte, ein Beet in Ordnung zu halten, geschweige denn die blühende Pracht beim Namen zu kennen.
Ich klingelte. Diesmal dauerte es ein wenig länger, bis der Summer ertönte. Nicht unwahrscheinlich, dass ich ihn geweckt hatte. Wundern würde es mich nicht, ihn verschlafen in Boxershorts und mit verstrubbelten Haaren anzutreffen, in der Hand die erste Zigarette des Tages. Doch als er mir die Tür öffnete, wirkte er wie frisch aus dem Ei gepellt. Reflexartig zitterten meine Knie.
„Schön, dich zu sehen“, hauchte er mir entgegen und küsste mich auf die Wange, wobei er mich in einen Duftumhang hüllte. Déjà-vu. Würde schwer werden, cool zu bleiben.
„Tja, ich habe mit mir gerungen, ob ich kommen soll“, gab ich zurück und ließ mich widerstandlos in die Wohnung ziehen.
„Ein Glück, dass du gekommen bist. Sonst wäre ich hier ja jämmerlich zugrunde gegangen“, entgegnete Tom.
„Oooooh“, simulierte ich Mitleid.
Tom drückte mir ein Glas mit einer perlenden Flüssigkeit in die Hand. „Nun bist du zum Glück hier und darauf trinken wir.“
„Um die Zeit schon Prosecco? Na, ich weiß nicht. Dann bin ich ja gleich angetüdelt.“
„Lieber jetzt als später. Dann bist du wieder nüchtern, wenn du den Kleinen abholst!“
Auch eine Logik. Wir klirrten die Gläser aneinander, schauten einander tief in die Augen und nahmen einen Schluck. Lecker. Irgendwie war die Aufregung von Sonntag schon wieder vergessen.
„Mmmmh“, machte ich.
„Die Wahrheit ist, dass ich dich betrunken und willenlos machen will, um dann über dich herzufallen“, sagte er. Wir lachten beide.
Tom bugsierte mich in die Küche. Sie war klein, eine schmale weiße Kochzeile mit Schränken. Neben dem Spülbecken türmte sich sauberes Geschirr. Ein rotkariertes Tuch hing zum Trocknen auf der Heizung. Um einen sorgfältig gedeckten Bistrotisch standen zwei gemütlich aussehende Stühle mit breiten Armlehnen. In gemusterten Weingläsern lagen gepellte Eier mit Schnittlauch. Eine Käseplatte, ein Teller mit verschiedenen Sorten Aufschnitt, Marmelade, Honig, Schälchen mit Krabben- und Heringssalat sowie ein Korb voller frischer Brötchen ließen mir das Wasser im Munde zusammenlaufen. Was mich besonders rührte, war, dass er die Salate aus ihren hässlichen Supermarktplastikverpackungen in Porzellanschälchen umgefüllt hatte. Wer sich in Details so viel Mühe gab, musste ein fantastischer Liebhaber sein, dachte ich. Ein verzücktes Lächeln breitete sich auf meinem Gesicht aus. Ich grinste grenzdebil. So einfach war ich also zu beeindrucken, so leicht herumzukriegen. Vor ein paar Tagen noch wollte ich ihn nie mehr wiedersehen und fragte mich, wie um alles in der Welt ich so blöd gewesen sein konnte, auf ihn hereinzufallen. Nun stand ich hier mit wackligen Knien und starrte auf einen nett gedeckten Tisch, als würde er mir die Kronjuwelen der englischen Königin präsentieren.
„Noch ein Schlückchen zum Anstoßen?“ fragte er und schenkte mir nach.
Mit einem leisen „Kling“ ließen wir die Gläser aneinander stoßen und tranken. Dann setzten wir uns. Ich konnte mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt mit so einem Appetit gegessen hatte. Die Eier waren genau richtig weich, sie zerflossen beim Anstechen und vermischten sich mit dem scharfen Schnittlauch.
„Lecker“, sagte ich mit vollem Mund. „Hab ich so noch nie gegessen.“
Dazu biss ich in ein krosses Brötchen, dick mit Krabbensalat belegt. Ich kaute, meine Gedanken schweiften ab. Ich erinnerte mich an ein anderes Frühstück mit meinem Ehemann, bevor er es wurde. Damals wohnte ich noch zu Hause. Meine Eltern waren eine Woche mit meiner kleinen Schwester an die Nordsee gefahren und hatten mich mit der Katze zu Hause gelassen. Ich freute mich auf eine sturmfreie Bude. Stefan und ich zerrten die Matratze aus meinem Jugendzimmer zwei Stockwerke tiefer ins Wohnzimmer – vor den Fernseher. Warum wir es damals als Krönung empfanden, im Bett vor dem Fernseher zu liegen, ist mir aus heutiger Sicht ein Rätsel. Vielleicht, weil ich als Kind nicht so viel Fernsehen durfte, wie ich wollte? Im Laufe der Jahre bin ich jedoch traumatisiert worden, weil ich mit den bunten Bildern um die Aufmerksamkeit meines Ehemannes konkurrieren musste. Damals jedenfalls schliefen wir gemütlich vor dem Fernseher ein, und am nächsten Morgen machte ich ihm zum ersten Mal Frühstück. Vorher durfte er ja nie bei mir schlafen – meine Eltern tolerierten keine männlichen Übernachtungsbesuche.
Ich hatte also am Tag zuvor eingekauft – Sekt und Lachs und Krabben – sowie Fleischsalat, zu all dem kredenzte ich Tomaten. Ich buk Brötchen auf, briet Spiegeleier und kochte grünen Tee. Für mich war das der Inbegriff des Genusses. Er wartete derweil im Bett. Der Fernseher lief bereits.
„Stefan, Frühstück ist fertig!“, rief ich. Stolz präsentierte ich den gedeckten Tisch.
Wir setzten uns und begannen zu essen. Erst unterhielten wir uns lustig, dann schlich sich ein ernsterer Tonfall ein. Es hing wohl mit den Unterschieden zu seinem gewohnten Frühstück zusammen, bei seiner Mutter gab es weiße Brötchen, Kaffee und Erdbeermarmelade. Er betrachtete die Spiegeleier und den Lachs pikiert und langte stattdessen bei der Marmelade kräftig zu. Als ich ihm die Salate ans Herz legte („Magst du nicht mal probieren?“) und er ablehnte („Nee, so was essen wir zu Hause nicht.“), stiegen mir Tränen der Enttäuschung in die Augen.
„Aber das ist doch nicht so gemeint! Tut mir leid!“, sagte er erschrocken. Schluchzend sprang ich auf, schrie irgendetwas von wegen „Totale Mühe gemacht! Banause! Gemeinheit!“ und stürmte ins Bad, wo ich mich verbarrikadierte.
„Ich wusste nicht, welche Salate du magst“, sagte Tom und riss mich aus meinen Erinnerungen.
„Ach, eigentlich alle“, entgegnete ich. Ich nahm noch ein Brötchen, das ich mit Farmersalat und Matjestopf belegte. Aus dem Nebenzimmer erklang leise Musik, eine Frauenstimme flüsterte irgendetwas von „love and pain“.
„Du siehst so nachdenklich aus, alles in Ordnung?“, fragte Tom.
Ich nickte. „Ja, alles gut. Danke dir für dieses tolle Frühstück!“
Er schüttelte den Kopf. „Das ist doch nichts. Ich danke dir, dass du gekommen bist.“
Unsere Hände fanden sich über den Tisch. Seine waren sehr warm, mit langen, kräftigen Fingern. Er hatte schöne Hände, darauf achtete ich bei Männern immer als erstes. Hände, die arbeiteten, die festhalten, aber auch streicheln konnten. Was ich gar nicht leiden konnte, waren dünne, zittrige Finger, auf denen Haare wuchsen, mit abgekauten oder zu langen Fingernägeln.
Er küsste meine Hand und rückte mit seinem Stuhl um den Tisch herum. Von seinem Duft wurde mir schwindelig, oder lag es am Prosecco, der immer wieder in mein Glas floss und von dort in meine Kehle? Nein, ich nahm nur Minischlückchen. Heute wollte ich ganz Herrin meiner Sinne bleiben. Sein Arm glitt um meine Schultern, die Hand strich meinen Rücken hinunter, so warm ich hätte mich am liebsten in die Handfläche hineingelegt wie in ein Bett. Ich drehte den Kopf und spürte, wie seine Lippen sich langsam über meinen Hals und die Wange zum Mund vortasteten. Als unsere Lippen sich trafen, war es ein Wiedererkennen. Wir küssten einander, als hätten wir nie etwas anderes getan. Unsere Zungen und Lippen schienen wie füreinander geschaffen, sprachen ihre eigene Sprache mit einer Virtuosität, die jedes andere Gespräch banal erscheinen ließ.
Nie zuvor hatte ich eine solche Intensität erlebt. In dieser Küche, mit diesem Kerl, der mir so fremd und dennoch so vertraut war, fiel ich in einen Kussrausch, den ich nicht mal mit 17, bei meinen ersten wirklich aufregenden sexuellen Erfahrungen, erlebt hatte. Irgendwie standen wir auf. Es schien mir wunderbar, sich von diesem großen, männlichen Mann umarmen zu lassen, ich kam mir zierlich und weiblich vor. Unter seinem Jeanshemd spürte ich nackte Haut, die unbehaarte Brust, die ich schon am vergangenen Samstag berührt hatte.
Heute war ich noch hungriger. Wenn schon eine Affäre, dann auch richtig. Wir taumelten wie trunken ins Schlafzimmer, fielen auf die Matratze, in weiße Bettwäsche, die Jalousien geschlossen, hatte er es schon geplant? Meine Augenlider flatterten, während Lippen sich vortasteten, Hände unter Kleidungsstücke fuhren, Knöpfe lösten, Reißverschlüsse öffneten. Mein Atem wurde eins mit seinem, zusammen schwammen wir in einem Fluss aus Seufzern, über Wasserströmungen, die uns tiefer hinab zogen, tiefer, bis wir nackt unter den Decken lagen, meine Hand an seinem Schwanz, der sich in meine Handfläche schmiegte. Passte wie angegossen. Wir spielten miteinander, rangelten, jede Bewegung war ganz natürlich.
Sein Mund huschte über meine Brüste, meinen Bauch, die Scham, seine Zunge lockte und kitzelte mich, tauchte in mich hinein, während seine Hände meine Hüften nach unten drückten, ich stöhnte, zog ihn hinauf, hielt inne.
„Was ist los?“ Seine Stimme war flüssiger Honig.
„Ich kann nicht. Ich verhüte nicht.“ Die Kondompackung hatte ich natürlich vergessen.
Er griff hinter sich und fischte ein Kondom aus einem türkisen Emaille-Topf.
„Ähem“, sagte ich. Zweifelnd blickte ich das eingeschweißte Verhüterli an, plötzlich ernüchtert. „Ich weiß nicht so recht.“
Meine letzte Erfahrung mit so einem Ding lag schon viele Jahre zurück und war nicht gerade berauschend gewesen. Das Gummi hatte meine Empfindungen stark eingeschränkt. Andererseits, selbst wenn ich nicht verhüten müsste, gab es auch andere Risiken. Ich wusste ja nicht, mit wie vielen Frauen Tom geschlafen hatte, aber es waren gewiss nicht wenige gewesen.
„Ich bin auch nicht so ein Fan davon“, sagte er und näherte sich mir wieder auf gefährliche Weise.
„Mit wie vielen Frauen warst du eigentlich im Bett?“
„Heute? Du bist die erste.“
„Haha. Ernsthaft.“
„Wieso willst du das wissen?“
„Na ja, ich will einfach das Risiko abschätzen.“
„Och. Keine Ahnung. So um die fünfzig vielleicht?“
„Waaas?“ Ich zuckte zurück, als hätte ich auf eine heiße Herdplatte gefasst. „So viele?“
„Vielleicht waren es auch weniger. Zwanzig oder so.“
„Du nimmst mich nicht ernst!“, schimpfte ich.
„Doch natürlich tue ich das. Ich will nicht, dass etwas geschieht, was du nicht willst. Ich würde sehr gern mit dir schlafen, aber wenn es dir zu riskant ist, lassen wir das.“
„Hmmm.“ Ich ließ mich zurücksinken und überließ mich wieder seinen Händen, die auf der Klaviatur meiner Empfindungen ein Allegretto nach dem nächsten spielten.
Irgendwann richtete er sich schwer atmend auf und riss die Verpackung auf. Sein Schwanz reckte sich kerzengerade nach oben, während er das Gummi darüber streifte. Ich lag neben ihm und betrachtete verzückt, wie ihm die langen Haare ins Gesicht fielen, wie die Brustmuskeln unter der sonnenstudiogebräunten Haut spielten. Tom nahm mich in die Arme, doch während wir uns weiter küssten, spürten wir beide, wie sein Schwanz schrumpfte, all unseren Bemühungen zum Trotz.
„Mist!“
Unsanft rupfte er das Gummi ab und betrachtete ärgerlich seine nun nicht mehr so imposante Körpermitte.
„Macht doch nichts“, sagte ich. In Wahrheit war ich ganz froh. Irgendwie ging es mir doch zu schnell. Wir lagen noch ein paar Minuten zusammen, dann gab ich vor, dringend los zu müssen. Während ich zum Auto ging, zweifelte ich an meiner Unverfrorenheit. Der entscheidende Schritt fiel mir schwerer als gedacht.
KAPITEL 11
In den nächsten Tagen und Wochen wurde ich süchtig nach Endorphinen. Glückshormonen. Mit anderen Worten, ich wurde süchtig nach Toms Küssen.
Wie Hormone mein Wohlgefühl beeinflussen, war mir bewusst, seit ich vom unschuldigen Kinderland ins hormonelle Chaos der Pubertät gestürzt war. Düstere Wolken der Niedergeschlagenheit wechselten sich mit fast schon manischer Aufgekratztheit ab. Mit fünfzehn war ich mal die Verführung in Person, mal liebäugelte ich mit Selbstmordgedichten a la Les Fleurs du Mal. Ein Auf und Ab. Abwechselnd hasste und liebte ich mein Leben. War ich manisch-depressiv?
Die Wahrheit war viel einfacher. Irgendwann entdeckte ich eine Regelmäßigkeit meiner Gefühle, die sich an meinem Zyklus orientierte. Die ersten Zyklustage werden von Unterleibs- und Rückenschmerzen dominiert, Kopfweh, düstere Stimmung und Selbstmitleid kommen dazu. Allmählich geht es bergauf. Dann folgt die tolle Phase vor dem Eisprung. Blendende Laune, ich habe das Gefühl, ich könnte Bäume ausreißen und bin scharf auf Sex. Nach dem Eisprung beginnt die langsame Talfahrt der Östrogene. Mein Befinden dümpelt auf Normalnull herum, um zum Zyklusende auch gern mal weiter abzusinken, was dazu führt, dass ich empfindlich und jähzornig werde, weinerlich und angriffslustig.
Intensives Knutschen führte bei mir dazu, dass ich in Glückshormonen schwamm. Es ging mir blendend. Die Sonne schien nur für mich, die Luft flirrte trotz Novemberkälte verführerisch, ich tänzelte durch meinen Alltag. Wenn ich von meinem Vormittags-Frühstücks-Knutschstündchen zurücksauste, um meinen Sohn vom Kindergarten abzuholen, fühlte ich mich unverschämt gut. Auch wenn das schlechte Gewissen den Hormonrausch etwas dämpfte … aber ich redete mir ein, dass es bloß eine kleine Affäre war – nicht mal, es gab ja keinen Sex. Solange ich nicht mit Tom schlief, betrog ich meinen Mann ja nicht wirklich.
„Motte, kann es sein, dass du ein kleines bisschen verliebt bist?“, fragte Carina. Ich rührte die Nudelsoße um, bevor ich antwortete. Gleich würde Milena aus der Schule kommen. Noah saß schon in seinem Zimmer und baute irgendetwas Hochkompliziertes aus Lego.
„Verliebt? Oh Gott, nein“, entgegnete ich im Brustton der Überzeugung. „Es ist einfach …“, ich suchte nach dem passenden Wort. Schön? Wunderbar? Erfüllend? „Nett“, beendete ich den Satz. Es klang beruhigend harmlos.
„Aha.“ Ihre Skepsis troff aus dem Hörer. „Nett also. Mehr nicht? Pass bloß auf, dass du dich nicht in ihn verliebst. Der ist gefährlich.“
„Nein, tue ich nicht.“
„Dann kommst du Donnerstag auch mit uns ins Bereuther?“
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2013
- ISBN (eBook)
- 9783942822367
- DOI
- 10.3239/9783942822367
- Dateigröße
- 1.7 MB
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2013 (Juni)
- Schlagworte
- ehe liebeskummer affäre scheidung familie leidenschaft hamburg rosenkrieg disco bar eppendorf nachtleben trennungsschmerz